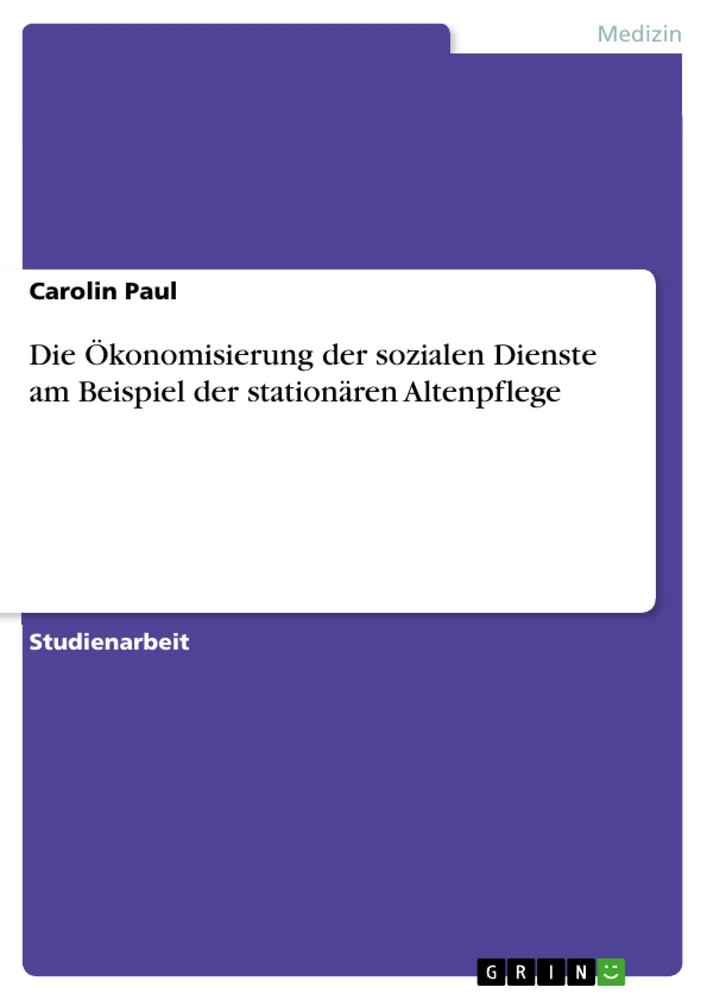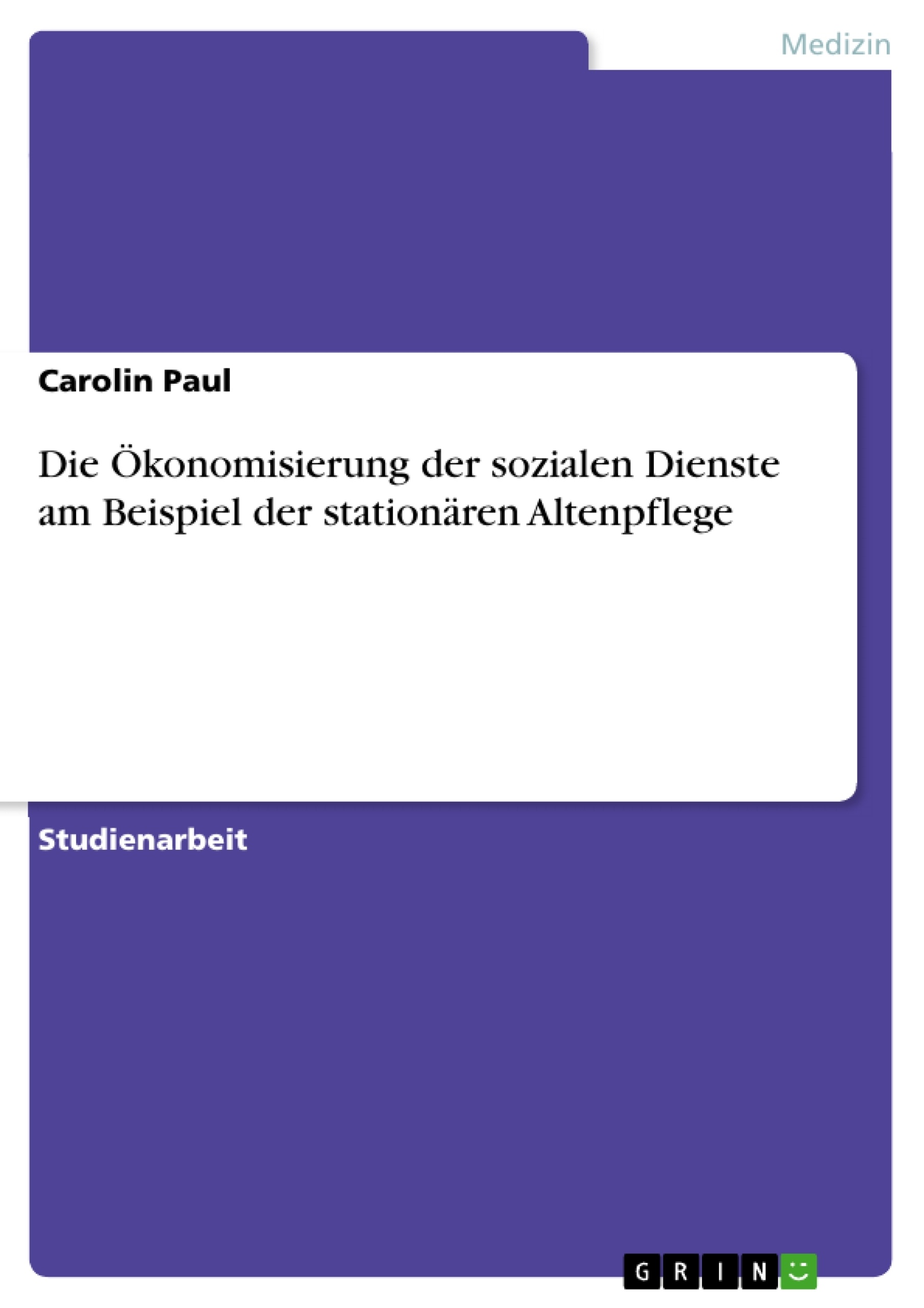Der Begriff „Ökonomisierung“ erlebt gegenwärtig eine Konjunktur und wird damit zu einem der Schlüsselbegriffe unserer Zeit. Wo wirtschaftliche Gesetze bislang wegen wohlfahrtsstaatlicher Standards eine untergeordnete Rolle gespielt haben, gewinnt die Ökonomie an Bedeutung: insbesondere im öffentlichen Dienst, im Gesundheits- und Bildungswesen sowie in der Wirtschaft. Der Einsatz von marktwirtschaftlichen Steuerungselementen führt zu einer voranschreitenden Verknappung der öffentlichen Mittel und fördert mehr Wettbewerb, Effizienz und Marktdruck. Öffentliche Einrichtungen unterliegen mehr und mehr den betriebswirtschaftlichen Bedingungen, welche bislang nur für Unternehmen des freien Marktes galten. Insbesondere auch der Bereich der sozialen Dienste wie die Altenpflege erfährt in der gegenwärtigen Zeit Veränderungen, welche durch marktwirtschaftliche Elemente gesteuert werden.
Ansteigende Pflegebedarfszahlen sowie wachsende Komplexität der Anforderungen an die Betroffenen bringen seit den letzten Jahren die Notwendigkeit hervor, entsprechende Versorgungsangebote aus- und aufbauzubauen. Dabei wird der stationären Altenpflege eine zunehmende Bedeutung im Rahmen der professionellen Versorgung und Pflege zuteil. Im Gegensatz zur ambulanten Pflege, bei der Pflegedienste die Pflegeleistung im häuslichen Bereich verrichten, wird der zu Pflegende im Rahmen der vollstationären Altenpflege im Pflegeheim dauerhaft aufgenommen und mit Wohnraum, Nahrung und pflegerischer Betreuung rund um die Uhr versorgt. Immer mehr Menschen werden nicht mehr klassisch zu Hause von Angehörigen und ggf. durch Unterstützung von ambulanten Pflegediensten betreut.
Im Jahr 2011 wurden nach der Pflegestatistik, welche vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird, bereits 30 % (743.000) aller Pflegebedürftigen in Pflegeheimen versorgt. Gegenüber 1999, als die Pflegestatistik erstmalig durchgeführt wurde, ist ein Anstieg von 32 % (180.000) zu verzeichnen. Als Wendepunkt in der Altenpflege wird das Inkrafttreten der sozialen Pflegeversicherung am 1. Januar 19995 betrachtet. Mit Einführung des Elften Sozialgesetzbuches wurde die Finanzierung von Pflegebedürftigkeit geregelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der stationären Altenpflege
- Vom christlichen Dienst zum Dienstleistungsberuf
- Die Bedeutung des demografischen Wandels für die Altenpflege
- Charakteristika der stationären Altenpflege
- Stationäre Altenpflege heute
- Struktur der Pflegeeinrichtungen
- Finanzierung
- Ökonomisierung der stationären Altenpflege unter gesetzlichen und wirtschaftlichen Aspekten
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Qualitätssicherung
- Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit
- Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Arbeitsbedingungen und die Versorgungsqualität
- Indikatoren für „gute Arbeit“
- Zusammenhang zwischen Versorgungsqualität und „guter Arbeit“
- Empirische Untersuchung
- Methodik
- Ergebnisse und Auswertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Arbeitsbedingungen in der stationären Altenpflege. Sie untersucht die Frage, welcher Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedingungen und der Versorgungsqualität besteht und wie gute Arbeitsbedingungen in der stationären Altenpflegearbeit sichergestellt werden können.
- Entwicklung der stationären Altenpflege im Kontext des demografischen Wandels
- Die Ökonomisierung der stationären Altenpflege und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen
- Die Bedeutung von Qualitätssicherung in der Altenpflege
- Der Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und Versorgungsqualität
- Empirische Untersuchung der Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Arbeitsbedingungen in der stationären Altenpflege
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel bietet eine Einleitung und einen Überblick über die Problematik der Ökonomisierung im Kontext der stationären Altenpflege. Es wird erläutert, wie die Ökonomisierung zu Veränderungen in der Altenpflege führt und welche Forschungsfrage die Arbeit zu beantworten sucht.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehung der stationären Altenpflege, ihre historische Entwicklung vom christlichen Dienst zum Dienstleistungsberuf und die Rolle des demografischen Wandels für die Pflegebedürftigkeit.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit den Charakteristika der stationären Altenpflege, insbesondere mit der Struktur der Pflegeeinrichtungen, den Finanzierungsmodellen und den Auswirkungen der Ökonomisierung auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Qualitätssicherung und die wirtschaftliche Effizienz.
- Das vierte Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedingungen in der stationären Altenpflege und der Versorgungsqualität. Dabei werden Indikatoren für „gute Arbeit“ definiert und die Frage nach den Möglichkeiten zur Sicherung guter Arbeitsbedingungen in der stationären Pflegearbeit gestellt.
- Das fünfte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, die durchgeführt wurde, um die Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Arbeitsbedingungen in der stationären Altenpflege zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Ökonomisierung, stationäre Altenpflege, Arbeitsbedingungen, Versorgungsqualität, demografischer Wandel, Qualitätssicherung und empirische Untersuchung. Sie fokussiert auf die Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Arbeitsbedingungen in der stationären Altenpflege und deren Einfluss auf die Versorgungsqualität.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Ökonomisierung“ im Bereich der stationären Altenpflege?
Es beschreibt den zunehmenden Einfluss betriebswirtschaftlicher Logik, Wettbewerb und Marktdruck auf Pflegeeinrichtungen, die früher primär wohlfahrtsstaatlich orientiert waren.
Wie hängen Arbeitsbedingungen und Versorgungsqualität zusammen?
Gute Arbeitsbedingungen sind eine Grundvoraussetzung für eine hohe Versorgungsqualität; Ökonomisierung kann diese durch Zeitdruck und Personalmangel gefährden.
Welche Rolle spielt der demografische Wandel für die Altenpflege?
Steigende Pflegebedarfszahlen erfordern einen massiven Ausbau der Versorgungsstrukturen, was den wirtschaftlichen Druck auf das System erhöht.
Was war der Wendepunkt in der Finanzierung der Altenpflege in Deutschland?
Das Inkrafttreten der sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) am 1. Januar 1995 gilt als zentraler Wendepunkt für die Struktur und Finanzierung.
Was sind Indikatoren für „gute Arbeit“ in der Pflege?
Dazu gehören angemessene Bezahlung, ausreichend Zeit für die Bewohner, psychische Entlastung und Mitspracherechte bei der Arbeitsgestaltung.
- Citar trabajo
- Carolin Paul (Autor), 2014, Die Ökonomisierung der sozialen Dienste am Beispiel der stationären Altenpflege, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284021