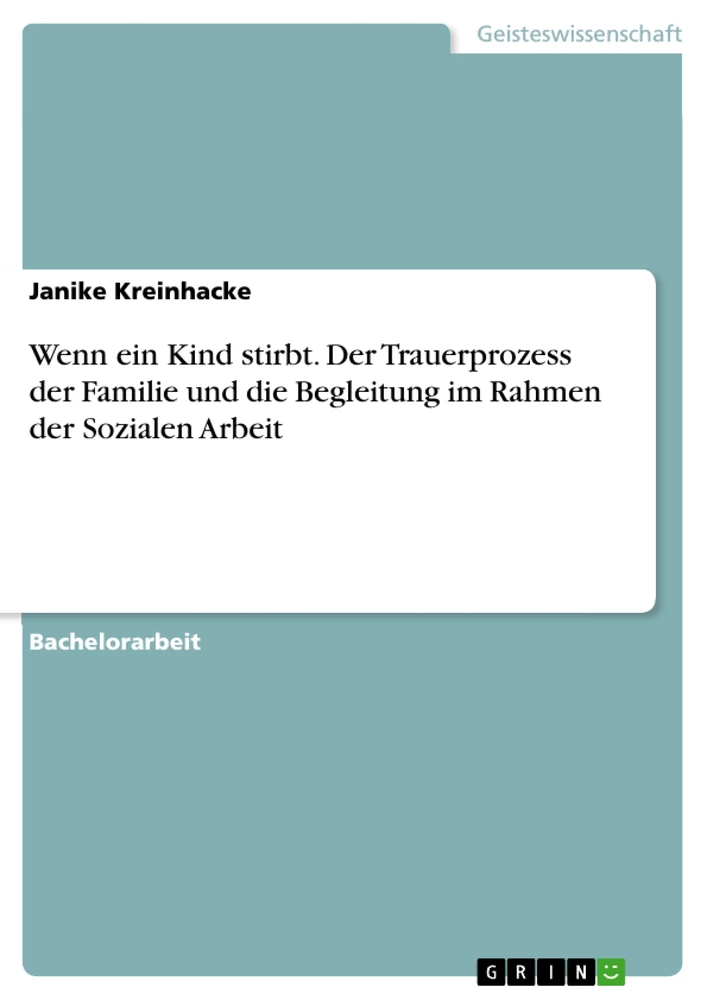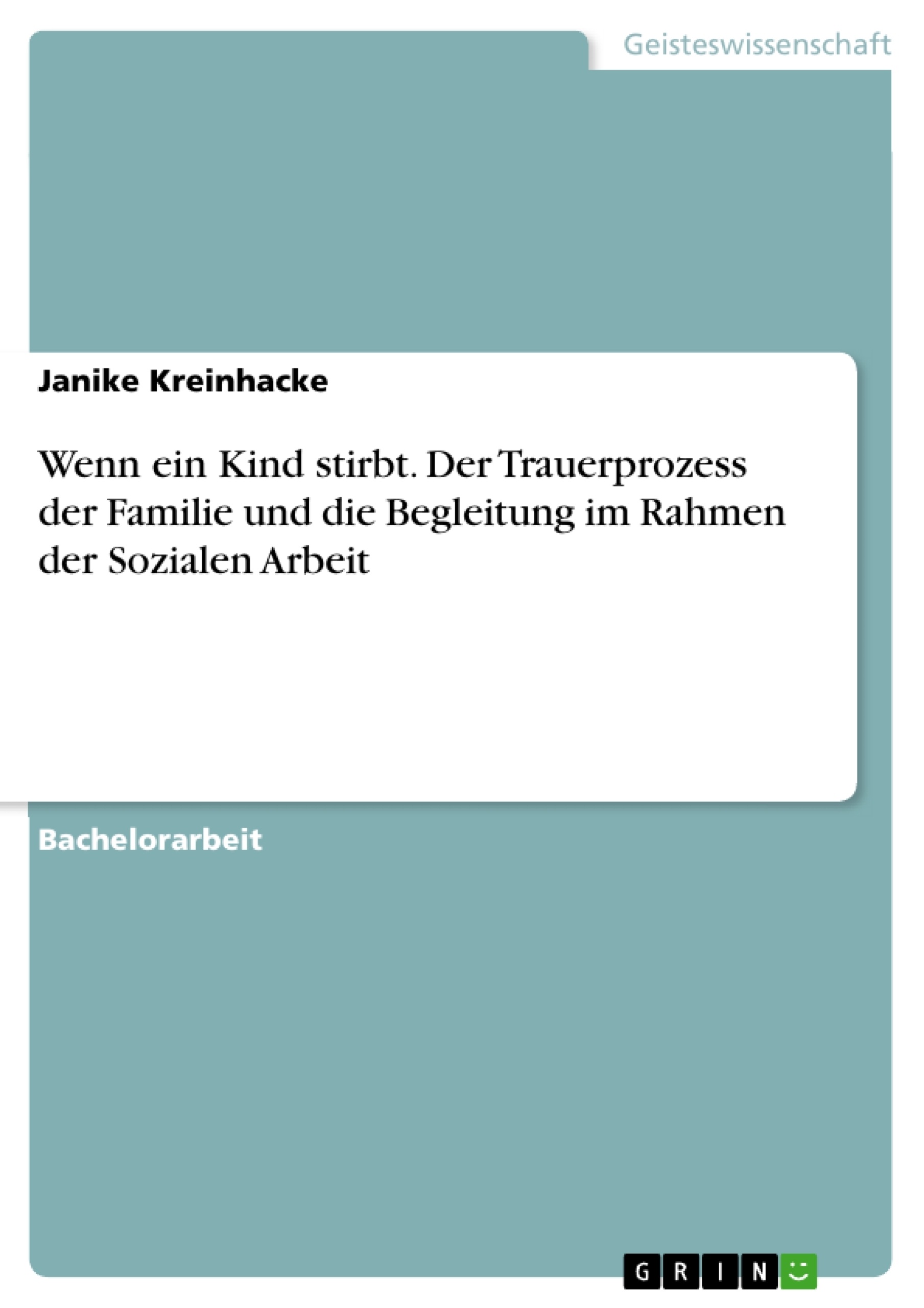In der vorliegenden Arbeit mit dem Thema „Wenn ein Kind stirbt. Der Trauerprozess der Familie“ werde ich mich mit den Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten im Sinne der Trauerbegleitung im System Familie beschäftigen.
In unserer Gesellschaft ist der Tod ein gern unbeachtetes Thema, was unter anderem daran liegt, dass es schwer fällt, über ihn zu sprechen. Das liegt daran, dass es mit dem in unserer Gesellschaft verbreiteten glauben an die Allmacht des Menschen kollidiert und Angstgefühle hervor ruft. Bereits vor etwa 2300 Jahre beschließt Epikur, dass der Tod uns Lebende nichts an geht. Denn wenn wir nicht tot sind, leben wir nicht und somit ginge der Tod uns auch nichts an. Diese Aussage klingt so leicht und verlockend, doch ein jeder Mensch der bereits eine Verlusterfahrung erleiden musste weiß, dass der Tot besonders für Lebende eine enorme Rolle spielt, da sie diejenigen sind, die ihn fühlen und die entstehende Trauer empfinden.
Als Einstieg in meine Arbeit habe ich mich, nachdem ich die wichtigsten Begrifflichkeiten und einen kurzen Überblick über den Stand der Forschung erbracht habe, zunächst mit der Arbeit und der Interaktion mit sterbenden Kindern beschäftigt. Dabei ist deutlich geworden, dass die Wahrheit ein unabdingbarer Teil in dem Trauerprozess der Familie dar stellt und sie dem sterbenskranken Kind nicht vorenthalten werden darf. Die Wahrheit soll den sterbenden Kindern die Möglichkeit geben, sich ein eigenes Bild ihrer Lage zu machen, ihre Ängste verbalisieren zu dürfen und der Familie ganzheitlich die Möglichkeit zu geben, Antworten und Gedanken des Kindes Teil zu werden. Damit stellt die Möglichkeit der Kommunikation durch unverfälschte Informationen einen Teil der Trauerarbeit der Eltern dar, indem sie mit ihrem Kind die Krankheit und den Tod gemeinsam verarbeiten können. Zudem können Tatsachen, die nicht ausgesprochen werden dazu führen, dass sich das Kind verantwortlich für seine Lage fühlt, da es lediglich die Illusion des positiven Ausgangs der Lage zugesprochen bekommen hat und somit die Erklärung dafür fehlt, dass es nicht wieder gesund wird. Dies stört die Chance auf eine erhöhte Lebensqualität der verbleibenden Zeit durch Offenheit und die Möglichkeit des Rückblickst auf die letzte, ehrliche, familiäre Zeit.
Im Anschluss wurde die Interaktion mit den trauernden Eltern thematisiert, die viele Erkenntnisse über das individuelle Trauerver
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Der Tod
- Sterben und Sterbephasen
- Trauer und Trauerphasen
- Familie
- Stand der Forschung zum Thema „Das Sterben von Kindern
- In Interaktion mit dem sterbenden Kind - Vertrauen und Wahrheit als ein Teil der Trauerarbeit
- In Interaktion mit den trauernden Eltern
- Trauerarbeit vor dem Tod
- Trauerarbeit nach dem Tod
- Dem Tod ins Auge blicken
- Möglichkeiten der Gestaltung
- Die Beerdigung und das Grab
- Geschlechtsspezifische Aspekte
- Mütter
- Väter
- Die Bedeutung der Todesursache bei der Trauerarbeit
- In Interaktion mit den trauernden Geschwistern - Das Todeskonzept des Kindes
- Die Bedeutung von Geschwisterbeziehungen
- Die Trauer von Geschwisterkindern
- Schuldgefühle
- Suizid von Bruder oder Schwester
- Aberkannte Trauer
- Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Trauerarbeit mit Kindern
- Aufgaben der Begleitung für die Praxis der Sozialen Arbeit im Rahmen der Unterstützung trauernder Familien
- Aufgabenmodelle als eine Bewältigungsstrategie in perimortalen Trauersituationen
- Professionelle Einrichtungen als räumlicher Rahmen der Begleitung für trauernde Familien am Beispiel des Hospizes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Trauerprozess von Familien, die den Verlust eines Kindes erlitten haben. Sie will die Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten der Trauerbegleitung im Familiensystem beleuchten. Die Arbeit fokussiert auf die Interaktion mit dem sterbenden Kind, den trauernden Eltern und Geschwistern sowie auf die Aufgaben der Sozialen Arbeit in der Begleitung trauernder Familien.
- Die Bedeutung von Wahrheit und Vertrauen in der Trauerarbeit mit Kindern
- Die Besonderheiten des Trauerprozesses bei Eltern und Geschwistern
- Die Rolle von Geschlechtsspezifischen Aspekten in der Trauerarbeit
- Aufgabenmodelle und Bewältigungsstrategien für Trauernde und BegleiterInnen
- Die Bedeutung von professionellen Einrichtungen wie Hospizen für die Unterstützung trauernder Familien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und setzt den Tod und die Trauer in den Kontext der Gesellschaft und des menschlichen Lebens. Die theoretischen Grundlagen befassen sich mit den Begriffen „Tod“, „Sterben“, „Trauer“ und „Familie“ und liefern ein gemeinsames Verständnis für diese zentralen Begriffe. Die Arbeit untersucht den Forschungsstand zum Thema „Das Sterben von Kindern“ und beleuchtet die Interaktion mit dem sterbenden Kind sowie mit den trauernden Eltern im Kontext des Trauerprozesses. Dabei werden die Besonderheiten der elterlichen Trauer in der perimortalen Phase, mögliche Hilfestellungen und geschlechtsspezifische Aspekte thematisiert. Die Interaktion mit den trauernden Geschwistern wird ebenfalls beleuchtet, wobei die Bedeutung von Geschwisterbeziehungen und die Besonderheiten ihrer Trauer, einschließlich möglicher Schuldgefühle, im Vordergrund stehen. Die Arbeit geht auf die Aufgaben der Begleitung für die Praxis der Sozialen Arbeit im Rahmen der Unterstützung trauernder Familien ein und stellt Aufgabenmodelle sowie professionelle Einrichtungen wie Hospize vor.
Schlüsselwörter
Tod, Trauer, Sterben, Familie, Trauerprozess, Trauerbegleitung, Geschwister, Eltern, Kind, soziale Arbeit, Hospiz, perimortal, Bewältigungsstrategien, Trauerarbeit, Todkonzept, Wahrheit, Vertrauen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Wahrheit im Umgang mit sterbenden Kindern so wichtig?
Wahrheit ermöglicht es dem Kind, Ängste zu verbalisieren und verhindert, dass es sich für seine Lage verantwortlich fühlt. Sie gibt der Familie die Chance auf eine ehrliche letzte gemeinsame Zeit.
Wie unterscheidet sich die Trauer von Müttern und Vätern?
Die Arbeit beleuchtet geschlechtsspezifische Aspekte in der Trauerarbeit, wobei oft unterschiedliche Bewältigungsstrategien und Ausdrucksformen der Trauer bei Elternteilen beobachtet werden.
Welche besonderen Herausforderungen haben trauernde Geschwister?
Geschwister leiden oft unter Schuldgefühlen oder "aberkannter Trauer", da die Aufmerksamkeit primär den Eltern gilt. Ihr Todeskonzept unterscheidet sich je nach Alter stark.
Was ist die Aufgabe der Sozialen Arbeit in der Trauerbegleitung?
Soziale Arbeit bietet perimortale Unterstützung, hilft bei der Gestaltung von Abschiedsritualen und vermittelt in professionelle Einrichtungen wie Hospize.
Warum wird der Tod in unserer Gesellschaft oft gemieden?
Der Tod kollidiert mit dem modernen Glauben an die Allmacht des Menschen und ruft starke Angstgefühle hervor, weshalb er oft tabuisiert wird.
- Citation du texte
- Janike Kreinhacke (Auteur), 2013, Wenn ein Kind stirbt. Der Trauerprozess der Familie und die Begleitung im Rahmen der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284079