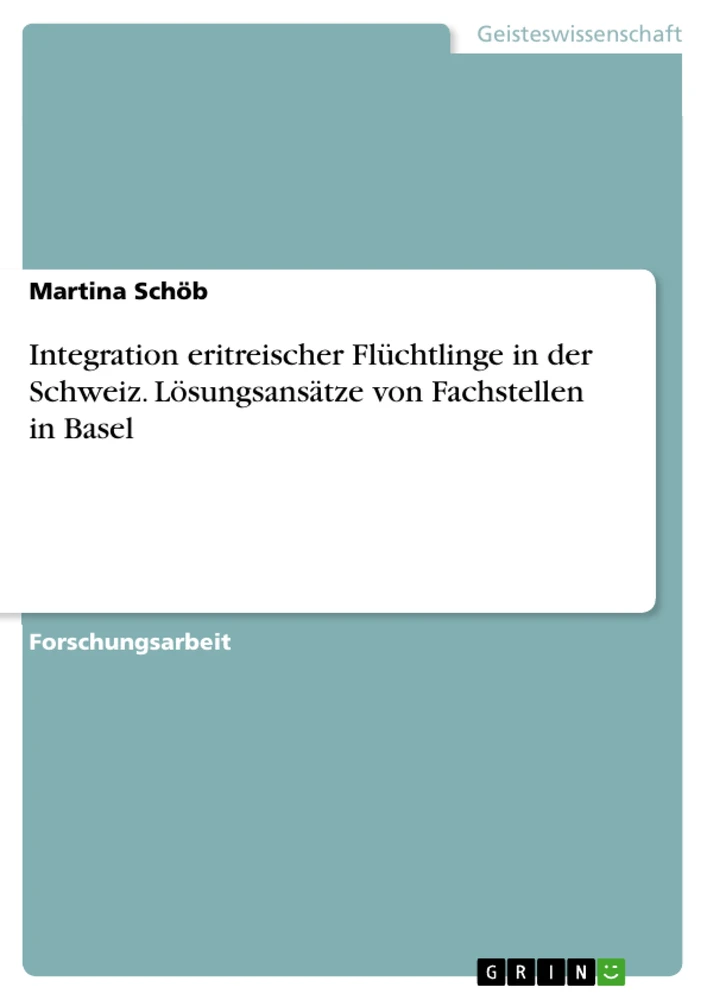EritreerInnen stellen zurzeit - neben Syrern, Nigerianern und Tunesiern - am meisten Asylgesuche in der Schweiz und können in vielen Fällen im Aufnahmeland bleiben. Ihre Integration wird vom Bundesrat und den zuständigen Fachstellen als schlecht wahrgenommen. Seitens des Bundes bereitet insbesondere die berufliche Integration Sorgen. In dieser Arbeit wird deshalb anhand vom Bundesamt für Migration zur Verfügung gestellten Daten untersucht, ob die berufliche Situation von EritreerInnen tatsächlich so schlecht ist wie angenommen.
Anhand von Experteninterviews mit VertreterInnen von Fachstellen wurde eruiert, wo diese die Hauptprobleme für die mangelnde Integration sehen und was die ExpertInnen vorschlagen, um die Situation zu verbessern. Es wurde herausgearbeitet, dass die Anzahl der SozialhilfebezügerInnen bei den EritreerInnen in der Schweiz hoch ist. Nur jeder zehnte verdient sich seinen Lebensunterhalt völlig unabhängig von der Sozialhilfe. Allerdings sind in der Sozialhilfequote auch Personen unter 18 und über 65 eingerechnet. Das sind fast 40 Prozent aller EritreerInnen in der Schweiz. Von den EritreerInnen im erwerbsfähigen Alter gehen knapp ein Drittel keiner Beschäftigung nach. Die restlichen zwei Drittel sind erwerbstätig oder zählen zu den Nichterwerbspersonen.
Nichterwerbspersonen sind beispielsweise solche, die sich um den Haushalt kümmern oder eine Ausbildung absolvieren. Wobei sich mindestens jede vierte Frau im erwerbsfähigen Alter um Haushalt und Kinder kümmert. Durch die Interviews mit den Fachstellen wurde klar, dass man sich zwar bewusst ist, dass es an einer ausreichenden beruflichen Integration von EritreerInnen fehlt. Man will sich aber bei Integrationsprojekten erst einmal auf die soziale Integration von Frauen und Kindern konzentrieren. Ein Grund dafür ist, dass man an Schulen viele verhaltensauffällige eritreische Kinder beobachtet.
Durch Kindererziehungskurse für eritreische Mütter will man einerseits die Chancen der Kinder im schweizerischen Bildungssystem erhöhen und andererseits auch die Familien nachhaltig stärken und vernetzen. Eine weitere Priorität der Fachstellen ist die Informationsarbeit. EritreerInnen sollen zeitnah und einheitlich über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt werden. Dadurch soll der Grundstein für eine spätere erfolgreiche Integration gelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methoden
- Die Schweizer Asylpolitik
- Rechtliche Grundlagen für den einzelnen Flüchtling
- Integrationspolitik im Flüchtlingsbereich
- Berufliche Integrationsförderung im Flüchtlingsbereich
- Eritreische Flüchtlinge in der Schweiz
- Klärung des Integrationsbegriffs
- Integration im Allgemeinen
- Verschiedene Dimensionen von Integration
- Die berufliche Integration als Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Integration
- Ab welchem Status sollen Flüchtlinge im Aufnahmeland integriert werden?
- Die berufliche Integration der EritreerInnen in der Schweiz
- Hohe Anerkennungsquote
- SozialhilfebezügerInnen und finanziell Unabhängige
- Erwerbssituation der SozialhilfebezügerInnen
- Bildungssituation der SozialhilfebezügerInnen
- Lösungsansätze von Fachstellen in Basel zur Verbesserung der Integration von EritreerInnen
- Bestehende Angebote und definitive Projektpläne
- Denkbare Massnahmen für eine erfolgreiche Integration
- Zusammenführung der Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit analysiert die Integration von eritreischen Flüchtlingen in der Schweiz, mit einem Fokus auf ihre berufliche Situation. Die Arbeit zielt darauf ab, die vom Bundesrat und Fachstellen wahrgenommenen Schwierigkeiten bei der Integration von EritreerInnen zu untersuchen und mögliche Lösungsansätze von Fachstellen in Basel zu beleuchten.
- Die Situation der eritreischen Flüchtlinge in der Schweiz und ihre Asylgesuche
- Die Schweizer Asylpolitik und ihre Auswirkungen auf die Integration von Flüchtlingen
- Der Integrationsbegriff und seine verschiedenen Dimensionen
- Die berufliche Integration von EritreerInnen in der Schweiz und die Faktoren, die sie beeinflussen
- Lösungsansätze von Fachstellen in Basel zur Verbesserung der Integration von EritreerInnen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema der Integration eritreischer Flüchtlinge in der Schweiz einführt und die Forschungsfrage präzisiert. Im Kapitel "Methoden" wird die Vorgehensweise der Forschungsarbeit erläutert, die Datenbasis und die Methoden der Datenerhebung und -analyse vorgestellt. Die Kapitel "Die Schweizer Asylpolitik" und "Eritreische Flüchtlinge in der Schweiz" beleuchten den rechtlichen und historischen Kontext, in dem die Integration von Flüchtlingen in der Schweiz stattfindet.
Im Kapitel "Klärung des Integrationsbegriffs" wird der Begriff "Integration" definiert und seine verschiedenen Dimensionen – individuelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche, soziale, politische und interne – erläutert. Das Kapitel "Die berufliche Integration der EritreerInnen in der Schweiz" analysiert anhand von Daten die Sozialhilfequote, die Erwerbssituation und den Bildungsstand von EritreerInnen. Der Fokus liegt dabei auf der beruflichen Integration der EritreerInnen und ihren Herausforderungen.
Das Kapitel "Lösungsansätze von Fachstellen in Basel zur Verbesserung der Integration von EritreerInnen" stellt die aktuellen Integrationsangebote von Fachstellen in Basel vor und präsentiert konkrete Projektpläne und denkbare Massnahmen, die von Experten vorgeschlagen werden, um die Integration der EritreerInnen zu verbessern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schwerpunkten der eritreischen Flüchtlingsintegration in der Schweiz, der Schweizer Asylpolitik, dem Integrationsbegriff und seinen Dimensionen, der beruflichen Integration von EritreerInnen, den Herausforderungen der Integration und den Lösungsansätzen von Fachstellen in Basel.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist die aktuelle Erwerbssituation eritreischer Flüchtlinge in der Schweiz?
Etwa ein Drittel der Eritreer im erwerbsfähigen Alter geht keiner Beschäftigung nach; die Sozialhilfequote ist insgesamt sehr hoch.
Warum liegt der Fokus der Fachstellen in Basel oft auf Frauen und Kindern?
Man beobachtet Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern an Schulen und setzt daher auf soziale Integration und Erziehungskurse für Mütter zur langfristigen Stärkung der Familien.
Was sind die Hauptprobleme bei der beruflichen Integration?
Neben fehlenden Qualifikationen spielen rechtliche Rahmenbedingungen und mangelnde Informationsarbeit über Rechte und Pflichten eine zentrale Rolle.
Wie viele Eritreer sind finanziell völlig unabhängig von der Sozialhilfe?
Laut der Untersuchung verdient nur etwa jeder zehnte Eritreer in der Schweiz seinen Lebensunterhalt völlig unabhängig von Sozialleistungen.
Welche Lösungsansätze schlagen Experten in Basel vor?
Empfohlen werden zeitnahe Informationsarbeit, gezielte Vernetzungsprojekte sowie eine stärkere Förderung der sozialen Integration als Basis für den Arbeitsmarkt.
- Citation du texte
- Martina Schöb (Auteur), 2013, Integration eritreischer Flüchtlinge in der Schweiz. Lösungsansätze von Fachstellen in Basel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284221