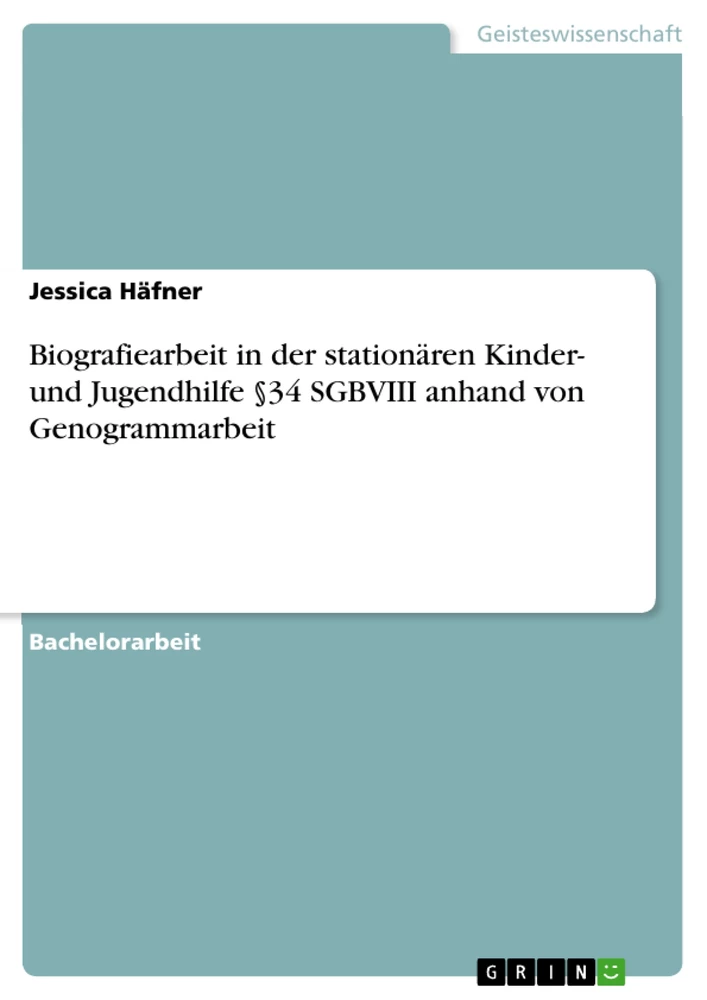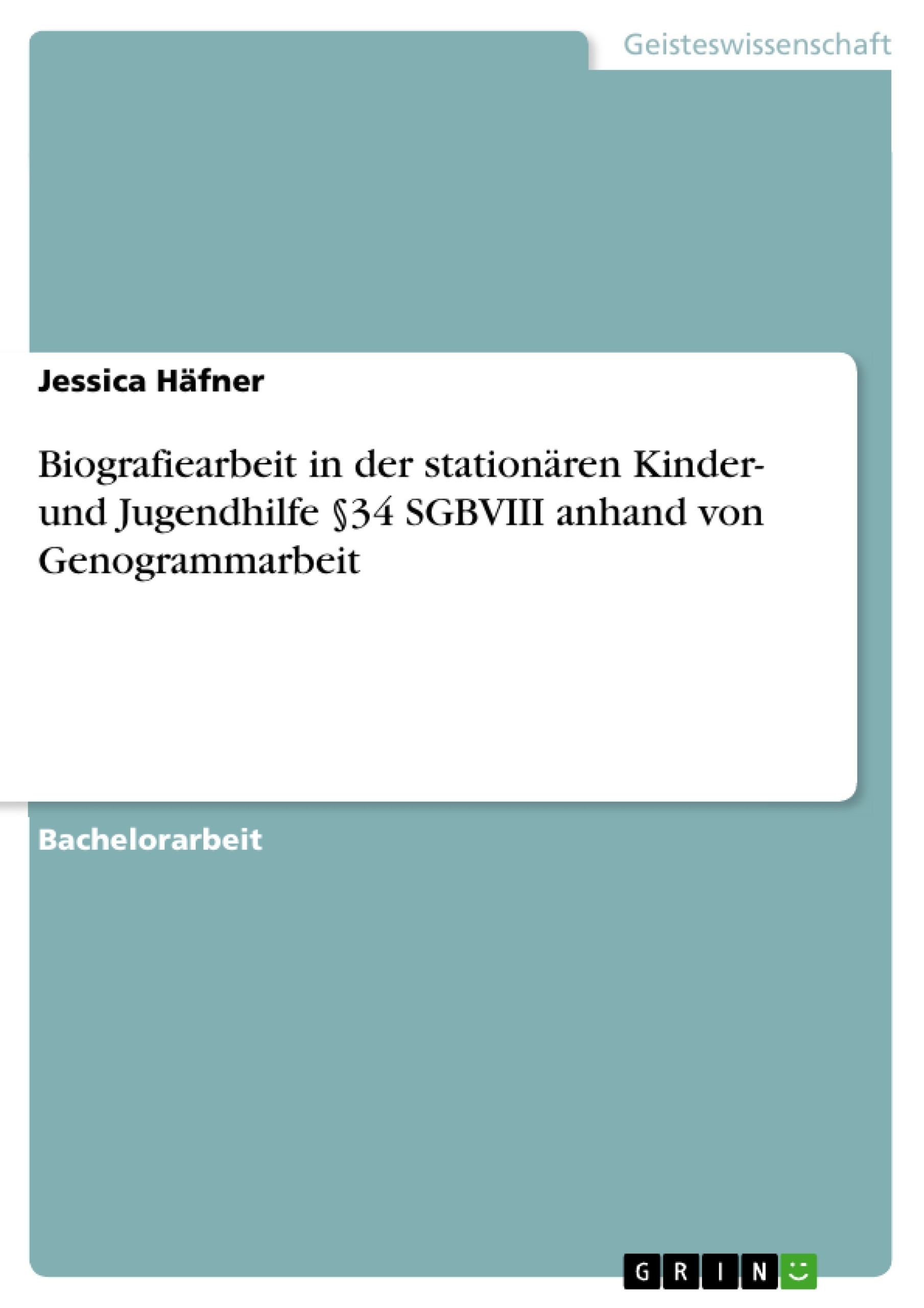Die Verfasserin absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Kinder- und Jugenddorf. Außerdem hat sie während des Studiums im Amt für Jugend, Familie und Bildung, in der Abteilung Allgemeiner Sozialdienst ein Praxissemester abgelegt. In diesem Rahmen waren ihr Einblicke in die (stationäre) Kinder- und Jugendhilfe möglich und sie konnte eigene Erfahrungen gewinnen. Ihr wurde deutlich, dass die Anzahl der Kinder, die nicht mehr in ihrem Elternhaus leben können, zunehmend steigt.
Nach der Erhebung des statistischen Bundesamtes lebten Ende 2011 65.000 Kinder und Jugendliche in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform (vgl. ohne Verfasser, 2012). Die Gründe für eine Heimunterbringung können höchst unterschiedlich sein. Jedes Kind ist bis zur Heimaufnahme seinen ganz individuellen Weg gegangen. Dieser Weg wurde häufig von negativen Erlebnissen, wie z. B. Beziehungsabbruch, psychische oder physische Gewalt, sexueller Missbrauch bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen, denen die Kinder ausgesetzt waren, begleitet (vgl. Kormann, 1996, S. 43). Eine stationäre Wohnform bietet den Kindern einerseits einen geschützten Rahmen, und andererseits ist sie eine große Chance, für ihre weitere Entwicklung (vgl. Günder, 1999, S. 112).
Für die kindliche Entwicklung ist ein stabiles und emotionales Umfeld in den ersten Lebensjahren besonders wichtig. Dadurch erwerben die Kinder Kompetenzen die sie befähigen, handlungsfähig und eigenständig zu werden. Durch die erworbenen Kompetenzen wird deutlich, wie die Kinder zukünftig Anforderungen und Entwicklungsaufgaben bewältigen können. Der Einfluss des sozialen Umfeldes ist sehr prägend und darf nicht unterschätzt werden (vgl. Textor, EJ unbekannt, Abschnitt: Zur Bedeutung sozial-emotionaler Entwicklung im frühen Kindesalter). [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärung und Grundlagen
- 2.1 Biografie
- 2.2 Biografiearbeit
- 2.3 Genogrammarbeit die Frage der Definition
- 2.4 Gegenstand der Biografiearbeit
- 2.4.1 Biografische Selbstreflexion
- 2.4.2 Autobiografisches Gedächtnis
- 3. Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe §34 KJHG
- 3.1 Begriffsklärung Jugendhilfe
- 3.2 Rechtliche Grundlagen §34 SGBVIII Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
- 3.3 Gründe für eine stationäre Aufnahme
- 4. Biografiearbeit mit Kindern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
- 4.1 Für welche Kinder ist Biografiearbeit geeignet
- 4.1.1 Kinder in stationärer Erziehungshilfe
- 4.2 Der Nutzen und die Wichtigkeit der Biografiearbeit mit fremdplatzierten Kindern
- 4.3 Hinweise zur Durchführung der Biografiearbeit
- 4.3.1 Umfang und Dauer
- 4.3.2 Einbindung von Biografiearbeit in den Lebensalltag und institutionellen Tagesablauf
- 4.3.3 Anwendungskompetenzen in der Biografiearbeit mit Kindern
- 4.3.4 Zentrale Themen in der Biografiearbeit
- 4.3.4.1 Bedeutung der Eltern
- 4.3.4.2 Der Loyalitätskonflikt
- 4.4 Verwendung kreativer Methoden in der Biografiearbeit
- 4.4.1 Modifizierung der Genogrammarbeit in der stationären Kinder und Jugendhilfe
- 5. Fazit und Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Anwendung von Biografiearbeit, insbesondere mit Genogrammen, im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe nach §34 SGB VIII. Ziel ist es, die Bedeutung und den Nutzen dieser Methode für die betroffenen Kinder und Jugendlichen aufzuzeigen und praktische Hinweise für die Durchführung zu geben.
- Bedeutung der Biografiearbeit für die Entwicklung von Kindern in der stationären Jugendhilfe
- Methodische Ansätze der Biografiearbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen
- Die Rolle des Genogramms als Werkzeug der Biografiearbeit
- Herausforderungen und Chancen der Biografiearbeit im institutionellen Kontext
- Praktische Implikationen für die pädagogische Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den persönlichen Hintergrund der Autorin, der ihre Auseinandersetzung mit der Thematik geprägt hat. Sie verweist auf die steigende Zahl von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen und die damit verbundenen Herausforderungen. Die Bedeutung eines stabilen und emotionalen Umfelds für die kindliche Entwicklung wird hervorgehoben, und die Biografiearbeit als eine Methode zur Bewältigung traumatischer Erfahrungen wird vorgestellt.
2. Begriffserklärung und Grundlagen: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie Biografie, Biografiearbeit und Genogrammarbeit. Es definiert den Gegenstand der Biografiearbeit und erläutert die Bedeutung von biografischer Selbstreflexion und autobiografischem Gedächtnis im Prozess der Verarbeitung von Erfahrungen. Die theoretischen Grundlagen werden gelegt, auf denen die spätere Diskussion der praktischen Anwendung der Biografiearbeit aufbaut.
3. Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe §34 KJHG: Dieses Kapitel beschreibt die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe. Es klärt den Begriff der Jugendhilfe, erläutert die rechtlichen Grundlagen nach §34 SGB VIII und geht auf die vielfältigen Gründe für eine stationäre Aufnahme ein. Es liefert den Kontext, in dem die Biografiearbeit später angewendet wird und verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen die Kinder und Jugendlichen konfrontiert sind.
4. Biografiearbeit mit Kindern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es untersucht, für welche Kinder Biografiearbeit geeignet ist, und betont den Nutzen und die Wichtigkeit dieser Methode für fremdplatzierte Kinder. Es bietet detaillierte Hinweise zur Durchführung, inklusive Aspekte wie Umfang, Dauer, Einbindung in den Alltag und Anwendungskompetenzen. Besondere Aufmerksamkeit wird den zentralen Themen wie der Bedeutung der Eltern und dem Loyalitätskonflikt gewidmet. Schließlich werden kreative Methoden, insbesondere die Modifizierung der Genogrammarbeit im Kontext der stationären Jugendhilfe, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Biografiearbeit, Genogramm, stationäre Kinder- und Jugendhilfe, §34 SGB VIII, Trauma, Resilienz, Selbstreflexion, pädagogische Arbeit, Heimerziehung, Fremdplatzierung, Loyalitätskonflikt.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Biografiearbeit mit Kindern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Anwendung von Biografiearbeit, insbesondere unter Einbezug von Genogrammen, in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gemäß §34 SGB VIII. Sie beleuchtet die Bedeutung und den Nutzen dieser Methode für betroffene Kinder und Jugendliche und gibt praktische Hinweise zur Durchführung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung der Biografiearbeit für die Entwicklung von Kindern in der stationären Jugendhilfe, methodische Ansätze der Biografiearbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen, die Rolle des Genogramms als Werkzeug, Herausforderungen und Chancen der Biografiearbeit im institutionellen Kontext sowie praktische Implikationen für die pädagogische Arbeit. Es werden außerdem grundlegende Begriffe wie Biografie, Biografiearbeit und Genogrammarbeit geklärt und die rechtlichen Grundlagen der stationären Jugendhilfe nach §34 SGB VIII erläutert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffserklärung und Grundlagen, Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe §34 KJHG, Biografiearbeit mit Kindern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe und Fazit und Schlussgedanken. Kapitel 4 beschreibt detailliert die Durchführung der Biografiearbeit, inklusive Umfang, Dauer, Einbindung in den Alltag, Anwendungskompetenzen und zentrale Themen wie die Bedeutung der Eltern und Loyalitätskonflikte.
Welche Methoden der Biografiearbeit werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Anwendung von Genogrammen in der Biografiearbeit und geht auf kreative Methoden und deren Modifizierung im Kontext der stationären Jugendhilfe ein. Die Bedeutung biografischer Selbstreflexion und des autobiografischen Gedächtnisses wird ebenfalls erläutert.
Für wen ist Biografiearbeit im Kontext der stationären Jugendhilfe geeignet?
Die Arbeit untersucht, für welche Kinder und Jugendlichen Biografiearbeit besonders geeignet ist, mit einem Fokus auf Kinder in stationärer Erziehungshilfe. Der Nutzen und die Wichtigkeit für fremdplatzierte Kinder werden hervorgehoben.
Welche Herausforderungen und Chancen werden im Zusammenhang mit Biografiearbeit in der stationären Jugendhilfe diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Biografiearbeit im institutionellen Kontext und geht auf die praktischen Implikationen für die pädagogische Arbeit ein.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Biografiearbeit, Genogramm, stationäre Kinder- und Jugendhilfe, §34 SGB VIII, Trauma, Resilienz, Selbstreflexion, pädagogische Arbeit, Heimerziehung, Fremdplatzierung, Loyalitätskonflikt.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bieten eine Zusammenfassung. Für detaillierte Informationen konsultieren Sie bitte die vollständige Bachelorarbeit.
- Arbeit zitieren
- Jessica Häfner (Autor:in), 2014, Biografiearbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe §34 SGBVIII anhand von Genogrammarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284228