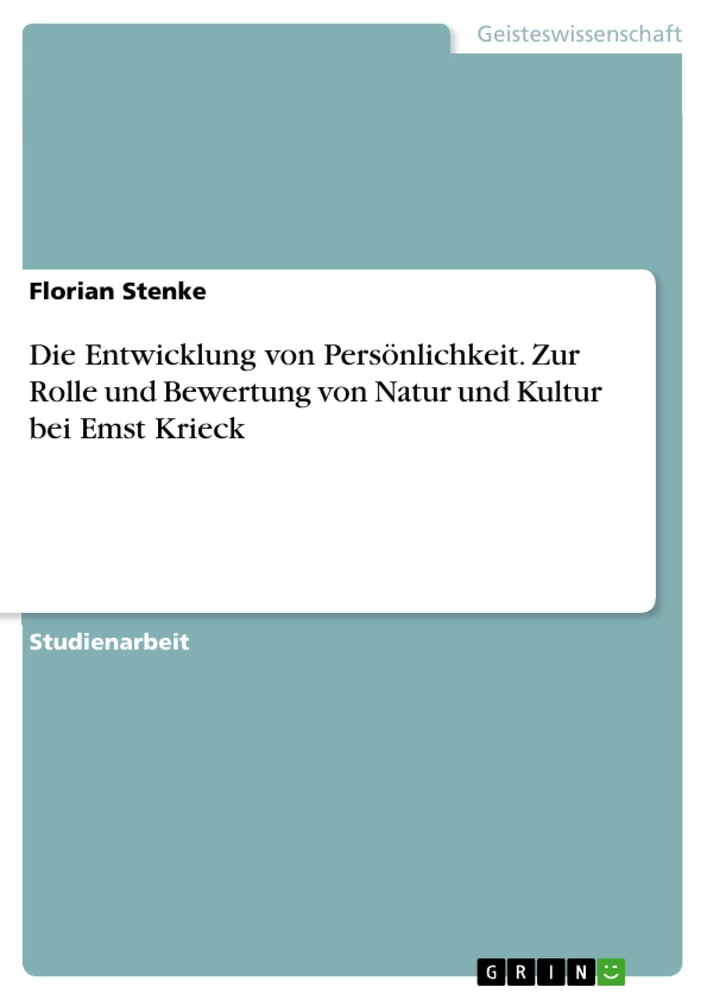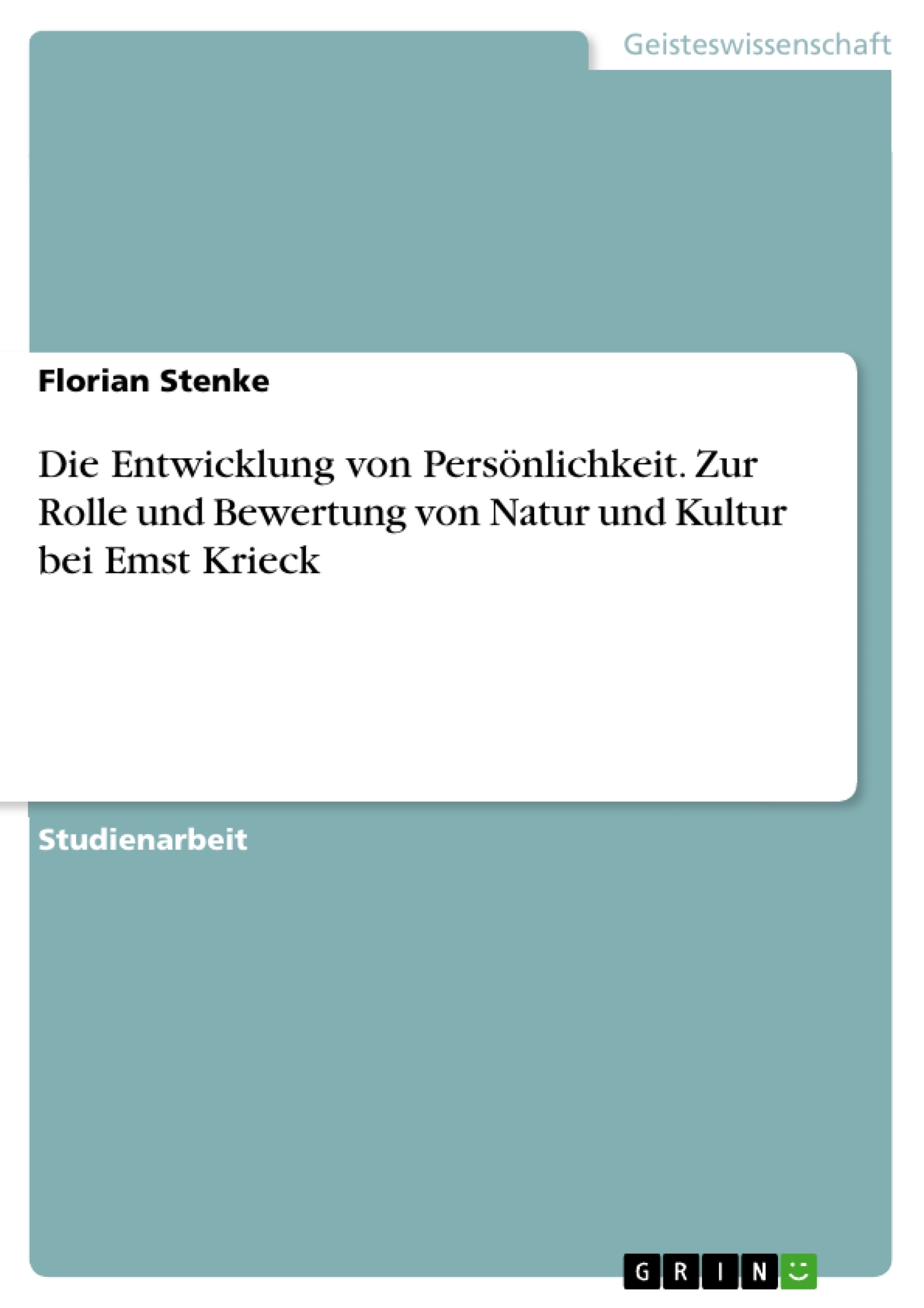Wenn diese Arbeit Natur und Kultur bei Ernst Krieck darstellen möchte, so ist zunächst unklar, was die Begriffe Natur und Kultur in diesem Zusammenhang überhaupt bedeuten. Denn eine allgemeingültige Definition dieser Begriffe gibt es nicht. Sie sollen deshalb hier so aufgefasst werden, wie es der ‚Erziehungsphilosoph‘ Ernst Krieck selbst getan hat. Eigentlich könnten die Begriffe Natur und Kultur aus einer Kulturphilosophie heraus definiert werden und diese Definition auf das Werk Kriecks angewendet werden, doch Krieck wurde zu Recht von seinen Zeitgenossen und der Nachwelt hauptsächlich als Erziehungsphilosoph bezeichnet. Zwar lässt schon eines seiner ersten Werke, 'Persönlichkeit und Kultur. Kritische Grundlegung der Kulturphilosophie', anderes vermuten, doch beschäftigte sich Krieck inhaltlich über sein ganzes Lebenswerk hinweg vielmehr mit der tiefergehenden Frage, wie auf der Grundlage von Erziehung Kultur für die nächste Generation reproduziert wird und mit dem daraus abgeleiteten Problem, wie eine geschichtliche Entwicklung von Kultur möglich wird.
Darin enthalten ist also der Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit: Welche Anteile an der Persönlichkeit entspringen natürlichen, individuellen Anlagen und welche übernimmt das Individuum mittels Erziehung aus der ihn umgebenden Kultur heraus? Bei dieser Fragestellung wird man bei Ernst Krieck allerdings mit einer weiteren Besonderheit konfrontiert, wie diese Arbeit zeigen wird. Denn die Zuordnung Kriecks zum Bereich der Erziehungsphilosophie bzw. Erziehungswissenschaft ist nach heutigen Maßstäben unvollständig. Krieck definiert Erziehung nämlich als „teils funktional, d. h. unbewußt und unabsichtlich, teils nach bewußter Ordnung und planmäßiger Methode“. Damit ist Kriecks Lebenswerk eher als eine um bewusste Erziehung erweiterte Theorie des Sozialisationsprozesses zu verstehen, was gerade in seinem Hauptwerk 'Philosophie der Erziehung' deutlich wird. Anhand der Darstellung dieses Sozialisationsprozesses möchte diese Arbeit versuchen festzustellen, ob Krieck seine Sozialisationstheorie aus der Sicht des Individualismus oder des Holismus aufgestellt hat, ob er den individuellen Naturanlagen oder der kulturellen Umwelt einen Vorrang bei der Persönlichkeitswerdung zugesprochen hat.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1 Forschungsgegenstand
- I.2. Auswahl der herangezogenen Quellen
- II. Hauptteil
- II.1 Persönlichkeit und Kultur (1910)
- II.2 Die deutsche Staatsidee (1917)
- II.3 Erziehung und Entwicklung (1921) und Philosophie der Erziehung (1922)
- II.4 Deutsche Kulturpolitik? (1928)
- II.5 Nationalsozialistische Erziehung (1935)
- III. Schluss
- IV. Quellen- und Literaturverzeichnis
- IV.1. Quellenverzeichnis
- IV.2. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Werk des Erziehungsphilosophen Ernst Krieck und untersucht, wie er Natur und Kultur in seinem Werk definiert und wie er den Prozess der Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung in Bezug auf diese beiden Konzepte versteht. Die Arbeit analysiert Kriecks Schriften, um zu erforschen, welchen Stellenwert er den individuellen Anlagen und der kulturellen Umwelt bei der Persönlichkeitsbildung zuschreibt.
- Die Definition von Natur und Kultur bei Ernst Krieck
- Die Rolle der Erziehung im Sozialisationsprozess
- Der Einfluss der kulturellen Umwelt auf die Persönlichkeitsentwicklung
- Die Bedeutung des Allgemeinen und der Norm für die Gesellschaft
- Die Entwicklung von Kriecks Sozialisationstheorie im Kontext verschiedener politischer Systeme
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit analysiert Kriecks Werk "Persönlichkeit und Kultur" aus dem Jahr 1910. Hier legt Krieck die Grundlage für seine spätere Sozialisationstheorie und definiert Kultur als "Erziehung ihrer Angehörigen zur Freiheit und Selbstheit". Er argumentiert, dass die Vernunft ein Vermittlungsprinzip zwischen Individuen ist, das ein gemeinsames Verständnis der Welt schafft. Das Allgemeine, das durch diesen Prozess entsteht, wird zum ethischen Maßstab der Gesellschaft. Krieck stellt fest, dass die meisten Individuen das Allgemeine passiv übernehmen, während eine "schöpferische Persönlichkeit" es durch Abweichung von der Norm umformen kann.
In "Die deutsche Staatsidee" von 1917 präzisiert Krieck seine Überlegungen und stellt die Bedeutung der Kultur für die nationale Identität heraus. Er betont die Notwendigkeit einer starken Staatsführung, die die kulturelle Entwicklung der Nation lenkt. In "Erziehung und Entwicklung" (1921) und "Philosophie der Erziehung" (1922) entwickelt Krieck seine pädagogisch-soziologische Theorie weiter. Er definiert Erziehung als einen bewussten und unbewussten Prozess der Sozialisation, der die Persönlichkeitsentwicklung des Individuums prägt.
In "Deutsche Kulturpolitik?" (1928) setzt sich Krieck mit dem "deutschen Schulkampf" auseinander und plädiert für eine national ausgerichtete Bildungspolitik. Schließlich passt er seine Theorie in "Nationalsozialistische Erziehung" (1935) an die Ideologie des Nationalsozialismus an. Er betont die Bedeutung der Erziehung für die Schaffung eines "neuen Menschen", der die Ideale des Nationalsozialismus verkörpert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Begriffe Natur, Kultur, Erziehung, Sozialisation, Persönlichkeit, Allgemeines, Norm, Individualismus, Holismus, Ernst Krieck, deutsche Staatsidee, nationalsozialistische Erziehung, Kulturphilosophie, Erziehungsphilosophie, Sozialisationstheorie.
Häufig gestellte Fragen
Wie definierte Ernst Krieck die Begriffe Natur und Kultur?
Krieck sah Kultur als die Erziehung der Angehörigen zur Freiheit und Selbstheit, während Natur die individuellen, angeborenen Anlagen des Menschen bezeichnet.
Welche Rolle spielt die Erziehung im Sozialisationsprozess nach Krieck?
Erziehung ist bei Krieck teils funktional (unbewusst) und teils planmäßig. Sie dient dazu, die Kultur der nächsten Generation zu reproduzieren und die Persönlichkeit zu formen.
Was ist eine 'schöpferische Persönlichkeit' laut Kriecks Frühwerk?
Es ist ein Individuum, das sich vom passiven Übernehmen gesellschaftlicher Normen abhebt und durch Abweichung das 'Allgemeine' der Kultur aktiv umformen kann.
Wie wandelte sich Kriecks Theorie im Nationalsozialismus?
In seinen späteren Schriften (ab 1935) passte er seine Sozialisationstheorie an die NS-Ideologie an und betonte die Erziehung zum 'neuen Menschen' im Sinne des Regimes.
Vertrat Krieck eher den Individualismus oder den Holismus?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und analysiert, ob Krieck den individuellen Naturanlagen oder der kulturellen Umwelt (dem Ganzen) Vorrang einräumte.
Was versteht Krieck unter dem 'deutschen Schulkampf'?
In seinem Werk von 1928 setzt er sich mit bildungspolitischen Auseinandersetzungen auseinander und plädiert für eine stark national ausgerichtete Kulturpolitik.
- Citar trabajo
- Florian Stenke (Autor), 2013, Die Entwicklung von Persönlichkeit. Zur Rolle und Bewertung von Natur und Kultur bei Emst Krieck, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284346