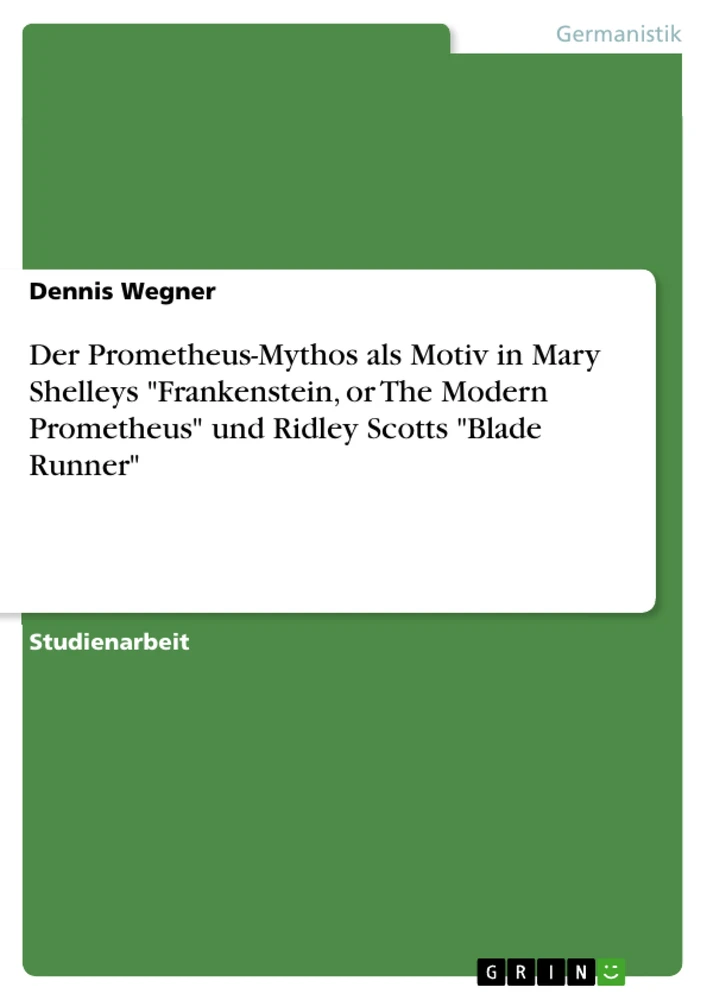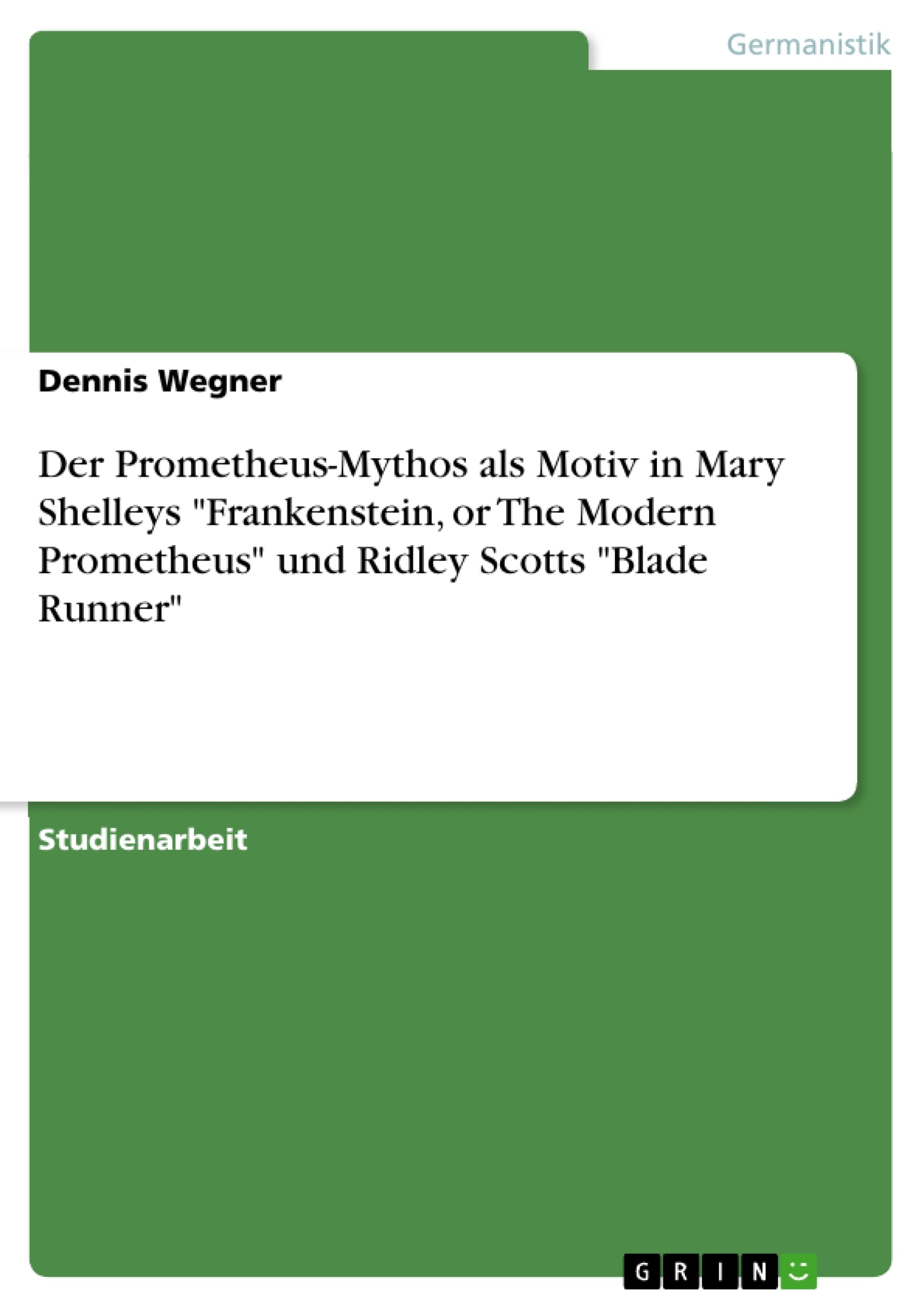Ridley Scotts BLADE RUNNER (USA 1982) reiht sich in eine lange Tradition von Erzählungen ein, die die Kreation künstlichen Lebens thematisieren. Ein Diskurs, der nicht erst in jüngerer Zeit aufkam, denn artifizielle Menschen finden sich nicht nur im Science-Fiction-Kino der Gegenwart, sondern bereits in den Epen der Antike.
So erzählt der römische Dichter Ovid in seinen Metamorphosen von Pygmalion, der eine Frau aus Elfenbein schnitzt, die von der Göttin Venus zum Leben erweckt wird . Der jüdischen Tradition entstammt der Golem, „eine ungestalte, unfertige Lehmfigur, die durch Wortmagie zu einem künstlichen, menschenähnlichen Geschöpf belebt wird“. Die Legende des Golems wurde 1920 von Paul Wegener unter dem Titel DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM filmisch umgesetzt . Besonders um 1800, in der Romantik, finden „Androiden der verschiedensten Art - und mit ganz verschiedenen Funktionen“ Eingang in die Literatur. Dazu gehören E.T.A. Hoffmanns Olimpia in "Der Sandmann" oder auch Jean Pauls hölzerne Ehefrau in Auswahl aus "des Teufels Papieren". Zu den prominentesten Vertretern des frühen Films zählen neben Wegeners „Golem“ Fritz Langs "METROPOLIS" (Deutschland 1926) und "FRANKENSTEIN" (USA 1931) von James Whale .
Eine zentrale Figur, die mit vielen der genannten Beispiele in Verbindung gebracht werden kann, entspringt der griechischen und römischen Mythologie: Prometheus. So trägt Mary Shelleys Roman Frankenstein (1818), Vorlage der gleichnamigen Filmadaption und häufiger Gegenstand der Forschungsliteratur auf diesem Gebiet, den Untertitel Der moderne Prometheus. In dieser Hausarbeit soll daher näher auf den Prometheus-Mythos eingegangen werden. Auf dieser Grundlage findet eine Analyse des Films BLADE RUNNER und des Romans Frankenstein statt, die hinsichtlich der Prometheus-Sage verglichen werden sollen. Kann abschließend auf dieser Basis die Aussage getroffen werden, dass Prometheus als Motiv in Literatur und Film Verwendung findet?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Prometheus-Mythos in der Literaturgeschichte
- 3 Schöpfer und Geschöpf in Frankenstein und BLADE RUNNER
- 3.1 Charakteristika der Prometheus-Figuren
- 3.1.1 Das Scheitern des Schöpfergenies in Frankenstein
- 3.1.2 Der Vatermord in BLADE RUNNER
- 3.2 „More human than human“. Menschlichkeit der künstlichen Geschöpfe
- 3.2.1 Einsamkeit und Bildung der Kreatur in Frankenstein
- 3.2.2 Erinnerungen und Sterblichkeit der Replikanten in BLADE RUNNER
- 3.3 Verhältnis von Schöpfer und Kreatur
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Prometheus-Mythos als Motiv in Literatur und Film, insbesondere in Mary Shelleys Frankenstein und Ridley Scotts Blade Runner. Ziel ist es, die Parallelen zwischen dem Mythos und den beiden Werken herauszuarbeiten und die Bedeutung des Themas der künstlichen Lebenserzeugung zu beleuchten.
- Der Prometheus-Mythos und seine Interpretationen in der Literaturgeschichte
- Das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf in Frankenstein und Blade Runner
- Die Frage nach der Menschlichkeit künstlicher Wesen
- Die Rolle der Rebellion und der Strafe im Kontext des Mythos
- Der Vergleich der Darstellung des Themas in Literatur und Film
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der künstlichen Lebenserzeugung in Literatur und Film ein und nennt verschiedene Beispiele aus der Antike und der Romantik, wie Pygmalion, den Golem und Figuren aus den Werken von E.T.A. Hoffmann und Jean Paul. Sie stellt den Prometheus-Mythos als zentrales Motiv heraus und kündigt die Analyse von Frankenstein und Blade Runner an, um die Verwendung des Prometheus-Motivs in Literatur und Film zu untersuchen.
2 Prometheus-Mythos in der Literaturgeschichte: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Prometheus-Mythos in der Literaturgeschichte, beginnend mit Hesiods Theogonie und Aischylos' Der gefesselte Prometheus. Es werden verschiedene Interpretationen des Mythos beleuchtet, von der Erklärung des weltlichen Übels über die Betonung der Menschenfreundlichkeit des Prometheus bis hin zu seiner Rolle als Schöpfer und Rebell. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz der Figur und der damit verbundenen Frage nach der menschlichen Identität und Autonomie.
3 Schöpfer und Geschöpf in Frankenstein und BLADE RUNNER: Dieses Kapitel analysiert die Parallelen zwischen dem Prometheus-Mythos und den Werken Frankenstein und Blade Runner. Es untersucht die Charakteristika der Prometheus-Figuren (Victor Frankenstein und Tyrell) und deren künstliche Geschöpfe (die Kreatur und die Replikanten), fokussiert auf die Themen des Scheiterns, der Einsamkeit, der Suche nach Identität und dem Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf. Die Kapitel untersuchen wie die jeweiligen Werke die zentralen Fragen des Mythos aufgreifen und neu interpretieren.
Schlüsselwörter
Prometheus-Mythos, Frankenstein, Blade Runner, künstliches Leben, Schöpfer und Geschöpf, Menschlichkeit, Identität, Rebellion, Strafe, Science-Fiction, Literaturvergleich, Filmvergleich.
Häufig gestellte Fragen zu: Prometheus-Mythos in Frankenstein und Blade Runner
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Prometheus-Mythos als Motiv in Literatur und Film, speziell in Mary Shelleys Frankenstein und Ridley Scotts Blade Runner. Sie analysiert die Parallelen zwischen dem Mythos und den beiden Werken und beleuchtet die Bedeutung der künstlichen Lebenserzeugung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Prometheus-Mythos und seine Interpretationen in der Literaturgeschichte, das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf in Frankenstein und Blade Runner, die Frage nach der Menschlichkeit künstlicher Wesen, die Rolle von Rebellion und Strafe im Kontext des Mythos und einen Vergleich der Darstellung des Themas in Literatur und Film.
Welche Werke werden analysiert?
Die Hauptaugenmerk liegt auf Mary Shelleys Frankenstein und Ridley Scotts Blade Runner. Zusätzlich wird der Prometheus-Mythos in seiner literarischen Entwicklung, beginnend mit Hesiod und Aischylos, betrachtet. Weitere Erwähnungen finden auch Pygmalion, der Golem und Werke von E.T.A. Hoffmann und Jean Paul.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Prometheus-Mythos in der Literaturgeschichte, ein Kapitel zur Analyse von Frankenstein und Blade Runner (mit Unterkapiteln zu den Charakteristika der Prometheus-Figuren, der Menschlichkeit der künstlichen Geschöpfe und dem Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf) und ein Fazit.
Welche Aspekte des Prometheus-Mythos werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Interpretationen des Prometheus-Mythos, von der Erklärung des weltlichen Übels über die Betonung der Menschenfreundlichkeit bis hin zu seiner Rolle als Schöpfer und Rebell. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz der Figur und der Frage nach menschlicher Identität und Autonomie.
Was sind die zentralen Fragen der Analyse?
Zentrale Fragen sind die Parallelen zwischen dem Mythos und den beiden literarischen/filmischen Werken, die Charakteristika der Schöpferfiguren (Victor Frankenstein und Tyrell) und ihrer Geschöpfe (die Kreatur und die Replikanten), das Scheitern der Schöpfer, die Einsamkeit und Identitätssuche der künstlichen Wesen und das komplexe Verhältnis zwischen Schöpfer und Geschöpf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prometheus-Mythos, Frankenstein, Blade Runner, künstliches Leben, Schöpfer und Geschöpf, Menschlichkeit, Identität, Rebellion, Strafe, Science-Fiction, Literaturvergleich, Filmvergleich.
- Citation du texte
- Dennis Wegner (Auteur), 2014, Der Prometheus-Mythos als Motiv in Mary Shelleys "Frankenstein, or The Modern Prometheus" und Ridley Scotts "Blade Runner", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284381