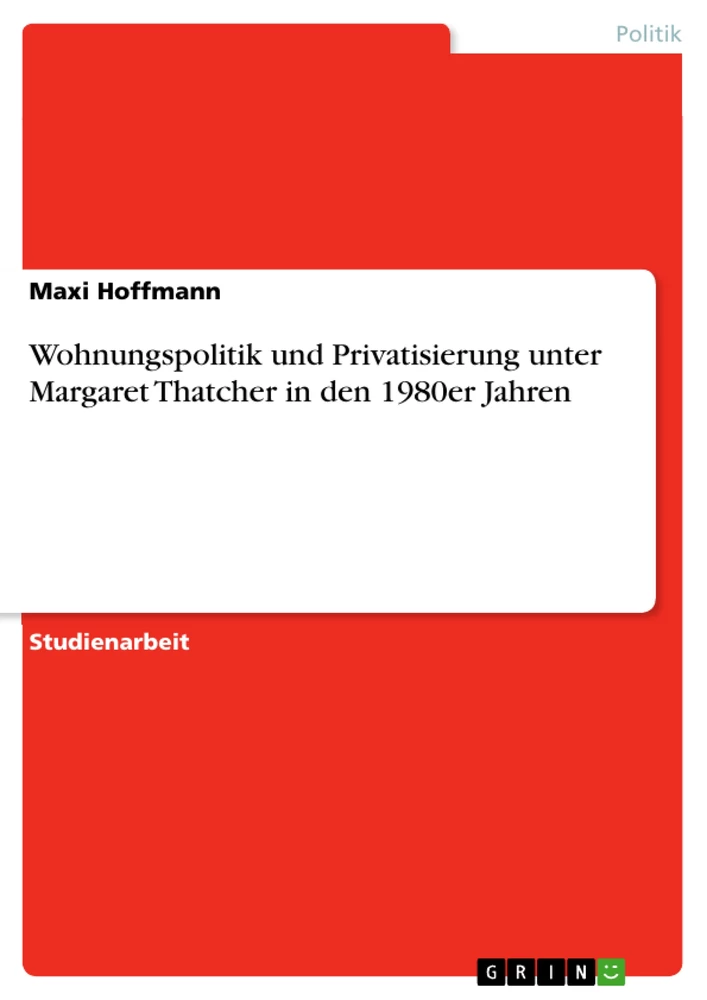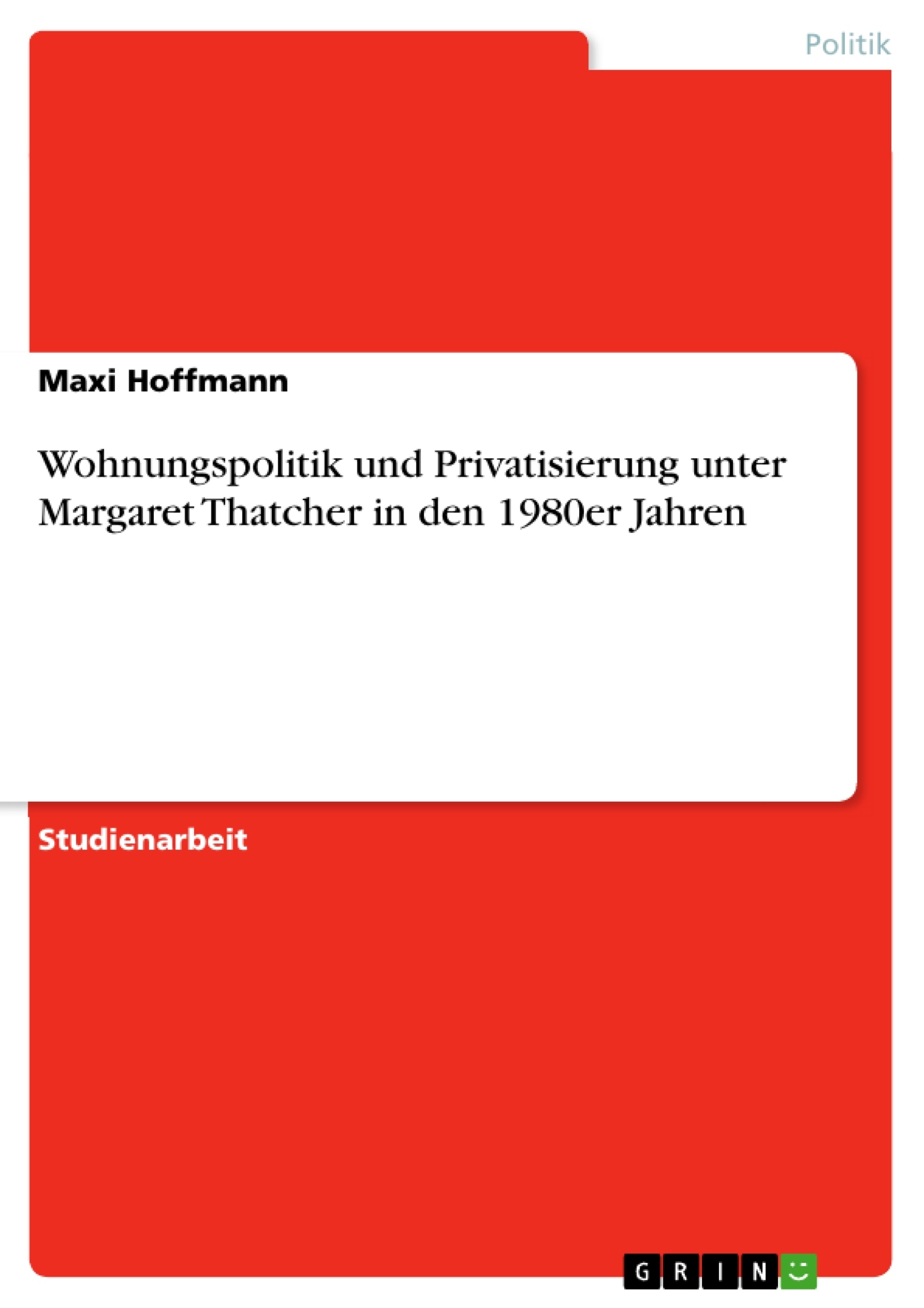Ziel dieser Hausarbeit soll es sein, anhand des Verkaufs von Sozialwohnungen die Rolle der Wohnungspolitik in Margaret Thatchers Privatisierungsmaßnahmen der 1980er Jahre zu untersuchen. Es soll geprüft werden, inwieweit soziale, wirtschaftliche und parteipolitische Zielsetzungen hier ineinander übergehen und welche Grundgedanken für die Umsetzung der Privatisierung kommunalen Wohneigentums ausschlaggebend waren.
Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung des council housing als ein Element des britischen Wohlfahrtsstaates und dem Ursprung neoliberaler Leitgedanken, die eine spätere Privatisierung des staatlichen Wohnungssektors begünstigten. Der zweite Teil geht auf die Bedeutung der Wohnungspolitik für die Conservative Party zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und identitätsstiftenden Ideologien ein. Schließlich beleuchtet der dritte Teil am konkreten Beispiel des Housing Act von 1980 die Umsetzung des Verkaufs öffentlichen Wohneigentums und analysiert dessen soziale Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Das Thema dieser Arbeit erfordert eine klare Eingrenzung, insbesondere im Hinblick auf die Quellen. Exemplarisch für die Zielsetzungen der konservativen Wohnungspolitik in den 1980er Jahren stehen hier die schriftlich und mündlich verfassten Aussagen Margaret Thatchers auf der Pressekonferenz zu den landesweiten Wahlen vom 27.09.1974. Da diese Äußerungen aus der Zeit vor dem Beginn ihrer Regierung stammen, wird an ihnen eine frühe politische Programmatik deutlich. Weiterhin steht der Gesetzestext des Housing Acts von 1980 im Mittelpunkt, da er das Herzstück der Privatisierungspolitik im Bereich öffentlicher Wohnungen bildet und die wesentlichen Intentionen der Konservativen verdeutlicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wohnungspolitik und Privatisierung unter Margaret Thatcher in den 1980er Jahren
- Wohnungspolitik im Wohlfahrtsstaat
- Privatisierung und Wohnungspolitik
- Der Housing Act 1980 und der Verkauf von Sozialwohnungen
- Zusammenfassung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle der Wohnungspolitik in Margaret Thatchers Privatisierungsmaßnahmen der 1980er Jahre anhand des Verkaufs von Sozialwohnungen. Sie analysiert, inwieweit soziale, wirtschaftliche und parteipolitische Zielsetzungen ineinandergreifen und welche Grundgedanken die Privatisierung kommunalen Wohneigentums antrieben.
- Entstehung des council housing als Element des britischen Wohlfahrtsstaates
- Neoliberale Leitgedanken, die eine spätere Privatisierung des staatlichen Wohnungssektors begünstigten
- Bedeutung der Wohnungspolitik für die Conservative Party zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und identitätsstiftenden Ideologien
- Umsetzung des Verkaufs öffentlichen Wohneigentums am Beispiel des Housing Act von 1980
- Soziale Auswirkungen des Verkaufs von Sozialwohnungen auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit beleuchtet die Entstehung des council housing als ein Element des britischen Wohlfahrtsstaates. Er untersucht die Ursprünge neoliberaler Leitgedanken, die eine spätere Privatisierung des staatlichen Wohnungssektors begünstigten. Der zweite Teil geht auf die Bedeutung der Wohnungspolitik für die Conservative Party zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und identitätsstiftenden Ideologien ein. Er analysiert die Rolle der Wohnungspolitik in Thatchers Privatisierungspolitik und die damit verbundenen ideologischen und wirtschaftlichen Beweggründe. Der dritte Teil der Arbeit konzentriert sich auf den Housing Act von 1980, der das Herzstück der Privatisierungspolitik im Bereich öffentlicher Wohnungen bildet. Er analysiert die Umsetzung des Verkaufs öffentlichen Wohneigentums und dessen soziale Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Wohnungspolitik, die Privatisierung, den britischen Wohlfahrtsstaat, Margaret Thatcher, den Housing Act 1980, den Verkauf von Sozialwohnungen, soziale Auswirkungen, wirtschaftliche Notwendigkeit, ideologische Beweggründe, Conservative Party, neoliberale Leitgedanken und den council housing.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Wohnungspolitik unter Margaret Thatcher?
Das Ziel war die Privatisierung von öffentlichem Wohneigentum, um die Eigenverantwortung zu stärken, die Staatsausgaben zu senken und eine "Property-Owning Democracy" zu schaffen.
Was ist das "Council Housing" in Großbritannien?
Council Housing bezeichnet den sozialen Wohnungsbau in Großbritannien, der ein zentrales Element des britischen Wohlfahrtsstaates war, bevor die massiven Privatisierungen in den 1980er Jahren begannen.
Welche Bedeutung hatte der Housing Act von 1980?
Der Housing Act von 1980 war das gesetzliche Herzstück der Thatcherschen Reformen. Er führte das "Right to Buy" ein, das Mietern von Sozialwohnungen das Recht gab, ihre Wohnungen zu stark vergünstigten Preisen zu kaufen.
Welche Rolle spielten neoliberale Leitgedanken bei der Privatisierung?
Neoliberale Ideen betonten den freien Markt und die Reduzierung staatlicher Eingriffe. Die Privatisierung des Wohnungssektors sollte die individuelle Freiheit fördern und die Abhängigkeit vom Wohlfahrtsstaat verringern.
Was waren die sozialen Auswirkungen des Verkaufs von Sozialwohnungen?
Während viele Mieter zu Wohneigentümern wurden, führte der Verkauf auch zu einer Verknappung von günstigem Wohnraum für Bedürftige und zu einer sozialen Segregation in den Städten.
- Quote paper
- Maxi Hoffmann (Author), 2012, Wohnungspolitik und Privatisierung unter Margaret Thatcher in den 1980er Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284854