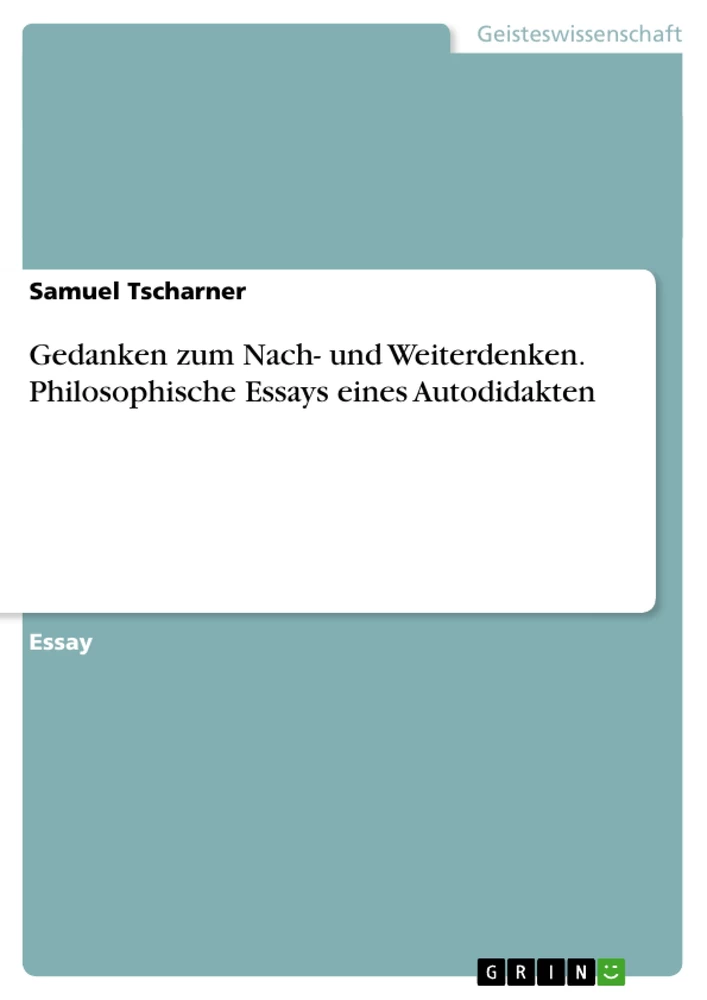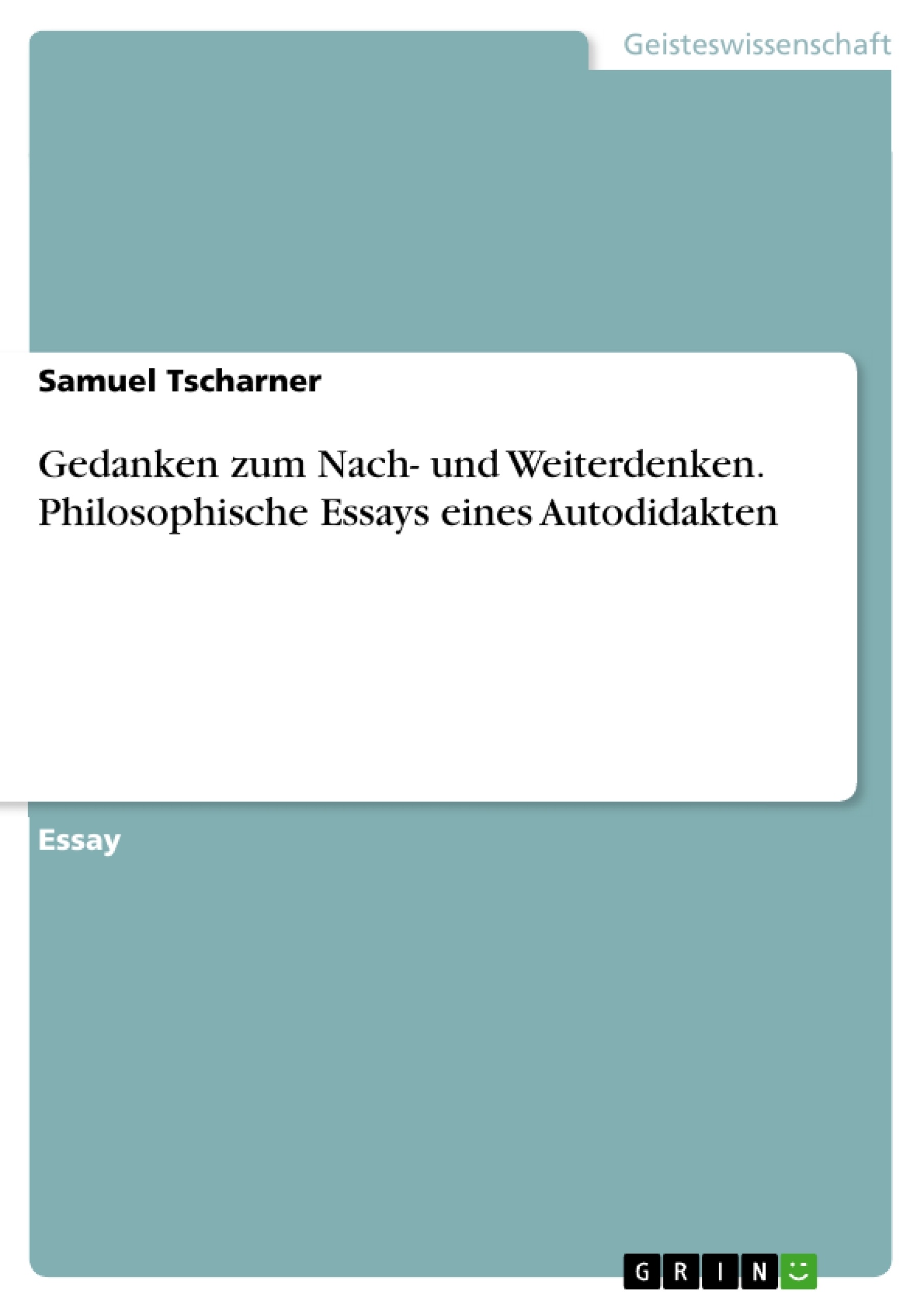Dieses Buch ist sowohl Aufforderung als auch Herausforderung. Wie der Titel bereits verrät, handelt es sich hierbei um keinen zusammenhängenden Text, der ein bestimmtes Thema mit all seinen Facetten bis zur Gänze durchleuchten, ausleuchten und beleuchten soll, sondern um mehrere Essays mit verschiedenen, zunächst vollkommen unabhängigen Themen. Eines haben jedoch alle Texte gemeinsam: Sie beinhalten Philosophie.
Einerseits soll den wahrhaft interessierten Laien ein unmittelbarer Einstieg in die Philosophie ohne langweilige und langwierige Theorie angeboten werden, andererseits soll den studierten Philosophen in der Methode des kritischen und bedächtigen Vorgehens entsprochen werden, ohne deshalb riesige Luftschlösser zu konstruieren oder übertriebene Wortakrobatik zu betreiben.
Letztlich soll dieses Buch sowohl für den Amateur als auch für den Akademiker lediglich eine Inspiration sein. Die Gedankengänge sollen überprüft, auseinandergenommen, korrigiert, zitiert, weitergezogen werden. Da es sich stets um relativ kurze Denkschriften handelt, liegt es mir fern, einen Anspruch auf Vollkommenheit zu reklamieren. Wie es der Titel des Buches offenbart, lade ich alle Leser dazu ein, die dargebotenen Ideen, Theorien und Definitionen zu hinterfragen, sie nachzudenken, über sie nachzudenken und sie bei Interesse sogar weiterzudenken. Auf jeden Fall muss mitgedacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Philosophie - Die Kunst des Denkens
- Gedanken zu Bildung und Ausbildung
- Über Abtreibung
- Der Mensch und sein Körper
- Erster Text über Wahrheit: Nihilismus, Erkenntnisoptimismus und Ignoranz
- Zweiter Text über Wahrheit: Zum Diskurs über Wahrheit und Wissen
- Auseinandersetzung mit dem Existenzialismus
- Umgangssprachlicher Idealismus
- Quellen und weiterführende Medien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch ist eine Sammlung von Essays, die sich mit verschiedenen philosophischen Themen auseinandersetzen. Es richtet sich sowohl an Laien als auch an Akademiker und möchte einen Zugang zur Philosophie ermöglichen, der sowohl zugänglich als auch anspruchsvoll ist. Die Essays sind nach zunehmender Komplexität der Thematik und Akkuratesse der Untersuchung geordnet, um den Einstieg für Neulinge zu erleichtern.
- Philosophie als Kunst des Denkens
- Kritik an überzogenen Weltbildern und Verschwörungstheorien
- Die Suche nach Wahrheit und Selbstwiderlegung
- Die Rolle der Philosophie in der Gesellschaft
- Die Bedeutung des kritischen Denkens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Der Autor stellt das Buch vor und erläutert seine Intentionen. Er kritisiert sowohl die oberflächliche Auslegung der Philosophie als auch die elitäre und abgehobene Art der akademischen Philosophie. Er strebt einen Mittelweg an, der sowohl für Laien als auch für Akademiker zugänglich ist.
- Philosophie - Die Kunst des Denkens: In diesem Kapitel wird die Philosophie als eine Art des Denkens definiert, die sich durch kritisches Hinterfragen und die Suche nach Wahrheit auszeichnet. Der Autor betont die Bedeutung des kritischen Rationalismus und die Notwendigkeit, eigene Annahmen und Vorurteile zu hinterfragen.
- Gedanken zu Bildung und Ausbildung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle der Bildung und Ausbildung in der Gesellschaft. Der Autor kritisiert die starre und unflexible Struktur des Bildungssystems und plädiert für eine Bildung, die kritisches Denken und Selbstständigkeit fördert.
- Über Abtreibung: In diesem Kapitel wird die Abtreibungsdebatte aus philosophischer Sicht beleuchtet. Der Autor argumentiert, dass die Entscheidung über eine Abtreibung eine höchst persönliche und moralische Frage ist, die nicht von staatlicher Seite diktiert werden sollte.
- Der Mensch und sein Körper: Dieses Kapitel befasst sich mit der Beziehung des Menschen zu seinem Körper. Der Autor beleuchtet die verschiedenen Aspekte dieser Beziehung, wie z.B. die körperliche Selbstwahrnehmung, die Bedeutung des Körpers für die Identität und die Frage nach der Kontrolle über den eigenen Körper.
- Erster Text über Wahrheit: Nihilismus, Erkenntnisoptimismus und Ignoranz: In diesem Kapitel wird die Frage nach der Wahrheit aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Der Autor diskutiert den Nihilismus, den Erkenntnisoptimismus und die Rolle der Ignoranz in der Suche nach Wahrheit.
- Zweiter Text über Wahrheit: Zum Diskurs über Wahrheit und Wissen: Dieses Kapitel setzt sich mit dem Diskurs über Wahrheit und Wissen auseinander. Der Autor analysiert die verschiedenen Formen des Wissens und die Herausforderungen, die sich aus der Suche nach objektiver Wahrheit ergeben.
- Auseinandersetzung mit dem Existenzialismus: In diesem Kapitel wird der Existenzialismus als philosophische Strömung vorgestellt. Der Autor beleuchtet die zentralen Thesen des Existenzialismus und diskutiert deren Relevanz für das menschliche Leben.
- Umgangssprachlicher Idealismus: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Idealismus als philosophischer Strömung. Der Autor präsentiert eine eigene Interpretation des Idealismus, die er als „umgangssprachlichen Idealismus“ bezeichnet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Philosophie, kritisches Denken, Wahrheit, Bildung, Abtreibung, Körper, Nihilismus, Erkenntnisoptimismus, Ignoranz, Existenzialismus, Idealismus, Selbstwiderlegung, Mittelweg, Laien, Akademiker, und die Suche nach Wahrheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel des Buches „Gedanken zum Nach- und Weiterdenken“?
Das Buch soll sowohl für Laien als auch für Akademiker eine Inspiration sein, philosophische Gedankengänge zu überprüfen, zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
Welche Themen werden in den Essays behandelt?
Die Essays decken vielfältige Themen ab, darunter Bildung, Abtreibung, das Verhältnis zum eigenen Körper, Wahrheit, Existenzialismus und Idealismus.
Wie definiert der Autor die Philosophie?
Philosophie wird als die „Kunst des Denkens“ definiert, die sich durch kritisches Hinterfragen und die Suche nach Wahrheit auszeichnet.
An wen richtet sich dieses Werk?
Es richtet sich an interessierte Laien, die einen Einstieg suchen, sowie an studierte Philosophen, die Wert auf methodische Genauigkeit legen.
Was kritisiert der Autor an der akademischen Philosophie?
Er kritisiert eine elitäre und abgehobene Art der akademischen Philosophie und strebt stattdessen einen zugänglichen Mittelweg an.
Was versteht man unter „umgangssprachlichem Idealismus“?
Dies ist eine eigene Interpretation des Idealismus durch den Autor, die in einem der abschließenden Kapitel des Buches erläutert wird.
- Citation du texte
- Samuel Tscharner (Auteur), 2014, Gedanken zum Nach- und Weiterdenken. Philosophische Essays eines Autodidakten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284890