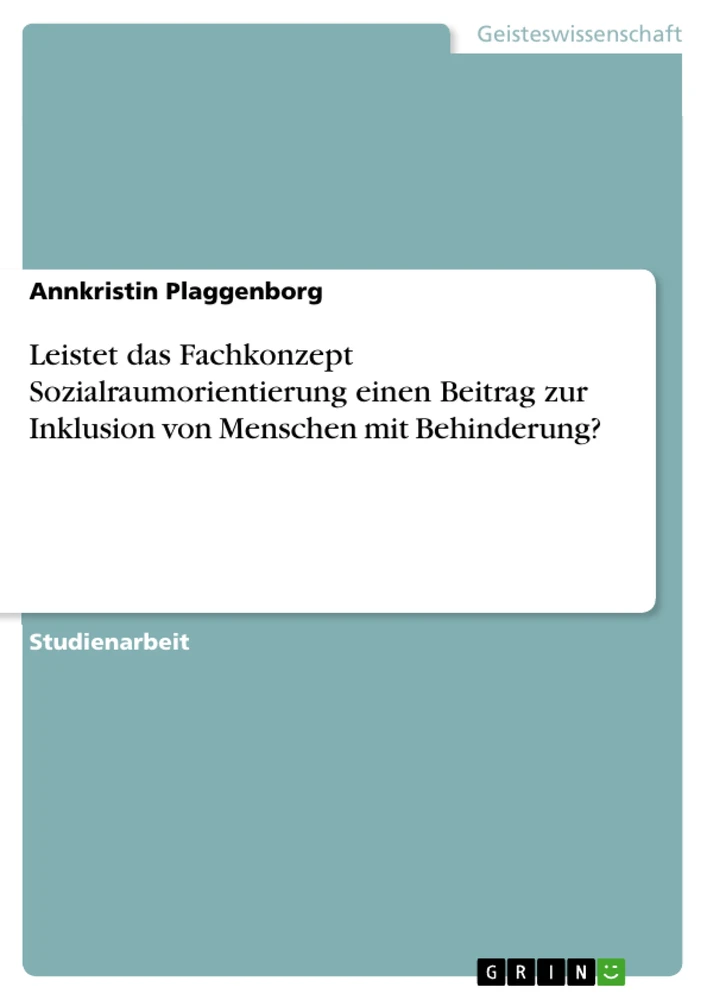Steuert die Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe zum Erfolg von Inklusion bei?
Inklusion steht unter anderem für die gleichberechtigte Partizipation aller Menschen unter strikter Berücksichtigung ihrer Autonomie und unter Anerkennung der Vielfalt des menschlichen Seins, sodass auf Basis gemeinsamer Interessen ein Austausch auch mit nichtbehinderten Bürgern stattfinden kann. Um diesen Sachverhalt näher zu erläutern, wird in einem ersten Schritt auf das Thema ‚Inklusion‘ eingegangen: was sind zentrale Zielstellungen, was wird gefordert, wo liegen Grenzen? Und was unterscheidet sie von Integration? Auf diese Weise bekommt die Leserin nicht nur einen ersten Eindruck der Thematik, mit Blick auf die Fragestellung kann auf diese Weise außerdem klar zwischen den Kapiteln verglichen werden, um im Anschluss ein adäquates Fazit ziehen zu können. Der Übersicht halber wird zudem im Folgenden unter Inklusion hauptsächlich die Integration von Menschen mit Behinderung verstanden.
Inklusion ist seit Rechtsgültigkeit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen am 01.01.2009 Menschenrecht in Deutschland. Die UN-Konvention konkretisiert die Ziele nach Selbstbestimmung und Teilhabe und fordert in diesem Zuge mehr Partizipation und Inklusion in der Gesellschaft.
Auch die Sozialraumorientierung trat zu diesem Zeitpunkt und in Bezug zu den Zielformulierungen der Konvention immer häufiger in der Behindertenhilfe in Erscheinung. Was die Thematik aktuell und interessant macht, ist nicht nur die Neuentdeckung in der behindertenpolitischen Diskussion, sondern auch die Kontroversen, die mit einer sozialräumlichen Orientierung einhergehen. Während die einen von einem kommunalen Sparvorhaben sprechen, sehen die anderen darin eine Innovation, die die Kraft hat Bürgerinnen und Bürger zu aktivieren, das Selbsthilfepotential zu stärken und auf diese Weise sogar dafür zu sorgen, dass immer weniger Menschen zum „Fall“ werden.
Um auf die gesamte Breite dieses Ansatzes eingehen zu können, wird in einem nächsten Schritt das Fachkonzept Sozialraumorientierung vorgestellt. Neben den zentralen Prinzipien und den Ebenen, wird an manchen Stellen ebenfalls auf die oben angesprochenen Kritikpunkte eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inklusion
- Das Vorhaben ,,Inklusion“ und seine Forderungen
- Macht Inklusion Integration überflüssig?
- Ein Paradigmenwechsel in der Sozialen Arbeit
- Von der Gemeinwesenarbeit, Stadtteilarbeit und Sozialraumorientierung
- Das Fachkonzept Sozialraumorientierung
- Orientierung an Interessen und am Willen
- Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe
- Konzentration auf die Ressourcen der Menschen und des Sozialraums
- Sozialräumliche Arbeit ist zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt
- Kooperation und Koordination
- Ebenen der Sozialraumorientierung – „Ein Modell zwischen Lebenswelt und Steuerung”
- Fallspezifisches Arbeiten
- Fallübergreifendes Arbeiten
- Fallunspezifisches Arbeiten
- Flexible Organisationen
- Raumbezogene Steuerung
- Der Sozialraum
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht, ob das Fachkonzept Sozialraumorientierung einen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit Behinderung leisten kann. Sie analysiert die zentralen Elemente der Sozialraumorientierung im Kontext der Inklusionsdebatte, insbesondere in Bezug auf die gleichberechtigte Partizipation und die Stärkung von Selbsthilfe und Eigeninitiative. Die Arbeit beleuchtet außerdem die Potenziale und Herausforderungen des Sozialraumansatzes für die Behindertenhilfe.
- Inklusion als Menschenrecht und die Forderungen nach Selbstbestimmung und Teilhabe
- Die Sozialraumorientierung als Konzept für eine inklusive Sozialarbeit
- Die zentralen Prinzipien und Ebenen der Sozialraumorientierung
- Die Rolle von Kooperation und Koordination im Sozialraumansatz
- Potenziale und Grenzen der Sozialraumorientierung für die Inklusion von Menschen mit Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung nach der Rolle der Sozialraumorientierung bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung vor. Sie erläutert die Bedeutung der Inklusionsdebatte und stellt die Relevanz des Sozialraumkonzepts in diesem Zusammenhang dar.
- Inklusion: Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept der Inklusion und seine zentralen Forderungen. Es diskutiert die Bedeutung von Selbstbestimmung, Teilhabe und gleichberechtigter Partizipation aller Menschen. Das Kapitel beleuchtet die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion und stellt die Relevanz der UN-Behindertenrechtskonvention für die Inklusionsbestrebungen dar.
- Ein Paradigmenwechsel in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Sozialraumorientierung. Es zeichnet die Entwicklung des Sozialraumansatzes nach und erläutert seine zentralen Prinzipien. Die Kapitel behandelt die Ebenen der Sozialraumorientierung und beleuchtet die Rolle von Kooperation und Koordination im Sozialraumansatz. Es werden außerdem Kritikpunkte und Herausforderungen in Bezug auf die Umsetzung der Sozialraumorientierung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Inklusion, Sozialraumorientierung, Behinderung, Partizipation, Selbstbestimmung, Selbsthilfe, Kooperation und Koordination. Sie analysiert das Fachkonzept der Sozialraumorientierung in Bezug auf seine Relevanz für die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Ebenen des Sozialraumansatzes und untersucht die Auswirkungen der Sozialraumorientierung auf die Behindertenhilfe. Die Arbeit beschäftigt sich außerdem mit den ethischen und politischen Implikationen der Inklusionsdebatte.
- Quote paper
- Annkristin Plaggenborg (Author), 2014, Leistet das Fachkonzept Sozialraumorientierung einen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit Behinderung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284927