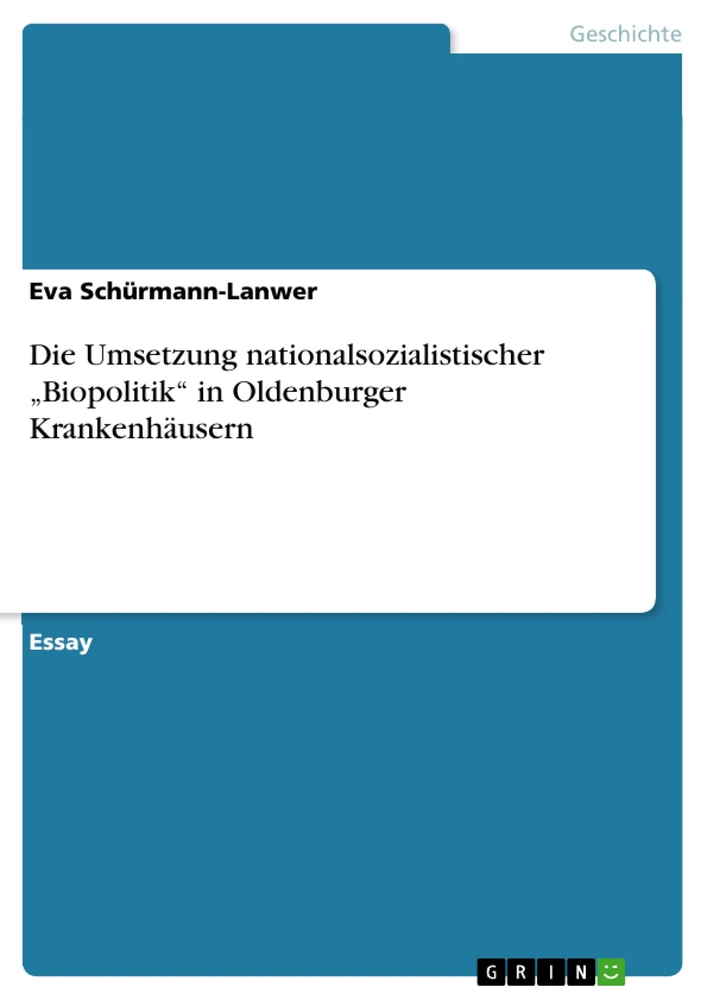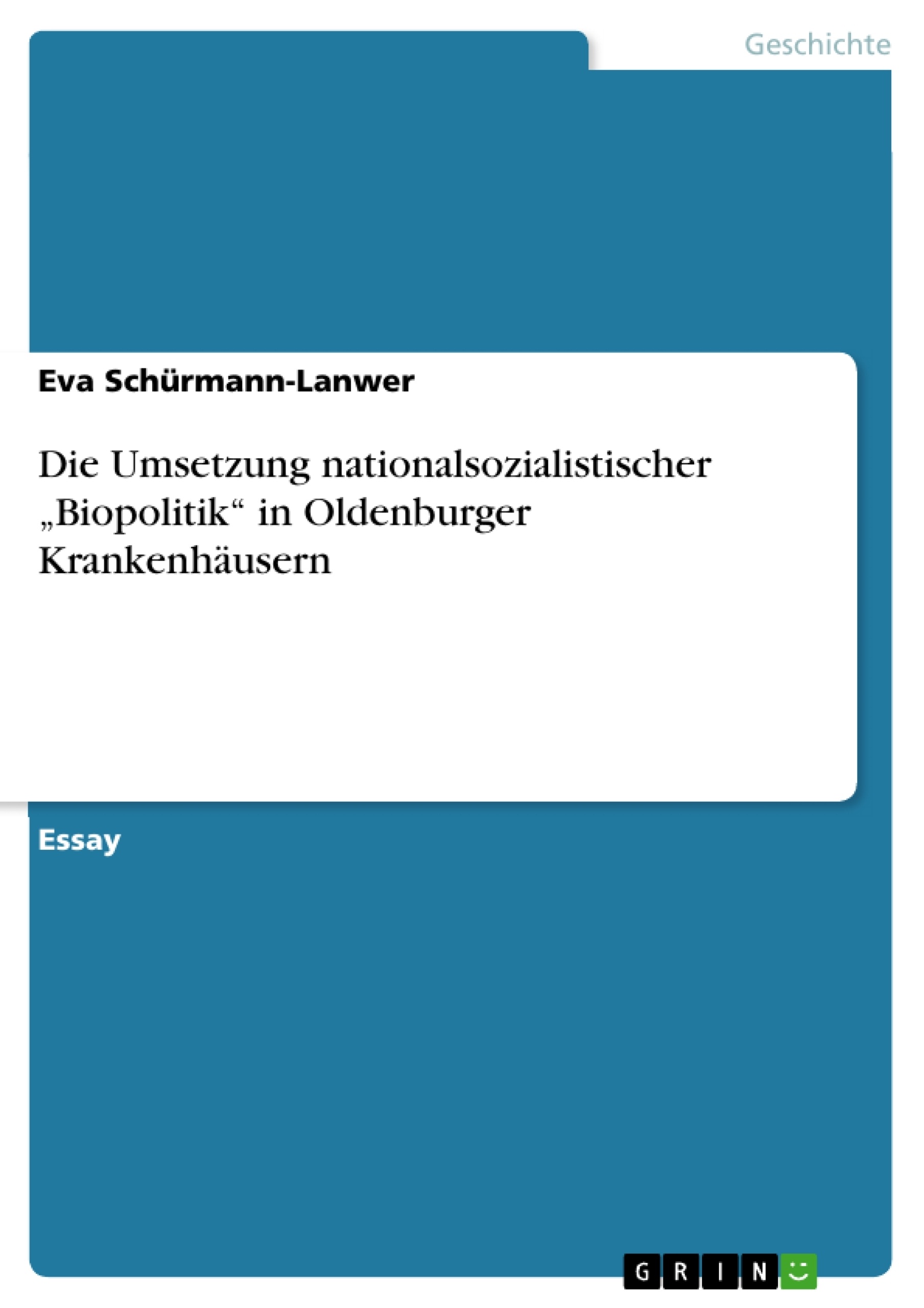Verfolgt man die heutigen Debatten über „Globalisierung“, „Zivilgesellschaft“, „Umbau des Sozialstaats“/„schlanken Staat“ und „Eigenverantwortung“, so hat es den Anschein, als ob diese völlig neuartig und in dieser Form noch nie da gewesen seien. Eine etwas tiefergehende Beschäftigung mit früheren Geschichtsepochen erweckt jedoch eher den Eindruck, dass manche Diskussionen und Diskurse mit einer gewissen Zwanghaftigkeit dem Anschein nach immer wieder neu aufgelegt werden.
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts fanden solche Debatten und Diskussionen ebenfalls statt, allerdings mit einer Zuspitzung, die von den Anfängen des späten 18. Jahrhun-derts und den heutigen Debatten weit entfernt war; in diesen Zei-ten wurden von Sozialmedizinern, Psychiatern, Hygienikern, Politikern et cetera Überlegungen dahingehend angestellt, wie man mit Mitteln der „Eugenik“ „sozial schwache“ Bevölke-rungselemente, wie man heute sagen würde, die „Kranken“, „Krüppel“, „Minderwertigen“ und „Irren“, am besten durch geeignete Maßnahmen an ihrer Reproduktion und weiteren Vermehrung hindern könne. Dies war aber nur das Vorspiel für das Vorgehen des Nationalsozialismus, der im Namen der „Euthanasie“ und des „gesunden Volkskörpers“ systematische Massenmorde und Zwangssterilisationen an Behinderten, „Asozialen“, Geisteskranken und nicht zuletzt auch Kriegsversehrten beging.
Die Frage ist nun, ob die „Euthanasie“-Verbrechen der Nationalsozialisten lediglich eine radikalisierte Variante der vorherge-henden „Eugenik“-Debatte und sozialdarwinistischer Strömungen seit dem 19. Jahrhundert darstellen oder ob das eine mit dem anderen nur bedingt etwas oder gar nichts zu tun hat.
Inhaltsverzeichnis
- Ideengeschichtliche Voraussetzungen der Euthanasie und der „Rassenhygiene“ unter dem übergreifenden Aspekt der „Biopolitik“ nach Michel Foucault
- Zum Begriff der „Biopolitik“ beziehungsweise der „Biomacht“ nach Michel Foucault
- Zur Einführung: Das Motiv der Fürsorge – umstritten von Anfang an
- Analyse von Biomacht/-politik nach Michel Foucault
- Fragmentierung und Parzellierung
- Analyse der Euthanasie als Bestandteil der Biopolitik
- Darwinismus und Sozialdarwinismus
- Der „Defizit“-Diskurs und die „erlernte Hilflosigkeit“
- Eugenik und „Rassenhygiene“
- Euthanasie und Zwangssterilisationen
- Konkretisierung: Euthanasie und rassenhygienische Maßnahmen der Nationalsozialisten in der Praxis 1933-1945 am Beispiel der Krankenhäuser und Psychiatrien Oldenburgs
- Einleitende Problemcharakterisierung
- Die psychiatrische Anstalt Wehnen
- Logik der Radikalisierung
- Die Entwicklung von Wehnen
- Kloster Blankenburg
- Einleitendes
- Das Pflegeheim Kloster Blankenburg als Teil der „Rassenhygiene“-Politik
- Die wechselvolle Geschichte von Blankenburg
- Blankenburg in den frühen 1930er Jahren
- Blankenburg während des 2. Weltkrieges – Der „Kindertransport“
- „Umwidmung“ von Kloster Blankenburg und die Zwangsarbeiter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Umsetzung der nationalsozialistischen "Biopolitik" in den Krankenhäusern Oldenburgs. Sie untersucht die Einbindung der Krankenhäuser in Maßnahmen zur Erfassung und Vernichtung von Behinderten, Geisteskranken und chronisch Pflegebedürftigen. Die Arbeit rekonstruiert die Entwicklung der „Biopolitik“ vom späten 18. Jahrhundert bis zu ihrer Radikalisierung im Nationalsozialismus.
- Die „Biopolitik“ nach Michel Foucault
- Die Rolle des Darwinismus und Sozialdarwinismus
- Die Entwicklung des „Defizit“-Diskurses und der „erlernten Hilflosigkeit“
- Die Eugenik und „Rassenhygiene“ als Vorläufer der nationalsozialistischen „Biopolitik“
- Die konkreten Maßnahmen zur Erfassung und Vernichtung von Behinderten, Geisteskranken und chronisch Pflegebedürftigen in den Krankenhäusern Oldenburgs
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die ideengeschichtlichen Voraussetzungen der nationalsozialistischen „Biopolitik“. Es analysiert den Begriff der „Biomacht“ nach Michel Foucault, die Verbindung zwischen Darwinismus und Sozialdarwinismus, den „Defizit“-Diskurs sowie die Entwicklung der Eugenik und „Rassenhygiene“ im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Das zweite Kapitel untersucht die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der nationalsozialistischen „Biopolitik“ in den Krankenhäusern und Psychiatrien Oldenburgs. Es beschreibt die Entwicklung der psychiatrischen Anstalt Wehnen, die zu einer „Hungermord-Klinik“ wurde. Darüber hinaus wird die Geschichte des Pflegeheims Kloster Blankenburg beleuchtet, das im Kontext der „Rassenhygiene“ und der „Aktion Brandt“ als „Sonderkrankenhaus“ fungierte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „Biopolitik“, „Biomacht“, „Eugenik“, „Rassenhygiene“, „Euthanasie“, „Zwangssterilisation“, „Defizit“, „erlernte Hilflosigkeit“, „Lebensunwert“, „Volksaufartung“, „Rassensäuberung“, „Hungermord“ und „Sonderkrankenhaus“ im Kontext der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Biopolitik“ nach Michel Foucault?
Foucault beschreibt damit Techniken der Macht, die darauf abzielen, den menschlichen Körper und die gesamte Bevölkerung zu verwalten, zu kontrollieren und zu regulieren.
Wie wurde die NS-Euthanasie in Oldenburg umgesetzt?
In Einrichtungen wie der Anstalt Wehnen und dem Kloster Blankenburg wurden systematische Morde durch Hunger, Vernachlässigung oder Deportationen („Kindertransporte“) begangen.
Welche Rolle spielten Eugenik und Rassenhygiene?
Sie lieferten die ideologische Basis, um Menschen als „minderwertig“ oder „lebensunwert“ zu klassifizieren und Zwangssterilisationen sowie Massenmorde pseudowissenschaftlich zu rechtfertigen.
Was war die psychiatrische Anstalt Wehnen während der NS-Zeit?
Wehnen entwickelte sich zu einer „Hungermord-Klinik“, in der Patienten durch gezielten Entzug von Nahrung getötet wurden, um den „Volkskörper“ zu „reinigen“.
Gibt es Kontinuitäten zwischen Eugenik-Debatten und heutigen Diskursen?
Die Arbeit hinterfragt kritisch, ob heutige Debatten über „Eigenverantwortung“ und den „Umbau des Sozialstaats“ Anleihen an früheren Nützlichkeitsdiskursen nehmen.
- Quote paper
- Eva Schürmann-Lanwer (Author), 2014, Die Umsetzung nationalsozialistischer „Biopolitik“ in Oldenburger Krankenhäusern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284987