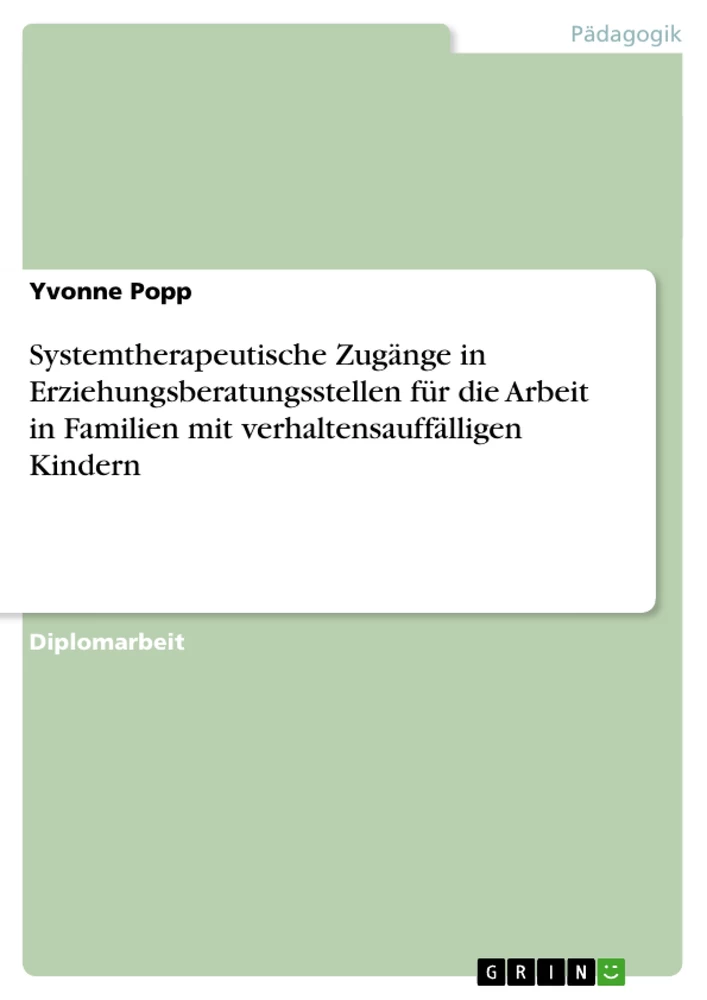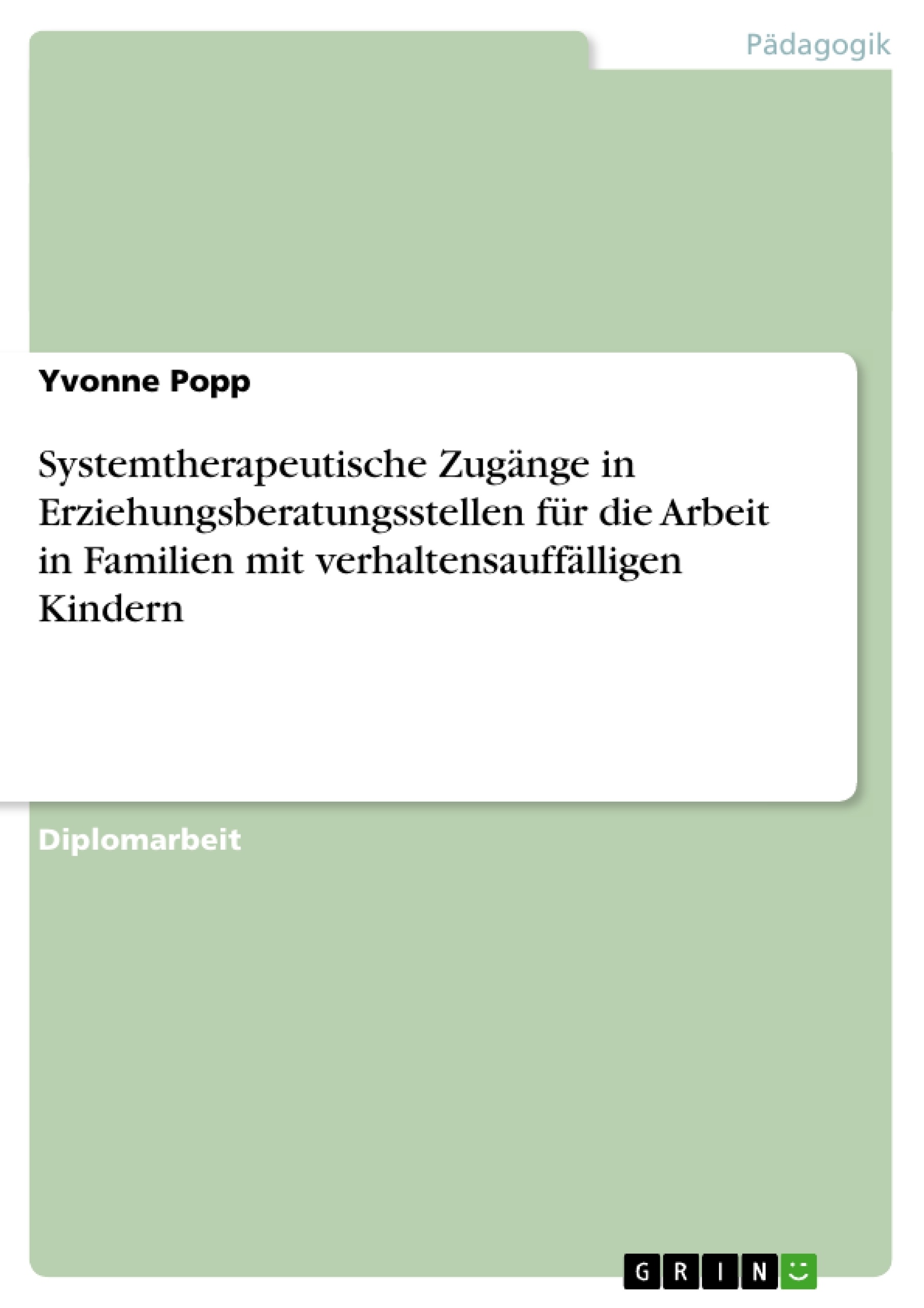Die vorliegende Arbeit setzt sich mit systemtherapeutischen Ansätzen und deren Relevanz für die Arbeit in Erziehungsberatungsstellen (EB-Stellen) auseinander. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Behandlung von Familien, in denen ein Kind eine Verhaltensauffälligkeit aufweist. Mein persönliches Interesse gilt den systemtherapeutischen Ansätzen, da mich die Beschäftigung mit diesen sehr fasziniert hat, nicht zuletzt deshalb, weil sich dadurch eine Änderung meiner Gedanken bezüglich der Genese symptomatischen Verhaltens vollzogen hat.
In der systemischen Therapie gibt es viele verschiedene Ansätze. Es würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen, ginge ich auf jeden Ansatz ein. Ich beschränke mich deshalb auf die wichtigsten Ansätze, um den Leser ein grundlegendes Verständnis des systemischen Gedankenguts zu vermitteln und werde deren Konzepte und Methoden darstellen, die für den weiteren Verlauf meiner Arbeit von Bedeutung sein werden.
Die Arbeit soll wichtige Konzepte und Techniken darstellen, die aus verschiedenen systemischen Schulen stammen und die schulenübergreifend in der EB-Stelle angewandt werden können.
Meiner Arbeit liegt die Fragestellung zugrunde, wie systemische Ansätze in EB-Stellen angewandt werden können und ob diese dazu beitragen können, gerade ein Kind, das eine Verhaltensauffälligkeit aufweist zu entlasten, indem sein Verhalten als logisch in dem Kontext, in dem es auftritt interpretiert wird. Gerade Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten haben in unserer Gesellschaft einen schlechten Stand. Sie ernten oft nur negative Reaktionen, werden verurteilt oder für ihr Verhalten bestraft (vgl. Vernooij 2000, S. 32), ohne dass die Hintergründe, warum diese Kinder verhaltensauffällig werden, in Betracht gezogen werden.
Ich werde mich in meiner Arbeit mit dem System Familie auseinandersetzen, da dies meines Erachtens für die meisten Menschen das wohl wichtigste und somit einflussreichste System darstellt, gleichwohl ich nicht leugnen möchte, dass auch andere Systeme einen wichtigen Einfluss auf das Individuum haben und auch in der systemischen Therapie behandelt werden (vgl. Schweitzer 1995, S. 18). Da ich selbst in einer EB-Stelle hospitiert habe, habe ich erlebt, dass es in den meisten Fällen Familien waren, die die Beratung in Anspruch nahmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichtliche Entwicklung der systemischen Therapie
- 3. Grundlagen der Systemtheorie
- 3.1. Morphogenese und Morphostase
- 3.2. Homöostase und Kalibrierung
- 3.3. Strukturen
- 3.4. Regeln
- 3.5. Hierarchie
- 3.6. Autopoiese
- 4. Grundannahmen, Ziele und Voraussetzungen des systemtherapeutischen Ansatzes
- 4.1. Ressourcenorientiertheit
- 4.2. Aufgaben des Therapeuten und Ziele der Therapie
- 4.3. Die Verantwortung der Familie
- 5. Bedeutende Schulen in der systemischen Therapie und Weiterentwicklungen
- 5.1. Der strukturelle Ansatz nach Minuchin
- 5.1.1. Theoretische Aspekte
- 5.1.2. Praxisrelevante Aspekte
- 5.2. Der strategische Ansatz nach Selvini-Palazzoli [u. a.]
- 5.2.1. Theoretische Aspekte
- 5.2.2. Praxisrelevante Aspekte
- 5.3. Der entwicklungsorientierte Ansatz nach Satir
- 5.3.1. Theoretische Aspekte
- 5.3.2. Praxisrelevante Aspekte
- 5.4. Der psychoanalytisch orientierte Ansatz nach Stierlin
- 5.4.1. Theoretische Aspekte
- 5.4.2. Praxisrelevante Aspekte
- 5.5. Lösungsorientierte Kurztherapie (de Shazer [u. a.])
- 5.6. Das Reflecting Team (Andersen)
- 5.7. Narrative Ansätze (Anderson / Goolishian/White)
- 5.8. Die Familienaufstellung (Hellinger)
- 5.1. Der strukturelle Ansatz nach Minuchin
- 6. Verhaltensauffälligkeit
- 6.1. Erklärungsansätze für abweichendes Verhalten
- 6.2. Institutionen
- 7. Die Erziehungsberatung
- 7.1. Aufgaben und Arbeit einer EB-Stelle (Erziehungsberatungsstelle)
- 7.2. Geschichte der Erziehungsberatung
- 7.3. Rahmenbedingungen und gesetzliche Regelungen für EB-Stellen
- 7.3.1. Ausbildung der Mitarbeiter einer EB-Stelle (Erziehungsberatungsstelle)
- 7.3.2. Zugang zu den EB-Stellen
- 7.3.3. Die Finanzierung der EB-Stellen
- 7.3.4. Personalplanung der EB-Stellen
- 7.3.5. Der zeitliche Rahmen der Beratungen
- 7.3.6. Ausstattung der Räumlichkeiten der EB-Stelle
- 7.4. Auftragsbestimmung in der EB-Stelle
- 7.5. Konzepte in EB-Stellen
- 7.6. Erstkontakt und Erstgespräch in der EB-Stelle
- 8. Der systemische Ansatz in der EB-Stelle
- 8.1. Die Behandlungseinheit im systemischen Ansatz
- 8.2. Die Anzahl der Berater/Therapeuten
- 8.3. Die Abstände zwischen den Sitzungen
- 9. Anwendung systemischer Methoden und Techniken in der Praxis der EB-Stelle
- 9.1. Neutralität
- 9.2. Zirkularität
- 9.3. Hypothetisieren
- 9.4. Joining
- 9.5. Fokussieren
- 9.6. Die eigene Veränderung bewirken
- 9.7. Das Formulieren positiver klarer Ziele
- 9.8. Das Problem nach außen verlagern (Externalisierung)
- 9.9. Kommunikationstraining
- 9.10. Systemisches Fragen
- 9.10.1. Zirkuläres Fragen
- 9.10.2. Hypothetisches Fragen
- 9.10.3. Die Wunderfrage
- 9.10.4. Fragen nach Ausnahmen
- 9.10.5. Fragen danach, was so bleiben soll, wie es ist
- 9.10.6. Verschlimmerungsfragen
- 9.11. Die Realitätssicht relativieren
- 9.12. Refraiming (einen neuen Rahmen geben)
- 9.13.1. Symptomverschreibung
- 9.13. Aufgaben
- 9.13.2. Die Verschreibung von Ritualen
- 9.14. Arbeit an den Grenzen
- 9.15. Mehrgenerationenperspektive
- 9.16. Geschichten und Metaphern
- 9.16.1. Geschichten erzählen
- 9.16.2. Der Gebrauch von therapeutischen Metaphern
- 9.16.3. Familienskulptur
- 9.17. Elterliche Präsenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht systemtherapeutische Ansätze und ihre Relevanz für die Arbeit in Erziehungsberatungsstellen, insbesondere bei Familien mit verhaltensauffälligen Kindern. Die Arbeit fokussiert auf die Anwendung systemischer Methoden und Techniken in der Praxis der Erziehungsberatung.
- Grundlagen der Systemtheorie und systemische Therapie
- Bedeutende Schulen in der systemischen Therapie
- Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und ihre Ursachen
- Aufgaben und Arbeit in Erziehungsberatungsstellen
- Anwendung systemischer Methoden und Techniken in der Erziehungsberatung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Einführung in das Thema der Diplomarbeit und die Relevanz systemtherapeutischer Ansätze in der Erziehungsberatung. Die Arbeit konzentriert sich auf Familien mit verhaltensauffälligen Kindern. Das persönliche Interesse des Autors an systemischen Ansätzen und die Veränderung der Sichtweise auf die Genese symptomatischen Verhaltens werden beleuchtet.
- Kapitel 2: Geschichtliche Entwicklung der systemischen Therapie: Darstellung der Entstehung und Entwicklung der systemischen Therapie, ihrer Vorläufer und wichtiger Meilensteine.
- Kapitel 3: Grundlagen der Systemtheorie: Erklärung grundlegender Konzepte der Systemtheorie, wie Morphogenese, Morphostase, Homöostase, Kalibrierung, Strukturen, Regeln, Hierarchie und Autopoiese. Diese Konzepte werden in Bezug auf die Systemtherapie erläutert.
- Kapitel 4: Grundannahmen, Ziele und Voraussetzungen des systemtherapeutischen Ansatzes: Präsentation der zentralen Grundannahmen, Ziele und Voraussetzungen der systemischen Therapie. Dabei werden die Ressourcenorientiertheit, Aufgaben des Therapeuten, Ziele der Therapie und die Verantwortung der Familie hervorgehoben.
- Kapitel 5: Bedeutende Schulen in der systemischen Therapie und Weiterentwicklungen: Vorstellung verschiedener bedeutender Schulen in der systemischen Therapie, wie der strukturelle Ansatz nach Minuchin, der strategische Ansatz nach Selvini-Palazzoli, der entwicklungsorientierte Ansatz nach Satir, der psychoanalytisch orientierte Ansatz nach Stierlin, lösungsorientierte Kurztherapie, das Reflecting Team, narrative Ansätze und die Familienaufstellung. Die theoretischen und praxisrelevanten Aspekte jedes Ansatzes werden erläutert.
- Kapitel 6: Verhaltensauffälligkeit: Erörterung des Konzepts der Verhaltensauffälligkeit bei Kindern. verschiedene Erklärungsansätze für abweichendes Verhalten werden vorgestellt und die Rolle von Institutionen beleuchtet.
- Kapitel 7: Die Erziehungsberatung: Beschreibung der Aufgaben und Arbeit einer Erziehungsberatungsstelle. Die Geschichte der Erziehungsberatung, Rahmenbedingungen, gesetzliche Regelungen, Ausbildung der Mitarbeiter, Zugang, Finanzierung, Personalplanung, zeitliche Rahmenbedingungen, Ausstattung der Räumlichkeiten, Auftragsbestimmung, Konzepte und der Erstkontakt werden erläutert.
- Kapitel 8: Der systemische Ansatz in der EB-Stelle: Darstellung des systemischen Ansatzes in der Praxis der Erziehungsberatung. Die Behandlungseinheit, Anzahl der Berater/Therapeuten und die Abstände zwischen den Sitzungen werden behandelt.
- Kapitel 9: Anwendung systemischer Methoden und Techniken in der Praxis der EB-Stelle: Erklärung wichtiger systemischer Methoden und Techniken, die in der Erziehungsberatung eingesetzt werden können. Die Kapitel erläutert Neutralität, Zirkularität, Hypothetisieren, Joining, Fokussieren, die eigene Veränderung bewirken, Formulieren positiver klarer Ziele, Problemverlagerung (Externalisierung), Kommunikationstraining, systemisches Fragen, die Realitätssicht relativieren, Refraiming, Symptomverschreibung, Aufgaben, Ritualverschreibung, Arbeit an den Grenzen, Mehrgenerationenperspektive, Geschichten und Metaphern (Geschichten erzählen, therapeutische Metaphern, Familienskulptur) und die elterliche Präsenz.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Diplomarbeit sind: systemische Therapie, Erziehungsberatung, Familien, verhaltensauffällige Kinder, systemische Ansätze, Methoden und Techniken, Ressourcenorientierung, Kommunikationstraining, Familienaufstellung, Behandlungseinheit, Erstkontakt, Erstgespräch, Theorie, Praxis.
- Citation du texte
- Yvonne Popp (Auteur), 2003, Systemtherapeutische Zugänge in Erziehungsberatungsstellen für die Arbeit in Familien mit verhaltensauffälligen Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28507