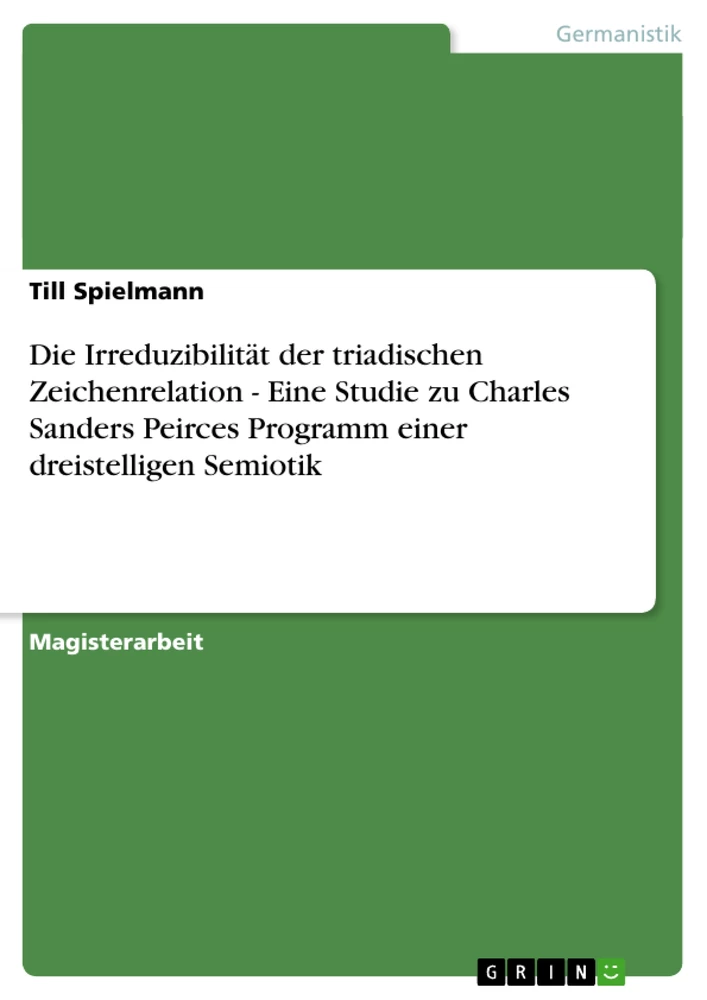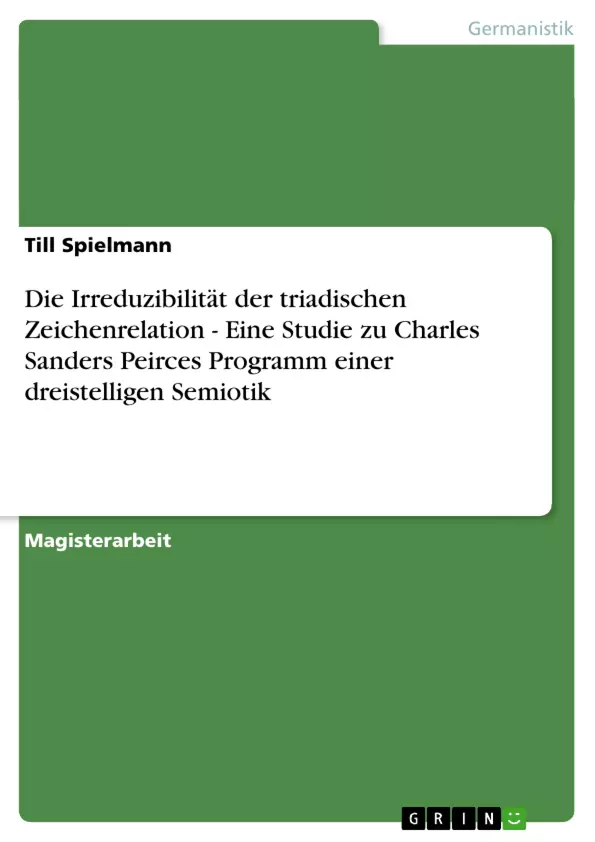Es ist Absicht dieser Arbeit, die Semiotik Peirces sowie ihren Grundgedanken einer irreduziblen triadischen Zeichenrelation für die aktuelle semiotische und philosophische Diskussion fruchtbar zu machen. Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse der peirceschen Kategorienlehre und Semiotik sollen einige populäre theoretische Konzeptionen einer kritischen Analyse unterzogen werden. Die Arbeit gliedert sich in einen ersten grundlagentheoretischen Teil, in dem die These der Irreduzibilität der triadischen Zeichenrelation anhand der Lehre der Fundamentalkategorien und der dreistelligen Semiotik rekonstruiert und geprüft werden soll, und einen zweiten kritischen Teil, in dem in einer idealtypischen Analyse verschiedene Ansätze diskutiert werden, die in paradigmatischer Weise die Einheit der triadischen Relation unterminieren.
Die Rekonstruktion der Irreduzibilitätsthese im ersten Kapitel vollzieht sich in drei Schritten: Zunächst gilt es, den erkenntnistheoretischen Hintergrund des peirceschen Programms zu erhellen. Dabei markiert Peirces Auseinandersetzung mit Kant und insbesondere seine Kritik der Behauptung unerkennbarer ›Dinge an sich‹ den entscheidenden Ansatzpunkt für eine semiotische Transformation der kantischen Konzeption in der frühen Kategorienlehre der New List (Kap. 1.1.). In der ausgearbeiteten Kategorienlehre, wie sie sich in den Pragmatismus- Vorlesungen darstellt, füllt Peirce die relationenlogischen Gedanken mit phänomenologischem Gehalt. In Kapitel 1.2. werden die einzelnen Kategorien vorgestellt und diskutiert, bevor anschließend jener kategoriale Irreduzibilitätsbeweis eine nähere Prüfung erfährt, der die Vollständigkeit und Universalität der Fundamentalkategorien verbürgen soll.
Schließlich wird vermittels einer Darlegung der verschiedenen Zeichenbezüge der Zusammenhang von Kategorienlehre und Semiotik verdeutlicht, wobei der Zeichenbezug das Zeichen unter dem Aspekt der Erstheit thematisiert, während der Objektbezug der Kategorie ›Zweitheit‹ und der Interpretantenbezug der Kategorie ›Drittheit‹ zuzuordnen ist. Der folgende semiotische Irreduzibilitätsbeweis soll die Einheit der semiotischen Triade belegen und zugleich auf die Aporien einer empirischen Begründung der Semiotik hinweisen (1.3.).
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- 1. Die Lehre von den Fundamentalkategorien und die Grundlegung einer triadischen Semiotik
- 1.1. Der erkenntnistheoretische Hintergrund: Sinnkritischer Realismus und die semiotische Transformation Kants
- 1.1.1. Grundgedanke und Grenzen von Kants Kritik der reinen Vernunft
- 1.1.2. Sinnkritischer Realismus: Peirces reflexive Begründungsstrategien und seine Kritik an unerkennbaren ›Dingen an sich‹
- 1.1.3. Semiotische Transformation Kants: Die Binnenlogik von Peirces früher Kategorienlehre in der New List
- 1.2. Die phänomenologische Begründung der Kategorienlehre
- 1.2.1. Die Kategorie >Erstheit< (I)
- 1.2.2. Die Kategorie ›Zweitheit< (II)
- 1.2.3. Die Kategorie ›Drittheit< (III)
- 1.2.4. Kategorialer Irreduzibilitätsbeweis: Die Universalität der Kategorien
- 1.3. Das Programm einer triadischen Semiotik
- 1.3.1. Der Zeichenbezug des Zeichens (I)
- 1.3.2. Der Objektbezug des Zeichens (II)
- 1.3.3. Der Interpretantenbezug des Zeichens (III)
- 1.3.4. Semiotischer Irreduzibilitätsbeweis: Die Semiose als triadische Relation
- 2. Über einige illegitime Reduktionen der triadischen Zeichenrelation
- 2.1. Die Verabsolutierung der Kategorie >Erstheit‹ in der Phänomenologie
- 2.1.1. Momente der Erstheit in Husserls phänomenologischer Philosophie
- 2.1.2. Das Problem des phänomenologischen Reduktionismus': Methodischer Solipsismus und Bewusstseins-Idealismus
- 2.2. Die Verabsolutierung der Kategorie >Zweitheit< im Materialismus
- 2.2.1. Momente der Zweitheit in Informationismus und Behaviorismus
- 2.2.2. Das Problem des materialistischen Reduktionismus': Methodischer Solipsismus und Objektivismus
- 2.3. Die Verabsolutierung der Kategorie ›Drittheit‹ im Dekonstruktivismus
- 2.3.1. Momente der Drittheit in Derridas Theorie der Abdrift
- 2.3.2. Das Problem des dekonstuktivistischen Reduktionismus': Semiotizismus und die Grenzen der Interpretation
- Schlussbemerkung
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Rekonstruktion der Irreduzibilitätsthese anhand der Peirceschen Kategorienlehre und Semiotik
- Kritik an verschiedenen Ansätzen, die die triadische Zeichenrelation reduzieren
- Analyse der Grenzen phänomenologischer, materialistischer und dekonstruktivistischer Ansätze
- Bedeutung der peirceschen Kategorienlehre für die philosophische Diskussion
- Semiotische Transformation von Kants Kritik der reinen Vernunft
- Kapitel 1: Dieses Kapitel präsentiert Peirces Theorie der Fundamentalkategorien und zeigt deren Verbindung zur triadischen Semiotik. Der erkenntnistheoretische Hintergrund von Peirces Programm wird erörtert, insbesondere seine Auseinandersetzung mit Kant und die Kritik an unerkennbaren "Dingen an sich". Die drei Kategorien Erstheit, Zweitheit und Drittheit werden vorgestellt und ihre Bedeutung für die triadische Zeichenrelation erläutert.
- Kapitel 1.1: Hier wird Peirces Kritik an Kants Kritik der reinen Vernunft dargestellt und seine semiotische Transformation des kantischen Systems anhand der Kategorienlehre der "New List" erläutert.
- Kapitel 1.2: Dieses Kapitel beschreibt die einzelnen Kategorien und diskutiert den Beweis für ihre Universalität und Irreduzibilität.
- Kapitel 1.3: In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Zeichenbezüge (Zeichen, Objekt, Interpretant) im Kontext der Kategorienlehre erläutert und der semiotische Irreduzibilitätsbeweis für die triadische Relation vorgestellt.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Ansätze, die die triadische Zeichenrelation reduzieren. Es werden exemplarisch die Phänomenologie Husserls, der Informationismus und Behaviorismus sowie der Dekonstruktivismus Derridas untersucht. Die jeweilige Fokussierung auf einen bestimmten Aspekt der Kategorienlehre und die damit verbundenen Probleme werden hervorgehoben.
- Kapitel 2.1: Hier wird die Reduktion der triadischen Relation auf die Kategorie Erstheit im Rahmen der Phänomenologie Husserls analysiert.
- Kapitel 2.2: Dieses Kapitel untersucht die Verabsolutierung der Zweitheit im Materialismus, insbesondere im Informationismus und Behaviorismus.
- Kapitel 2.3: Dieser Abschnitt beleuchtet die Verabsolutierung der Drittheit im Dekonstruktivismus Derridas und die Grenzen der Interpretation, die aus dieser Reduktion resultieren.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die semiotische Theorie von Charles Sanders Peirce und beleuchtet die Bedeutung der triadischen Zeichenrelation für die aktuelle semiotische und philosophische Diskussion. Im Mittelpunkt stehen die Kritik an populären theoretischen Konzeptionen, die die Einheit dieser Relation untergraben.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Semiotik und Erkenntnistheorie. Wichtige Schlüsselwörter sind: Charles Sanders Peirce, Kategorienlehre, Triadische Zeichenrelation, Semiose, Irreduzibilität, Phänomenologie, Materialismus, Dekonstruktivismus, Husserl, Derrida, Sinnkritischer Realismus, Bedeutung, Interpretation.
- Citar trabajo
- Till Spielmann (Autor), 2002, Die Irreduzibilität der triadischen Zeichenrelation - Eine Studie zu Charles Sanders Peirces Programm einer dreistelligen Semiotik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28542