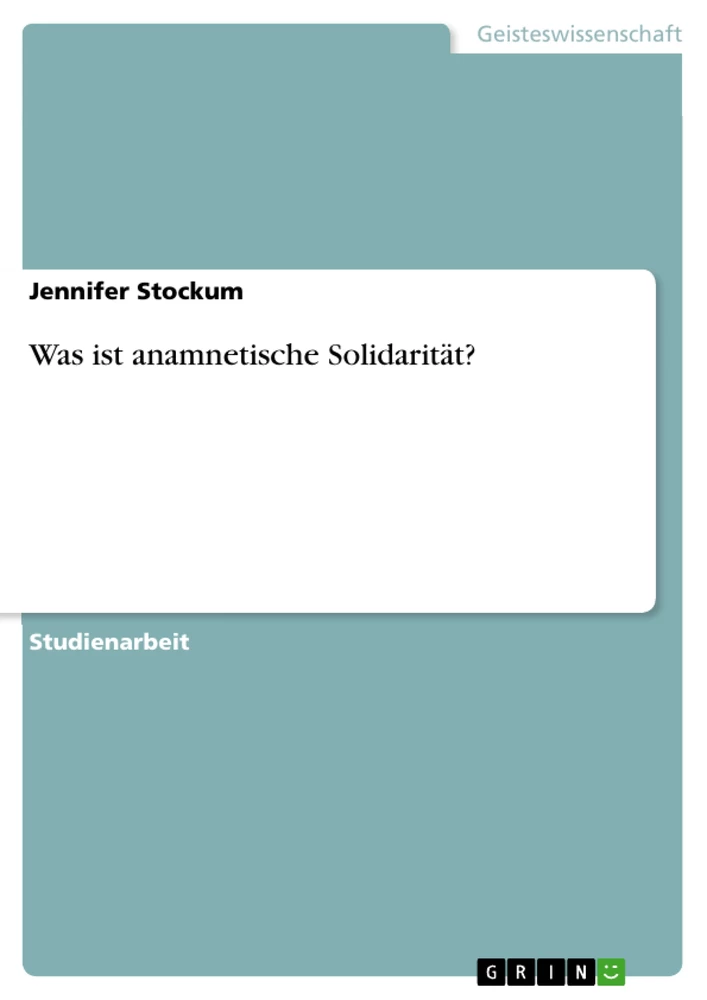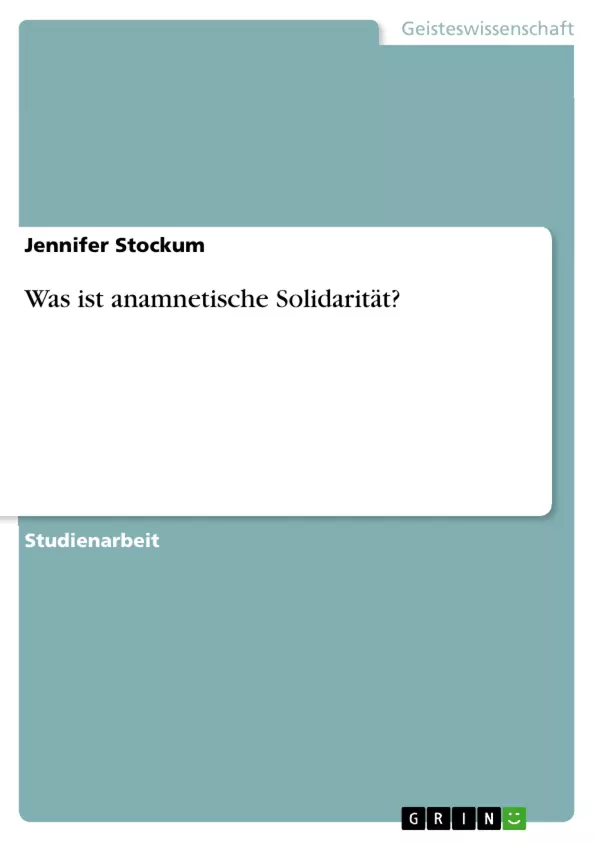In seiner 1976 erschienenen Arbeit "Wissenschaftstheorie - Handlungstheorie - Fundamentale Theologie: Analysen zu Ansatz und Status theologischer Theoriebildung" beschäftigt sich Helmut Peukert mit der Frage, wie es heute möglich ist, über Theologie zu sprechen. In der wissenschaftstheoretischen Diskussion des 20. Jahrhunderts ist nicht nur die Möglichkeit von Theologie bestritten worden, sondern grundsätzlich auch, dass es überhaupt die sprachlichen Mittel gäbe, um Fragen einer theologischen Dimension stellen zu können. Peukert versucht daher in seinem Werk in Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Diskussion einen Vorschlag für eine Fundamentale Theologie, eine Basistheorie der Theologie, zu entwickeln. Dabei geht er davon aus, dass es eine gewisse Konvergenz zwischen Überlegungen zum Grundsatz der Theologie und Ergebnissen der wissenschaftstheoretischen Forschung gibt. Dieser Konvergenzpunkt liegt seiner Meinung nach in der Theorie Kommunikativen Handelns begründet, weshalb er aus eben dieser einen Vorschlag für Fundamentale Theorie zu entwickeln versucht. In seiner historischen und systematischen Betrachtung der wissenschafts- und handlungstheoretischen Diskussion kommt er zu dem Schluss, dass wissenschaftliche Rationalität zuletzt auf den frei anzuerkennenden normativen Implikationen kommunikativen Handelns basiert. An dieser Stelle ergibt sich für Peukert allerdings ein Problem, das er als Paradoxie der anamnetischen Solidarität bezeichnet. Teil dieser Problematik ist die Frage, wie kommunikatives Handeln ausgedehnt auf die gesamte Menschheit, die jemals lebte und leben wird, angesichts der unschuldigen Opfer der Geschichte realisiert werden kann und zugleich das Glück künftiger Generationen nicht ausgeschlossen bleibt. Die anamnetische Solidarität, die ein Schlüsselbegriff in dieser scheinbaren Aporie darstellt, soll in vorliegender Arbeit erläutert werden: Was ist anamnetische Solidarität? Um diese Frage beantworten zu können, werden neben Habermas' Theorie des Kommunikativen Handels die Geschichtsphilosophischen Thesen Walter Benjamins näher betrachtet werden und ihre Folgen für die Auswirkungen auf die Abgeschlossenheit oder Unabgeschlossenheit geschichtlicher Handlung und den Auswirkungen auf die christlich-jüdische Religion.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Einordnung der anamnetischen Solidarität in Peukerts Untersuchung
- 2. Theorie des Kommunikativen Handelns
- 2.1 Handlungstypen
- 2.2 Sprechhandlungen
- 3. Die ideale Kommunikationsgemeinschaft bei Karl-Otto Apel
- 4. Die universale Kommunikations- bzw. Solidargemeinschaft Peukerts
- 5. Was hat Kommunikation mit Geschichte zu tun?
- 6. Grundlage der Solidarität: Das Anerkennen des Anderen bei Hegel
- 7. Die (un)abgeschlossenheit der Geschichte Benjamin-Horkheimer
- 8. Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte
- 8.1 Historischer Materialismus
- 8.2 Das wahre Bild der Vergangenheit
- 8.3 Angelus Novus - Engel der Geschichte
- 8.4 Eingedenken als Traumaverarbeitung der Menschheit
- 9. Das Paradox anamnetischer Solidarität
- 10. Ermöglichung anamnetischer, universal-solidarischer Existenz
- Schluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Begriff der anamnetischen Solidarität, der von Helmut Peukert in seiner wissenschaftstheoretischen Untersuchung zur Fundamentale Theologie eingeführt wird. Peukert versucht, aus Jürgen Habermas' Theorie des Kommunikativen Handelns eine Basistheorie der Theologie zu entwickeln, die die Möglichkeit von Theologie in der wissenschaftlichen Diskussion des 20. Jahrhunderts neu beleuchtet.
- Die anamnetische Solidarität als Schlüsselbegriff für eine ethische und theologische Grundlegung des kommunikativen Handelns
- Die Theorie des Kommunikativen Handelns bei Jürgen Habermas und ihre Relevanz für die Fundamentale Theologie
- Die Rolle der Geschichte und des Erinnerns in der anamnetischen Solidarität
- Die Bedeutung der universalen Kommunikationsgemeinschaft für die Realisierung anamnetischer Solidarität
- Das Paradox der anamnetischen Solidarität und die Frage nach der Überwindung des Dilemmas zwischen Vergangenheit und Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der anamnetischen Solidarität ein und stellt die zentrale Frage nach der Möglichkeit von Theologie in der heutigen Zeit. Peukert sieht in der Theorie des Kommunikativen Handelns einen wichtigen Ansatzpunkt für eine Fundamentale Theologie, die auf den normativen Implikationen kommunikativen Handelns basiert.
Kapitel 1 ordnet den Begriff der anamnetischen Solidarität in Peukerts Werk ein und erläutert, warum er sich mit diesem Konzept beschäftigt. Peukert geht davon aus, dass die normativen Postulate des kommunikativen Handelns, die in elementarer Interaktion als notwendig und verbindlich für alle Partner gelten, den Charakter von vorgreifenden, Freiheit ermöglichenden und Wirklichkeit erschließenden Grundhandlungen haben.
Kapitel 2 stellt die Theorie des Kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas dar. Habermas unterscheidet verschiedene Handlungstypen und Sprechhandlungen, die für die Analyse kommunikativen Handelns relevant sind.
Kapitel 3 beleuchtet die ideale Kommunikationsgemeinschaft bei Karl-Otto Apel, die auf dem Apriori der Argumentation basiert. Apel argumentiert, dass die Vernunftfähigkeit des Menschen die Grundlage für eine universale Kommunikationsgemeinschaft bildet.
Kapitel 4 beschreibt Peukerts Ausweitung der Idee der universalen Kommunikationsgemeinschaft. Peukert argumentiert, dass die universale Kommunikationsgemeinschaft nicht nur die gegenwärtige Menschheit, sondern auch die gesamte Menschheitsgeschichte umfasst.
Kapitel 5 erklärt, wie Kommunikation mit Geschichte zusammenhängt. Anamnetische Solidarität stellt eine Art Geschichtsbetrachtung dar, die die Vergangenheit in die Gegenwart integriert.
Kapitel 6 betrachtet die Philosophie Hegels und die Bedeutung der reziproken Anerkennung von Subjekten der Geschichte. Hegel argumentiert, dass die Anerkennung des Anderen die Grundlage für eine ethische Gemeinschaft bildet.
Kapitel 7 stellt die Diskussion zwischen Walter Benjamin und Max Horkheimer über die (Un)abgeschlossenheit der Geschichte dar. Benjamin und Horkheimer kritisieren die traditionelle Geschichtsphilosophie, die die Vergangenheit als abgeschlossene Einheit betrachtet.
Kapitel 8 erläutert die geschichtsphilosophischen Thesen Walter Benjamins, der in seinem Werk "Über den Begriff der Geschichte" den Begriff des Eingedenkens einführt. Benjamin argumentiert, dass die Vergangenheit nicht vergessen werden darf, sondern im Gegenteil aktiv erinnert werden muss.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die anamnetische Solidarität, die Theorie des Kommunikativen Handelns, die Fundamentale Theologie, die universale Kommunikationsgemeinschaft, die Geschichte und das Erinnern, die reziproke Anerkennung, das Paradox der anamnetischen Solidarität und die Überwindung des Dilemmas zwischen Vergangenheit und Zukunft.
- Citation du texte
- Jennifer Stockum (Auteur), 2014, Was ist anamnetische Solidarität?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285704