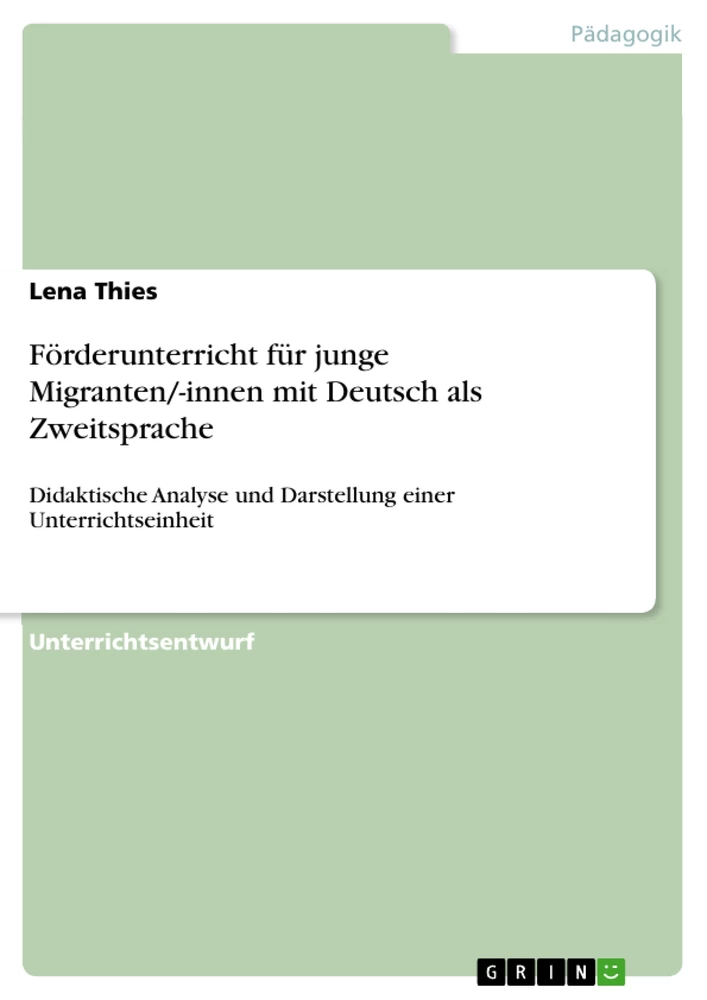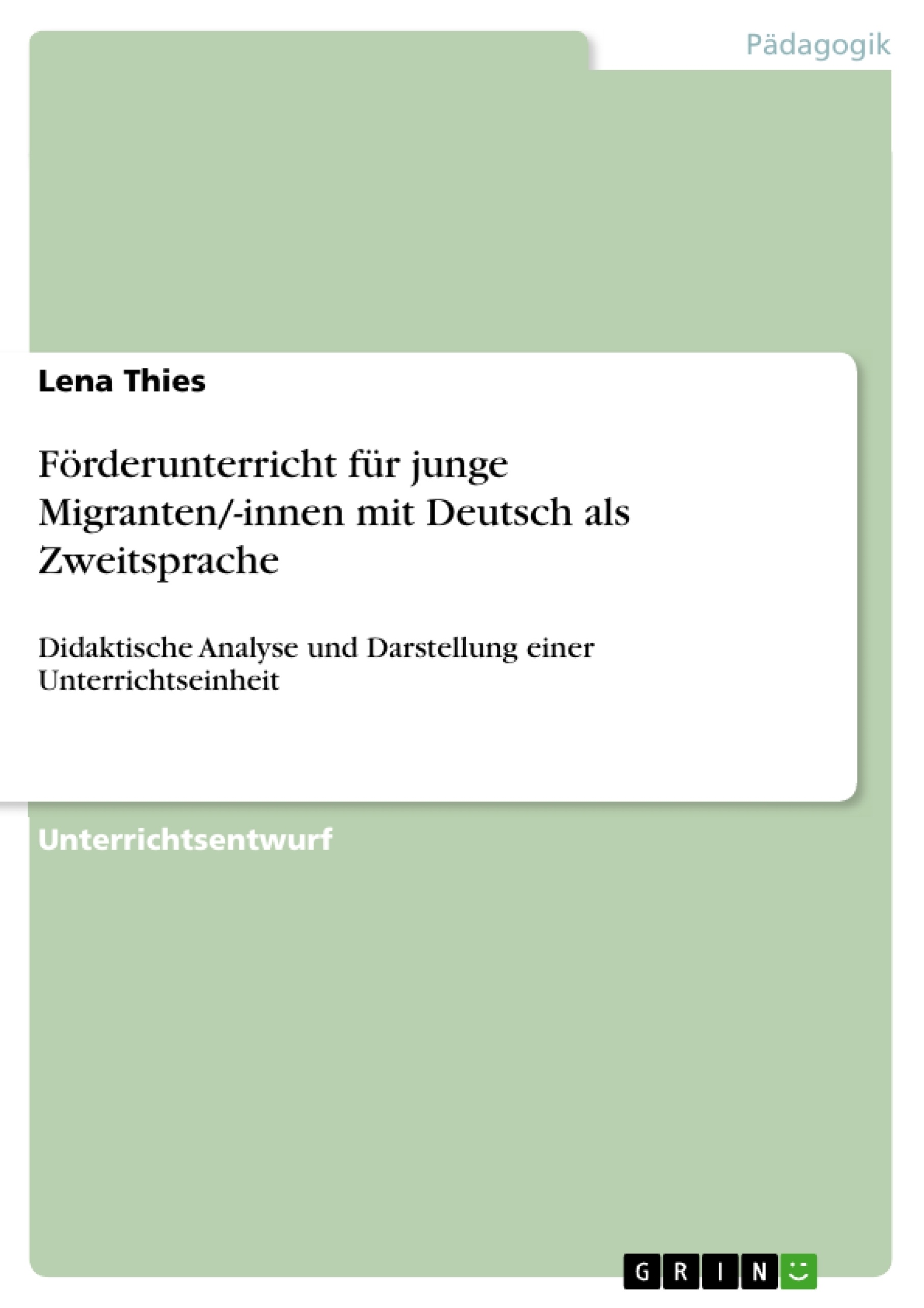Wenn man sich einmal die Schüler und Schülerinnen an den Schulen in Deutschland anschaut, kann man erkennen, dass es kaum noch Klassen gibt, in denen nur Kinder mit Deutsch als Muttersprache sitzen. „Es gehört zur Normalität im Schulalltag, dass Kinder verschiedener Muttersprachen in unseren Schulen nebeneinander sitzen.“ (Abraham, U. et al, 2009: 111) Die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sind vor allem an den Schulformen der Sonder-, Haupt- und Realschulen zu finden. Nur sehr wenige nichtdeutsche SuS gehen auf ein Gymnasium. (vgl. ebd. S.111)
Hier wird deutlich, dass etwas getan werden muss, um auch diesen Kindern die Chance auf eine positive und erfolgreiche Zukunft zu geben.
Das Seminar „Förderung von jugendlichen Migranten/innen“ beschäftigte sich mit den Problemen, aber auch mit den Chancen der Zielgruppe beim Lernen von Deutsch als Zweitsprache.
Am Ende des o.g. Seminars steht nun die Aufgabe, innerhalb einer Hausarbeit zwei exemplarische Klausuren von Migranten/innen mit Deutsch als Zweitsprache hinsichtlich ihrer Stärken und Defizite zu analysieren. Außerdem sind Förderschwerpunkte festzustellen und methodisch didaktische Maßnahmen für einen geeigneten Förderunterricht auszuarbeiten. Auch eine Darstellung einer Förderstunde ist in die Aufgabenstellung integriert.
Im ersten Teil der Hausarbeit gehe ich also zunächst auf die Stärken und Defizite der beiden Schüler ein. Hier beziehe ich mich auf die vorliegenden Klassenarbeiten bzw. Klausuren, anhand derer ich die einzelnen Punkte ermittelt habe.
Im folgenden Teil differenziere ich die einzelnen Defizite noch einmal genauer und führe an, welche besonders gefördert werden sollten, um dem Schüler gezielt zu helfen, seine schriftlichen Fähigkeiten in der deutschen Sprache zu verbessern.
Daraufhin gehe ich ganz allgemein auf die methodisch didaktischen Maßnahmen für den Förderunterricht in Bezug auf die Defizite ein.
Am Schluss der Hausarbeit ist eine kurze Darstellung einer Förderstunde für einen der Schüler zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse im Hinblick auf Stärken und Defizite
- Förderschwerpunkte
- Methodisch-didaktische Maßnahmen für den Förderunterricht
- Darstellung einer Förderstunde
- Literaturverzeichnis
- Anlage: Zeitungsartikel: Unterrichtmaterial
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert zwei Klausuren von Migranten/innen mit Deutsch als Zweitsprache, um Stärken und Defizite zu identifizieren. Sie legt Förderschwerpunkte fest und entwickelt methodisch-didaktische Maßnahmen für den Förderunterricht. Die Arbeit beinhaltet auch die Darstellung einer exemplarischen Förderstunde.
- Analyse von Stärken und Schwächen in der Texterschließung, -wiedergabe und -produktion
- Identifizierung von Förderschwerpunkten in den Bereichen Rechtschreibung, Grammatik, Wortschatz und Textproduktion
- Entwicklung methodisch-didaktischer Maßnahmen für den Förderunterricht
- Darstellung einer exemplarischen Förderstunde
Zusammenfassung der Kapitel
Die Analyse der Klausuren zeigt, dass beide Schüler/innen Stärken in der Rechtschreibung aufweisen. Der Schüler der gymnasialen Oberstufe hat jedoch Probleme bei der Texterschließung und Textproduktion, während die Schülerin des Abendgymnasiums Defizite in der Syntax, Textwiedergabe, Deklination und im Wortschatz aufweist. Die Förderschwerpunkte liegen daher bei beiden Schülern/innen auf der Verbesserung der Textproduktion und der Grammatik. Die methodisch-didaktischen Maßnahmen für den Förderunterricht sollten alle vier Kompetenzen (Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören) fördern und auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler/innen eingehen.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Förderung von jugendlichen Migranten/innen, Deutsch als Zweitsprache, Didaktik, Förderschwerpunkte, methodisch-didaktische Maßnahmen, Texterschließung, Textproduktion, Grammatik, Rechtschreibung, Wortschatz, Lernstrategien, Förderunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Förderunterrichts für junge Migranten?
Das Ziel ist die gezielte Förderung der schriftlichen Fähigkeiten in Deutsch als Zweitsprache, um Schülern bessere Chancen auf eine erfolgreiche schulische und berufliche Zukunft zu ermöglichen.
Welche Defizite werden häufig bei DaZ-Schülern analysiert?
Häufige Defizite liegen in den Bereichen Syntax (Satzbau), Textproduktion, Deklination, Wortschatz und der Erschließung komplexer Texte.
Welche Förderschwerpunkte sind besonders wichtig?
Besonders wichtig sind die Verbesserung der Textproduktion, die Festigung der Grammatik und der Ausbau des fachspezifischen Wortschatzes.
Welche methodisch-didaktischen Maßnahmen werden empfohlen?
Empfohlen wird ein ganzheitlicher Ansatz, der alle vier Kompetenzen (Lesen, Schreiben, Sprechen, Hören) fördert und individuell auf die Stärken und Schwächen der Schüler eingeht.
Warum ist die Analyse von Klausuren so wertvoll?
Die Analyse konkreter Fehlerbilder ermöglicht es, Lernstrategien zu entwickeln, die genau dort ansetzen, wo der Schüler Unterstützung benötigt, statt pauschalen Unterricht zu bieten.
- Citation du texte
- Lena Thies (Auteur), 2010, Förderunterricht für junge Migranten/-innen mit Deutsch als Zweitsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285796