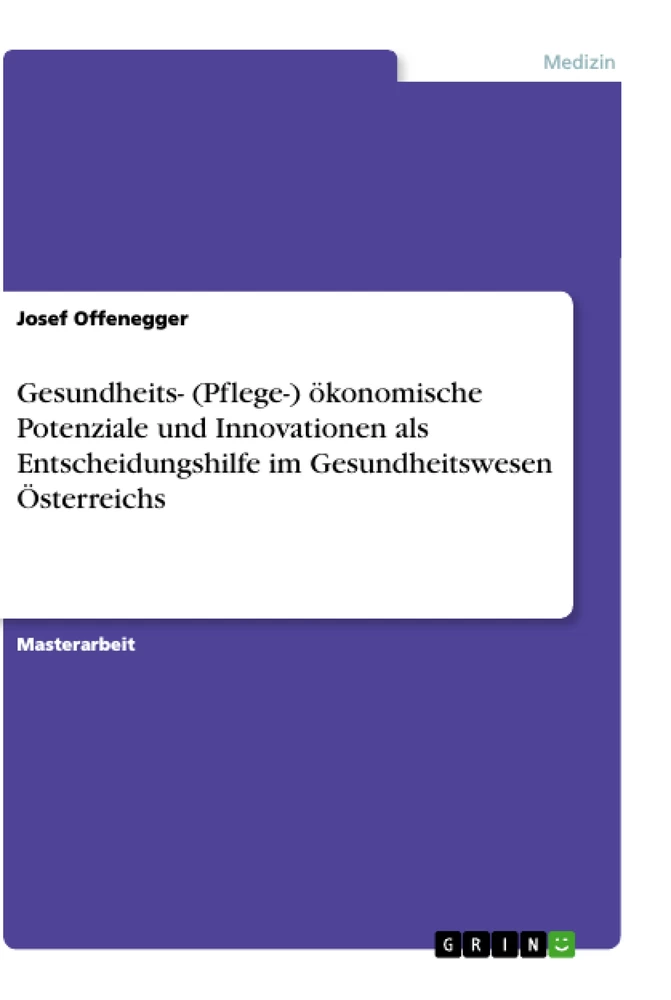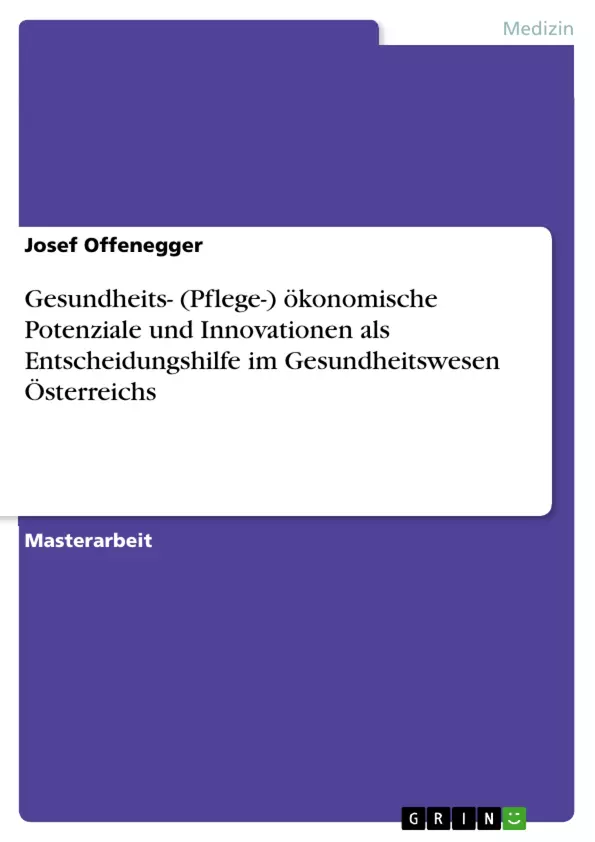Die Master Thesis nähert sich der Thematik „gegenwärtige Probleme und zukünftige Herausforderungen im österreichischen Gesundheitswesen. Dabei wurden explizit die Finanzierungslage, Strukturdefizite und weitere Ineffizienzen und Ineffektivitäten aus gesundheits (-pflege-) ökonomischer Perspektive analysiert. In diesem Kontext gewinnt der Bereich „Pflege“ eine zentrale Bedeutung, weil Pflege an sich, als größter Hauptakteur im Gesundheitswesen, nicht an den jeweiligen Problemlösungs- und expliziten Innovationsprozessen beteiligt ist. Die Profession Pflege wird kaum wahrgenommen. Als weitere mögliche Ursache für Ineffektivitäten und Ineffizienzen muss das Fehlen jeglicher Autonomie, Handlungs- und Entscheidungskompetenz auf Seiten der Pflege in Betracht gezogen werden. Die Dimension Pflege ist nicht im Gesundheitswesen integriert, sondern im Sozialbereich.
Fragestellung: Welche gesundheits (-pflege-) ökonomischen Potenziale und Innovationen sind notwendig, um die aktuellen Probleme und zukünftigen Herausforderungen im Gesundheitswesen nachhaltig im Sinne von Effizienzoptimierung sowie Kostenstabilisierung zu verändern?
Methode: Die Master Thesis ist vorwiegend deskriptiver Art. Die Hauptmethode der nicht kontrollierten Eigen und Fremdbeobachtung ist die explorative Analyse unter Zuhilfenahme von Primär- und Sekundärliteratur.
Zielsetzung: Inhalt der vorliegenden Master-Thesis ist die Analyse des Beitrages der Gesundheits (-pflege-) ökonomie als Entscheidungshilfe im Allgemeinen und an ausgewählten (o.a.g.) Problembereichen.
Ergebnisse: Als Ergebnis konnte die Master Thesis folgende zentralen Potenziale und Innovationen generieren: Die verfassungsmäßige Verankerung der Pflege, Erweiterung der Profession Pflege hinsichtlich Autonomie, Kompetenzen und erweiterter Pflegepraxis, Neustrukturierung des Gesundheitssystem auf allen Entscheidungsebenen, Reform des Sozialversicherungswesen. Die Ergebnisse liefern somit ein wertvolles Potenzial um die anstehenden Probleme und zukünftigen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu lösen.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: [Kapitel 1 Titel]
- Kapitel 2: [Kapitel 2 Titel]
- [Unterkapitel 2.1 Titel]
- [Unterkapitel 2.2 Titel]
- [Unterkapitel 2.3 Titel]
- Kapitel 3: [Kapitel 3 Titel]
- Kapitel 4: [Kapitel 4 Titel]
- Kapitel 5: [Kapitel 5 Titel]
- Kapitel 6: [Kapitel 6 Titel]
- [Unterkapitel 6.1 Titel]
- [Unterkapitel 6.2 Titel]
- [Unterkapitel 6.3 Titel]
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht [kurze Beschreibung des Ziels der Arbeit]. Die Analyse konzentriert sich auf die Identifizierung und Bewertung von [Beschreibung der analysierten Aspekte].
- Thema 1: [Thema 1, z.B. Effizienzsteigerung im Wundmanagement]
- Thema 2: [Thema 2, z.B. Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Gesundheitswesen]
- Thema 3: [Thema 3, z.B. Kostenoptimierung im extramuralen Bereich]
- Thema 4: [Thema 4, falls vorhanden]
- Thema 5: [Thema 5, falls vorhanden]
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: [Mindestens 75 Wörter umfassende Zusammenfassung von Kapitel 1. Hier werden die Hauptthemen, Argumente und Beispiele des Kapitels ausführlich diskutiert und deren Bedeutung erläutert. Verknüpfungen zu anderen Kapiteln oder übergreifenden Themen sind wünschenswert. Die Zusammenfassung sollte einen zusammenhängenden und umfassenden Überblick über das gesamte Kapitel bieten, ohne einzelne Unterkapitel separat zu behandeln.]
Kapitel 2: [Mindestens 75 Wörter umfassende Zusammenfassung von Kapitel 2. Hier werden die Hauptthemen, Argumente und Beispiele des Kapitels ausführlich diskutiert und deren Bedeutung erläutert. Verknüpfungen zu anderen Kapiteln oder übergreifenden Themen sind wünschenswert. Die Zusammenfassung sollte einen zusammenhängenden und umfassenden Überblick über das gesamte Kapitel bieten, ohne einzelne Unterkapitel separat zu behandeln.]
Kapitel 3: [Mindestens 75 Wörter umfassende Zusammenfassung von Kapitel 3. Hier werden die Hauptthemen, Argumente und Beispiele des Kapitels ausführlich diskutiert und deren Bedeutung erläutert. Verknüpfungen zu anderen Kapiteln oder übergreifenden Themen sind wünschenswert. Die Zusammenfassung sollte einen zusammenhängenden und umfassenden Überblick über das gesamte Kapitel bieten, ohne einzelne Unterkapitel separat zu behandeln.]
Kapitel 4: [Mindestens 75 Wörter umfassende Zusammenfassung von Kapitel 4. Hier werden die Hauptthemen, Argumente und Beispiele des Kapitels ausführlich diskutiert und deren Bedeutung erläutert. Verknüpfungen zu anderen Kapiteln oder übergreifenden Themen sind wünschenswert. Die Zusammenfassung sollte einen zusammenhängenden und umfassenden Überblick über das gesamte Kapitel bieten, ohne einzelne Unterkapitel separat zu behandeln.]
Kapitel 5: [Mindestens 75 Wörter umfassende Zusammenfassung von Kapitel 5. Hier werden die Hauptthemen, Argumente und Beispiele des Kapitels ausführlich diskutiert und deren Bedeutung erläutert. Verknüpfungen zu anderen Kapiteln oder übergreifenden Themen sind wünschenswert. Die Zusammenfassung sollte einen zusammenhängenden und umfassenden Überblick über das gesamte Kapitel bieten, ohne einzelne Unterkapitel separat zu behandeln.]
Kapitel 6: [Mindestens 75 Wörter umfassende Zusammenfassung von Kapitel 6. Hier werden die Hauptthemen, Argumente und Beispiele des Kapitels ausführlich diskutiert und deren Bedeutung erläutert. Verknüpfungen zu anderen Kapiteln oder übergreifenden Themen sind wünschenswert. Die Zusammenfassung sollte einen zusammenhängenden und umfassenden Überblick über das gesamte Kapitel bieten, ohne einzelne Unterkapitel separat zu behandeln.]
Schlüsselwörter
Wundmanagement, Gesundheitsökonomie, Kostenoptimierung, Qualitätssicherung, Interdisziplinarität, extramurale Versorgung, Ressourcenallokation, evidence-basierte Praxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur vorliegenden Arbeit
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Vorschau auf ein akademisches Werk. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der zentralen Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf einer strukturierten und professionellen Analyse der behandelten Themen.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel, möglicherweise mit Unterkapiteln in Kapitel 2 und 6. Die genauen Titel der Kapitel und Unterkapitel sind im Inhaltsverzeichnis aufgeführt, jedoch noch nicht mit Inhalten gefüllt. Die Zusammenfassungen geben einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, [kurze Beschreibung des Ziels der Arbeit] zu untersuchen. Die Analyse konzentriert sich auf die Identifizierung und Bewertung von [Beschreibung der analysierten Aspekte].
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Effizienzsteigerung im Wundmanagement, interdisziplinäre Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, Kostenoptimierung im extramuralen Bereich, und gegebenenfalls weitere Themen (Thema 4 und 5).
Wie ausführlich sind die Kapitelzusammenfassungen?
Jede Kapitelzusammenfassung umfasst mindestens 75 Wörter und bietet einen zusammenhängenden Überblick über die Hauptthemen, Argumente und Beispiele des jeweiligen Kapitels. Bezüge zu anderen Kapiteln und übergreifenden Themen werden hergestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Wundmanagement, Gesundheitsökonomie, Kostenoptimierung, Qualitätssicherung, Interdisziplinarität, extramurale Versorgung, Ressourcenallokation und evidence-basierte Praxis.
Wo finde ich das detaillierte Inhaltsverzeichnis?
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis befindet sich zu Beginn der HTML-Vorschau und listet alle Kapitel und Unterkapitel auf, allerdings ohne die konkreten Titel der Kapitel und Unterkapitel.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke konzipiert und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Weise.
- Quote paper
- Josef Offenegger (Author), 2009, Gesundheits- (Pflege-) ökonomische Potenziale und Innovationen als Entscheidungshilfe im Gesundheitswesen Österreichs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286118