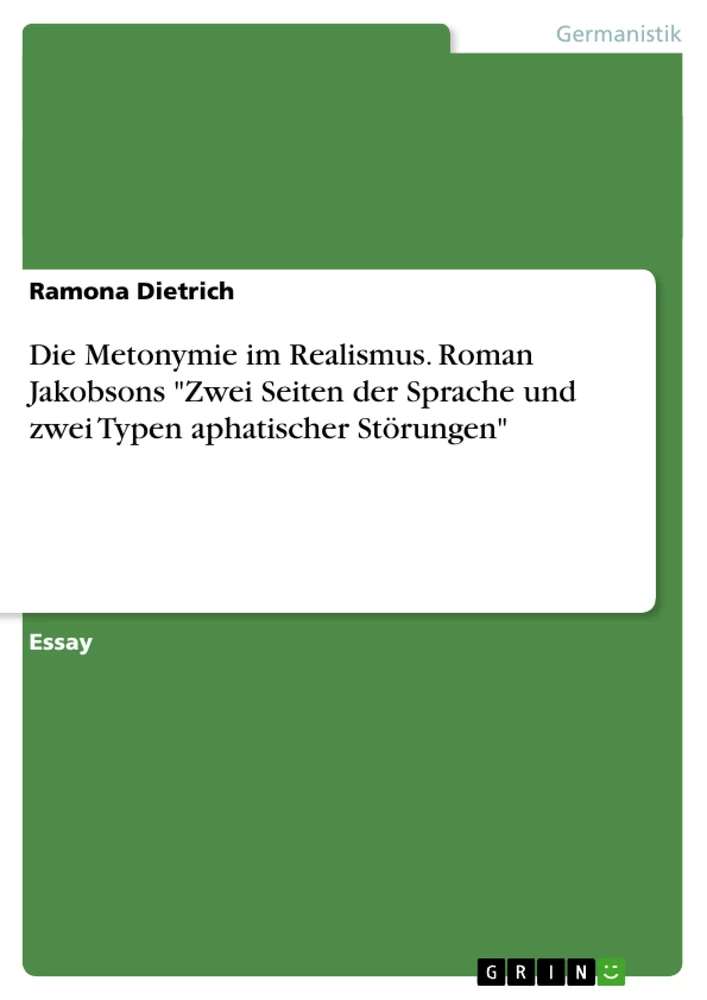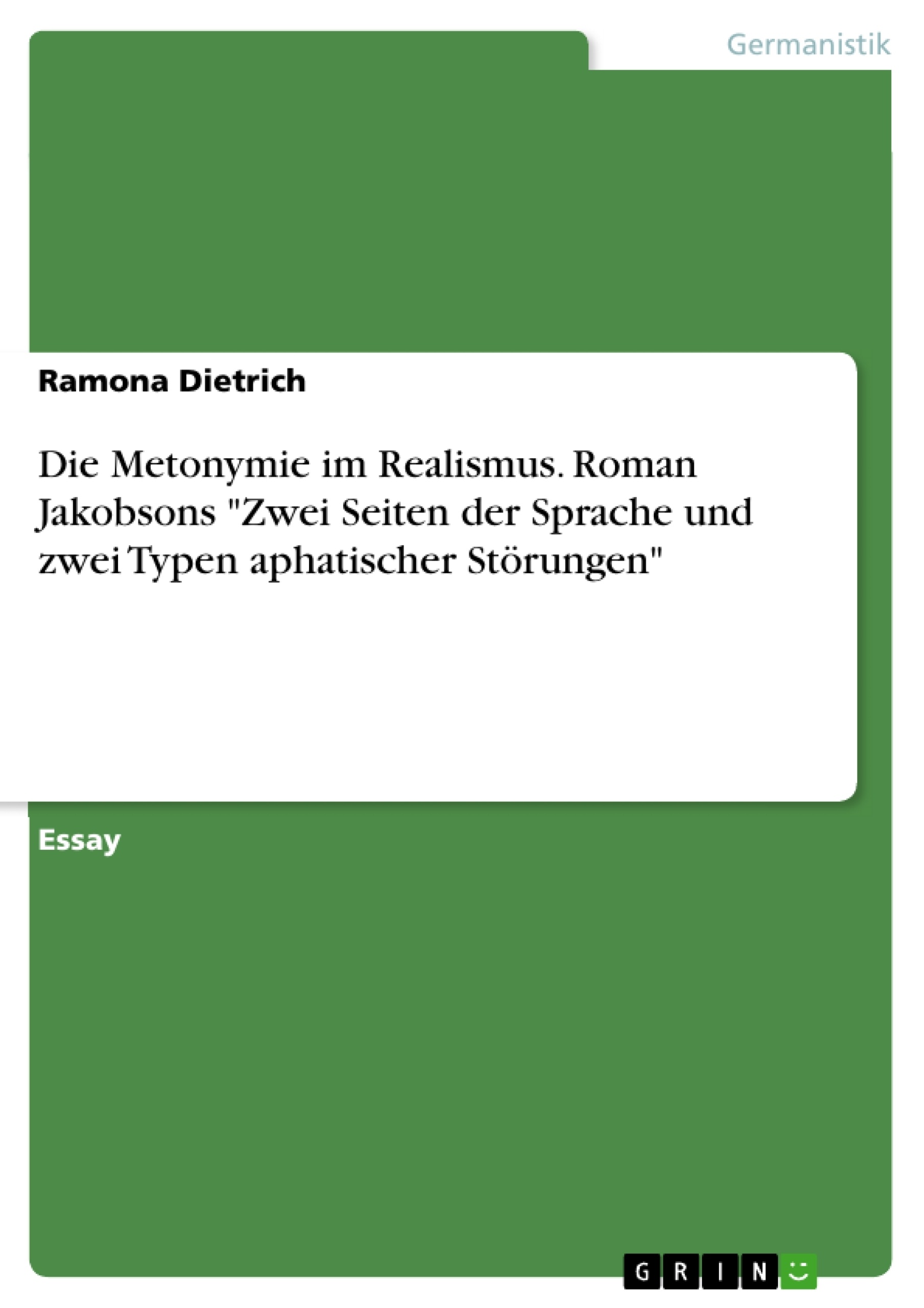Als einer der wichtigsten Vertreter des Strukturalismus hat Roman Jakobson einen großen Einfluss auf die Literaturwissenschaft. Er ist im Bereich der Semiotik und Linguistik tätig, beschäftigt sich mit Aphasien und dem Auftreten von linguistischen Konzepten in der Poesie.
In seinem Text „Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen“ befasst sich Jakobson zusätzlich zur Beschreibung der beiden Aphasietypen Similaritäts- und Kontiguitätsstörung mit dem Thema des Zusammenhangs von Sprachstörungen und Tropen.
Inwiefern findet die Metonymie ihren Platz im Realismus und wodurch entsteht ihr enger Zusammenhang?
Inhaltsverzeichnis
- Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen
- Über den Realismus in der Kunst
- Literaturverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Metonymie im Realismus und analysiert, wie diese Trope im Kontext von Roman Jakobsons Theorie der Sprachstörungen und der beiden Aphasietypen Similaritäts- und Kontiguitätsstörung ihren Platz findet. Die Arbeit beleuchtet den engen Zusammenhang zwischen Metonymie und Realismus und untersucht, wie diese Trope die spezifischen Merkmale des Realismus widerspiegelt.
- Die Metonymie als Trope der Kontiguität
- Der Realismus als literarische Epoche und seine Merkmale
- Die Verbindung von Metonymie und Realismus in der Literatur, Kunst und Sprache
- Die Bedeutung der Metonymie für die Darstellung von Details und die Veranschaulichung der neuen Erzählweise des Realismus
- Die Verbreitung der Metonymie über die Literatur hinaus in Kunst und Film
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit Roman Jakobsons Theorie der Sprachstörungen und den beiden Aphasietypen Similaritäts- und Kontiguitätsstörung. Jakobson stellt die These auf, dass die Metonymie, die auf dem Prinzip der Kontiguität beruht, von Aphatikern verwendet wird, deren Fähigkeit zur Selektion beeinträchtigt ist. Das Kapitel analysiert die Merkmale der Kontiguitätsstörung und zeigt, wie die Metonymie in diesem Kontext zum Tragen kommt.
Das zweite Kapitel untersucht den Realismus als literarische Epoche und seine Merkmale. Es werden die zentralen Aspekte des Realismus, wie die Darstellung der Wirklichkeit, die Übertreibung von Details und die Verwendung von neuen, innovativen Stilmitteln, beleuchtet. Das Kapitel zeigt, wie die Metonymie als Stilmittel die spezifischen Merkmale des Realismus widerspiegelt.
Das dritte Kapitel analysiert die Verbindung von Metonymie und Realismus in der Literatur, Kunst und Sprache. Es werden Beispiele aus der Literatur, wie Tolstojs Anna Karenina, und aus der Kunst, wie der Kubismus, herangezogen, um die Verbreitung der Metonymie über verschiedene Bereiche hinweg zu verdeutlichen. Das Kapitel zeigt, wie die Metonymie als Trope die spezifischen Merkmale des Realismus in verschiedenen Kunstformen widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Metonymie, den Realismus, die Sprachstörungen, die Kontiguitätsstörung, die Similaritätsstörung, die Details, die neue Erzählweise, die Kunst und die Sprache. Der Text beleuchtet den engen Zusammenhang zwischen Metonymie und Realismus und zeigt, wie diese Trope die spezifischen Merkmale des Realismus widerspiegelt.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Zusammenhang sieht Roman Jakobson zwischen Metonymie und Sprachstörungen?
Jakobson stellt die These auf, dass Aphatiker mit einer Similaritätsstörung (Beeinträchtigung der Selektion) verstärkt auf die Metonymie zurückgreifen, da diese auf dem Prinzip der Kontiguität (Nachbarschaft) beruht.
Warum ist die Metonymie die zentrale Trope des literarischen Realismus?
Im Realismus wird die Wirklichkeit oft über Details und räumlich-zeitliche Zusammenhänge dargestellt. Die Metonymie spiegelt diese Erzählweise wider, indem sie Teile für das Ganze setzt oder Ursache und Wirkung verknüpft.
Was sind die zwei Aphasietypen nach Roman Jakobson?
Jakobson unterscheidet zwischen der Similaritätsstörung (Probleme bei der Wortwahl/Metapher) und der Kontiguitätsstörung (Probleme beim Satzbau/Metonymie).
In welchen Kunstformen außer der Literatur findet sich die Metonymie laut der Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, dass die Metonymie auch in der bildenden Kunst (z.B. im Kubismus) und im Film eine entscheidende Rolle für die realistische Darstellung spielt.
Welches literarische Beispiel wird zur Veranschaulichung genutzt?
Die Arbeit zieht unter anderem Tolstojs "Anna Karenina" heran, um die Verwendung metonymischer Details in der realistischen Erzählweise zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Ramona Dietrich (Author), 2014, Die Metonymie im Realismus. Roman Jakobsons "Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286121