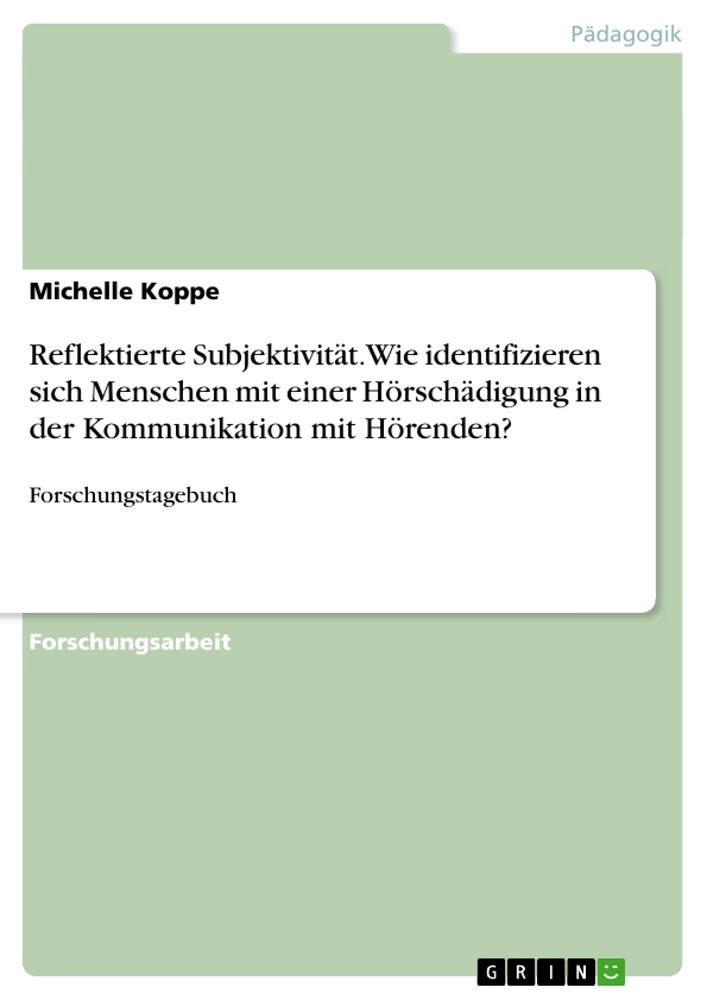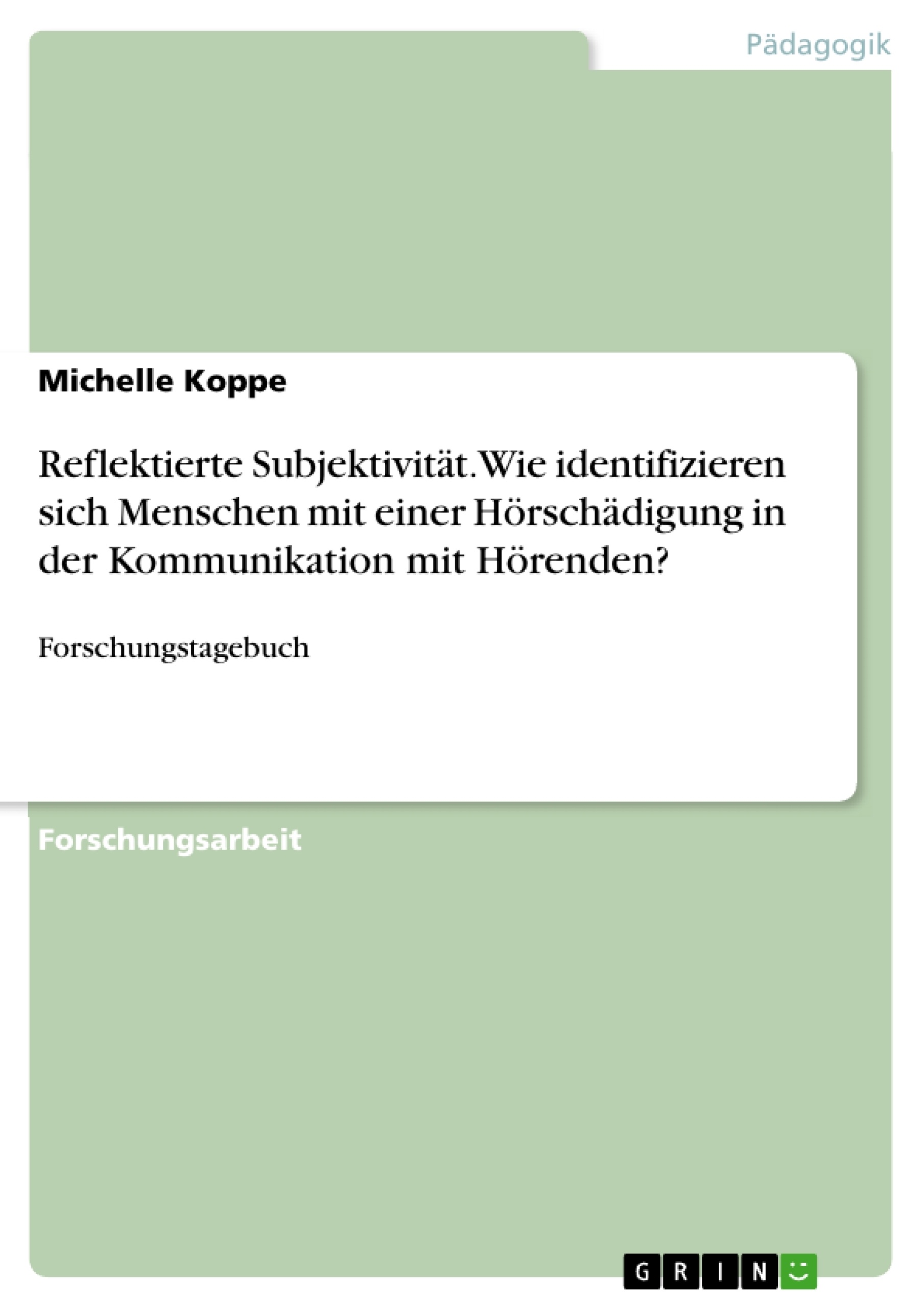Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Gehörlosigkeit, der Identität und der Kommunikation. Sie wurde begleitend zu einem Seminar zu Forschungsmethoden geschrieben und stellt ein Forschungstagebuch zu einer selbst formulierten Forschungsfrage dar. Dabei ist es in dieser Arbeit nebensächlich, die Forschungsfrage tatsächlich zu beantworten. D.h. es geht nicht darum, eine tatsächliche Untersuchung oder Studie durchzuführen, sondern den Weg zu einer Forschungsfrage zu begleiten. Dabei sind eigene Erfahrungen, Interessen, der aktuelle Forschungsstand und allgemeine Überlegungen zur Durchführung von Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Auf dem Weg zur Frage
- Aktueller Forschungsstand
- Wozu die Bearbeitung dieser Forschungsfrage?
- Ergebnis der Forschungsfrage
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Identitätsfindung von Menschen mit einer Hörschädigung im Kontext der Kommunikation mit Hörenden. Die Arbeit analysiert den aktuellen Forschungsstand und untersucht, wie sich Gehörlose in der Interaktion mit Hörenden positionieren und ihre Identität im Umgang mit der Mehrheitsgesellschaft definieren.
- Die Bedeutung der Gebärdensprache als eigenständige Sprache und Kulturträger
- Die Herausforderungen der Kommunikation zwischen Gehörlosen und Hörenden
- Die Rolle von Faktoren wie Alter, sozialer Umgebung und Art der Hörschädigung für die Identitätsbildung
- Die subjektiven Erfahrungen und Perspektiven von Gehörlosen in der Kommunikation
- Die Bedeutung von Inklusion und Akzeptanz in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Gehörlosigkeit, Identität und Kommunikation ein und stellt die Forschungsfrage vor. Im zweiten Kapitel wird der Weg zur Forschungsfrage beleuchtet, wobei die persönlichen Erfahrungen der Autorin mit der Gebärdensprache und der Gehörlosenkultur im Vordergrund stehen. Das dritte Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand und präsentiert verschiedene Perspektiven auf die Identität und das Selbstverständnis von Gehörlosen. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung der Gebärdensprache und den Herausforderungen der Kommunikation zwischen Gehörlosen und Hörenden. Das vierte Kapitel erläutert die Motivation der Autorin, sich mit dieser Forschungsfrage zu beschäftigen, und beleuchtet die persönlichen Erfahrungen, die sie mit Gehörlosen gemacht hat.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Gehörlosigkeit, die Identität, die Kommunikation, die Gebärdensprache, die Hörschädigung, die Inklusion und die Akzeptanz. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Kommunikation zwischen Gehörlosen und Hörenden und untersucht, wie sich Gehörlose in der Interaktion mit Hörenden positionieren und ihre Identität im Umgang mit der Mehrheitsgesellschaft definieren.
Häufig gestellte Fragen
Wie identifizieren sich Menschen mit Hörschädigung in der Kommunikation?
Die Arbeit untersucht die Identitätsfindung von Gehörlosen im Kontext der Interaktion mit der hörenden Mehrheitsgesellschaft.
Welche Bedeutung hat die Gebärdensprache für die Identität?
Gebärdensprache wird nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern als eigenständiger Kulturträger und zentrales Element des Selbstverständnisses Gehörloser betrachtet.
Was sind die größten Barrieren zwischen Gehörlosen und Hörenden?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Kommunikation und die Frage, wie Inklusion und Akzeptanz in der Gesellschaft gefördert werden können.
Welche Rolle spielt die Art der Hörschädigung für das Selbstbild?
Faktoren wie das Alter bei Eintritt der Gehörlosigkeit, die soziale Umgebung und die individuelle Biografie beeinflussen maßgeblich die Identitätsbildung.
Was ist das Ziel dieses "Forschungstagebuchs"?
Es geht primär darum, den methodischen Weg zu einer Forschungsfrage zu begleiten und dabei eigene Erfahrungen sowie den aktuellen Forschungsstand zu reflektieren.
- Quote paper
- Michelle Koppe (Author), 2012, Reflektierte Subjektivität. Wie identifizieren sich Menschen mit einer Hörschädigung in der Kommunikation mit Hörenden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286317