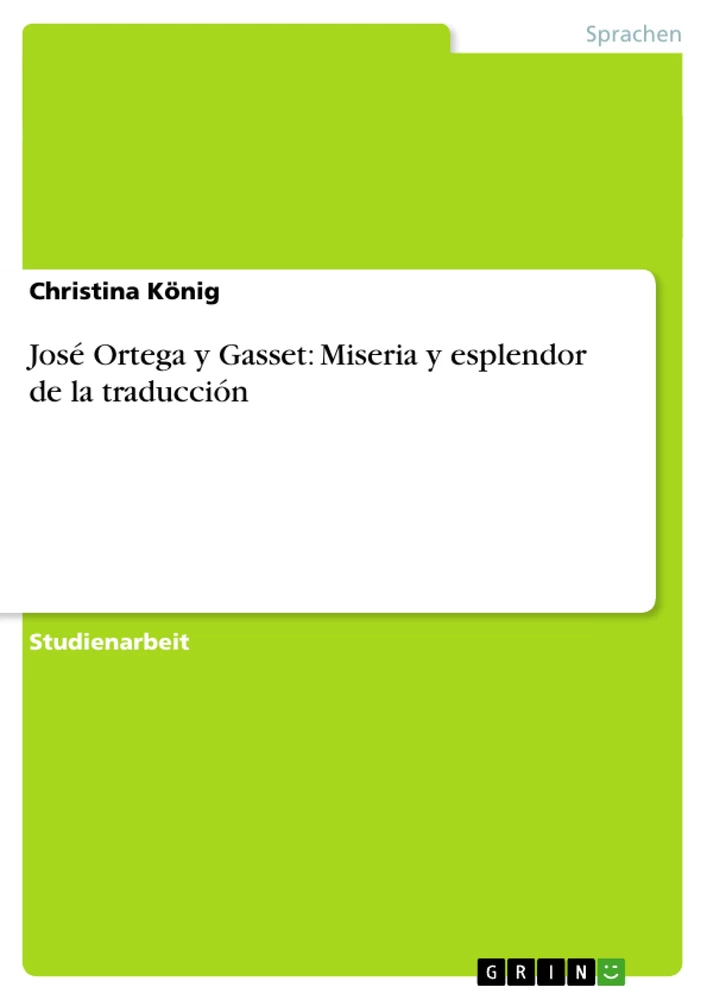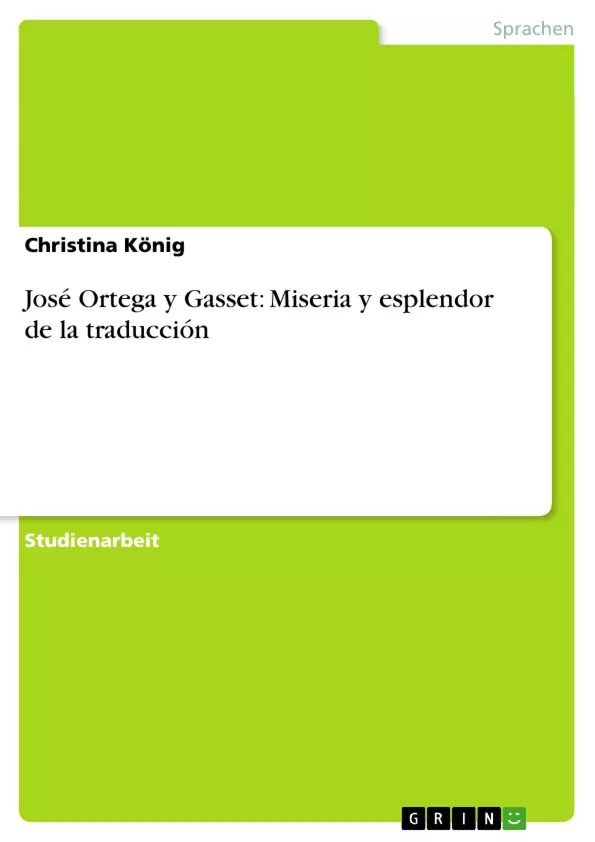Beim Studium einer Sprache werden die einzelnen Gebiete meist streng von einander getrennt. Die Linguisten grenzen sich häufig stark von den Literaturwissenschaftlern ab, und die Philosophie wird davon meist völlig separat abgehandelt. Deswegen ist es besonders interessant, einmal ein Thema wie das Übersetzen, das man sowohl der Literatur- als auch der Sprachwissenschaft zuschreiben könnte, aus philosophischer Sicht zu betrachten. Ortega, den man wahrlich als hervorragenden Literaten bezeichnen kann, setzt sich in seinem Buch Miseria y esplendor de la traducción intensiv damit auseinander, wie problematisch das Übersetzen sei, welche Möglichkeiten aber auch darin verborgen liegen. Zunächst werde ich mich mit Ortegas Auffassung, das Übersetzen sei ein utopisches Unterfangen, beschäftigen, bevor ich dazu übersetzungstheoretische Überlegungen in Betracht ziehen werde. Im Anschluss wird seine These, alles, was der Mensch tut, sei utopisch, auf den Prüfstand gelegt werden, bevor es zur Erläuterung seiner Überlegungen über das Sprechen einer Sprache allgemein und dann basierend auf linguistische Ansätze kommen wird. Nach all diesen eher theoretischen Abhandlungen soll es dann abschließend noch um Ortegas Auffassung, was für Vorzüge das Übersetzen habe, gehen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- I. La miseria - das Elend der Übersetzung
- I.1. Grundproblematik: Übersetzen ist ein utopisches Unterfangen
- I.2. Übersetzungstheoretische Überlegungen hinsichtlich Ortegas Standpunkt
- II. Los dos utopismos – Die zwei Utopismen
- II.1. Der Mensch erreicht nie, was er sich vornimmt, doch das muss nicht negativ sein
- II.2. Der Mensch kann doch erreichen, was er will, und kann sich auch über andere Dinge freuen
- III. Sobre el hablar – Über das Sprechen
- III.1. Sobre el hablar y el callar: Über das Sprechen und das Schweigen
- III.2. No hablamos en serio
- III.3. Linguistische Überlegungen zur Utopiehaftigkeit der Sprache
- IV. El esplendor – der Glanz der Übersetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht José Ortega y Gassets Essay "Miseria y esplendor de la traducción" aus philosophischer Perspektive. Sie beleuchtet Ortegas These, dass Übersetzen ein utopisches Unterfangen ist, und setzt diese These in den Kontext seiner umfassenderen Lebensphilosophie. Die Arbeit analysiert die Schwierigkeiten und Herausforderungen der Übersetzung, berücksichtigt übersetzungstheoretische Ansätze und diskutiert Ortegas Gedanken zum Sprechen und Schweigen.
- Die Utopiehaftigkeit des Übersetzens nach Ortega y Gasset
- Der Einfluss des individuellen Stils des Autors auf die Übersetzung
- Übersetzungstheoretische Modelle im Kontext von Ortegas Philosophie
- Die Rolle der Sprache und des Sprechaktes in Ortegas Überlegungen
- Die Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzung
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die philosophische Betrachtung des Übersetzens als Schnittpunkt von Literatur- und Sprachwissenschaft. Sie skizziert Ortegas Auseinandersetzung mit den Problemen und Potenzialen der Übersetzung in seinem Werk "Miseria y esplendor de la traducción" und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
I. La miseria – das Elend der Übersetzung: Dieses Kapitel beginnt mit der These, dass manche Denker übersetzbar seien, andere nicht. Ortega argumentiert dagegen, dass jedes menschliche Unterfangen, inklusive Übersetzen, utopisch ist, da es ein unerreichbares Ziel verfolgt. Er erklärt den Begriff "utopisch" sowohl im umgangssprachlichen als auch im philosophischen Sinn. Ortega führt aus, dass der Mensch im Gegensatz zu Tieren durch seine Fähigkeit, unerreichbare Ziele zu verfolgen, geprägt ist. Die Unvollkommenheit der Sprache, der individuelle Stil von Autoren und die Schwierigkeiten, auch in wissenschaftlichen Texten perfekte Entsprechungen zu finden, werden als weitere Gründe für die Unmöglichkeit einer perfekten Übersetzung angeführt. Der Unterschied zwischen Alltagssprache und dem Stil eines Literaten wird hervorgehoben als zusätzliche Hürde.
II. Los dos utopismos – Die zwei Utopismen: Dieses Kapitel erweitert Ortegas These von der Utopiehaftigkeit des menschlichen Handelns. Es wird differenziert, ob der Mensch stets zum Scheitern verurteilt ist oder ob es auch positive Aspekte des Strebens nach unerreichbaren Zielen gibt. Die verschiedenen Facetten des Strebens nach Zielen werden diskutiert. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz der menschlichen Natur und auf der Frage, ob das Scheitern ein notwendiger Bestandteil des menschlichen Daseins ist oder nicht.
III. Sobre el hablar – Über das Sprechen: In diesem Kapitel werden Ortegas Überlegungen zum Sprechen und Schweigen analysiert. Es wird die Frage der "Ernsthaftigkeit" im Sprechen behandelt und linguistische Aspekte der Utopiehaftigkeit der Sprache erörtert. Die Komplexität der Sprache und ihre Grenzen werden aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Ortega's Gedanken zum Sprechen werden auf linguistische Ansätze bezogen um die Unmöglichkeit einer präzisen Kommunikation zu zeigen.
IV. El esplendor – der Glanz der Übersetzung: Dieses Kapitel behandelt die positiven Aspekte des Übersetzens, die im Gegensatz zum vorhergehenden Kapitel "das Elend" beleuchtet werden. Es wird auf die Bedeutung und die besondere Herausforderung des Übersetzens eingegangen, ohne jedoch die vorher aufgestellten Thesen zu widerlegen. Der Abschnitt zeigt die positiven Aspekte und die ästhetische Herausforderung von Übersetzungen.
Schlüsselwörter
Übersetzung, Utopie, José Ortega y Gasset, Lebensphilosophie, Sprachphilosophie, Übersetzungstheorie, Linguistik, Literaturwissenschaft, Stil, Kontext, Perfektion, Menschliches Handeln, Sprechen, Schweigen.
Häufig gestellte Fragen zu "Miseria y esplendor de la traducción" von José Ortega y Gasset
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert philosophisch José Ortega y Gassets Essay "Miseria y esplendor de la traducción". Im Mittelpunkt steht Ortegas These, dass Übersetzen ein utopisches Unterfangen ist, und wie sich diese These in seine Lebensphilosophie einfügt. Die Analyse umfasst die Schwierigkeiten der Übersetzung, übersetzungstheoretische Ansätze und Ortegas Gedanken zum Sprechen und Schweigen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Die Utopiehaftigkeit des Übersetzens nach Ortega y Gasset, den Einfluss des individuellen Stils des Autors auf die Übersetzung, übersetzungstheoretische Modelle im Kontext von Ortegas Philosophie, die Rolle der Sprache und des Sprechaktes in Ortegas Überlegungen, sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Kapitel I ("La miseria – das Elend der Übersetzung") behandelt die Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten der Übersetzung. Kapitel II ("Los dos utopismos – Die zwei Utopismen") erweitert die These der Utopiehaftigkeit auf das menschliche Handeln im Allgemeinen. Kapitel III ("Sobre el hablar – Über das Sprechen") analysiert Ortegas Überlegungen zur Sprache und Kommunikation. Kapitel IV ("El esplendor – der Glanz der Übersetzung") beleuchtet die positiven Aspekte und die ästhetische Herausforderung des Übersetzens.
Was ist Ortegas These zur Übersetzung?
Ortega y Gasset argumentiert, dass Übersetzen ein utopisches Unterfangen ist, da es ein unerreichbares Ziel verfolgt. Dies begründet er mit der Unvollkommenheit der Sprache, dem individuellen Stil von Autoren und der Schwierigkeit, perfekte Entsprechungen zu finden. Er betont die Ambivalenz dieser Utopie, indem er sowohl die "Misera" (das Elend) als auch den "Esplendor" (den Glanz) der Übersetzung beleuchtet.
Welche Rolle spielt die Sprache in Ortegas Argumentation?
Die Sprache spielt eine zentrale Rolle. Ortega analysiert die Komplexität und Grenzen der Sprache, die Schwierigkeiten präziser Kommunikation und den Einfluss des individuellen Stils auf die Übersetzbarkeit. Seine Überlegungen zum Sprechen und Schweigen liefern wichtige Einblicke in seine Auffassung von der Utopiehaftigkeit der sprachlichen Darstellung.
Welche übersetzungstheoretischen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene übersetzungstheoretische Ansätze, um Ortegas These zu kontextualisieren und zu analysieren. Obwohl explizit keine bestimmten Theorien genannt werden, ist der Bezug zu Übersetzungstheorie implizit durch die Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen der Übersetzung gegeben.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die Komplexität des Übersetzens auf und verdeutlicht, wie Ortegas These der utopischen Natur des Übersetzens sich in seine umfassendere Lebensphilosophie einfügt. Sie betont sowohl die Herausforderungen als auch die positiven Aspekte des Übersetzens, ohne eine endgültige Lösung für das Problem der perfekten Übersetzung anzubieten. Die Arbeit regt zur Reflexion über die Möglichkeiten und Grenzen sprachlicher Darstellung an.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Übersetzung, Utopie, José Ortega y Gasset, Lebensphilosophie, Sprachphilosophie, Übersetzungstheorie, Linguistik, Literaturwissenschaft, Stil, Kontext, Perfektion, Menschliches Handeln, Sprechen, Schweigen.
- Citation du texte
- Christina König (Auteur), 2004, José Ortega y Gasset: Miseria y esplendor de la traducción, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28636