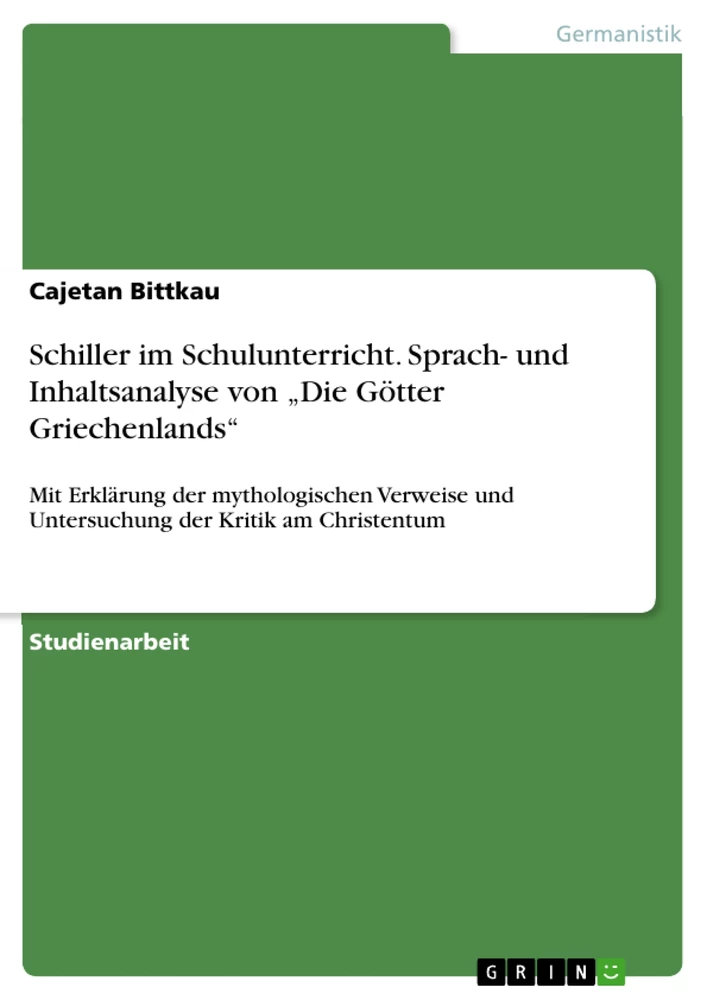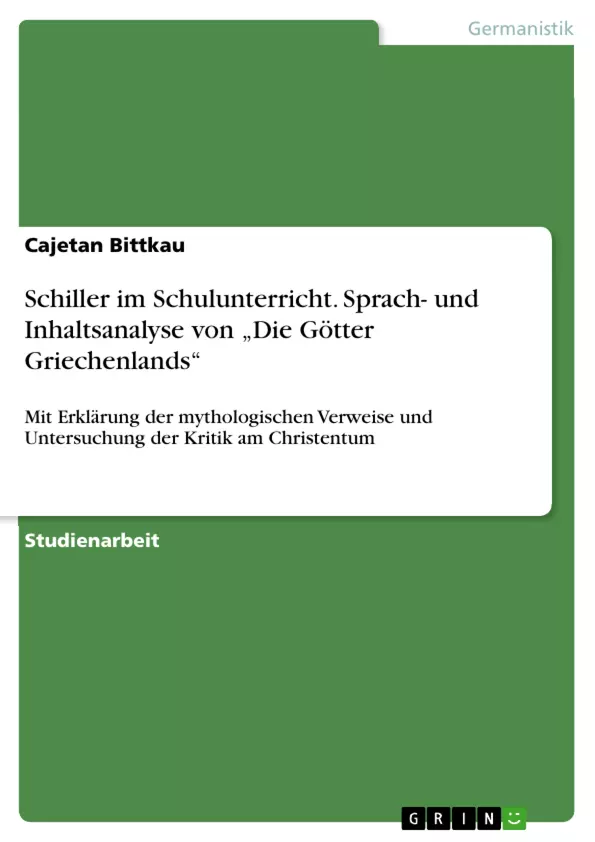Ziel dieser Arbeit ist es, einen detaillierten Überblick über „Die Götter Griechenlands“ in sprachlicher und vor allem inhaltlicher Hinsicht zu geben, mindestens soweit, als es mir für den Schulunterricht nötig erscheint. Die für einen altphilologisch unerfahrenen Leser unverzichtbaren Erklärungen zu Eigennamen, mythologischen Anspielungen oder Begebenheiten befinden sich im Anhang unter den Punkten 1 und 2. Unter Einbeziehung dieser Mythen soll der gedankliche Aufbau des Gedichtes nachvollzogen werden, immer wieder in Hinblick auf die zeitgenössische Rezeption. Dabei wird die Frage der Realitätsbezogenheit des kontrastreichen Gedichts erörtert werden, einerseits in Bezug auf das Bild des klassischen Altertums Griechenlands, das es zeichnet, andererseits auf die Gegenwart des lyrischen Ichs bezogen.
Die Kritik, die Schiller wegen den Elementen seines Gedichts, die als negative Beurteilung des Christentums ausgelegt werden können, erfahren musste, soll auf ihre Berechtigung hin untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- Ziel dieser Arbeit
- Kritik an Schillers Gedicht
- Brauchbarkeit im Schulunterricht
- II. Hauptteil
- 1. Wissenschaftlicher Teil
- 1.1 Form und Sprache
- 1.2 Inhalt und gedanklicher Aufbau
- 2. Didaktischer Teil: Rechtfertigung des Gedichts hinsichtlich der Verwendung im Schulunterricht
- III. Anhang
- 1. Erklärung der Mythologie und Eigennamen der 1. Fassung
- 2. Erklärung der Mythologie und Eigennamen der 2. Fassung
- 3. Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Einblick in Schillers „Die Götter Griechenlands“ zu vermitteln, insbesondere in sprachlicher und inhaltlicher Hinsicht. Der Fokus liegt dabei auf der Relevanz des Gedichts für den Schulunterricht. Das Werk wird analysiert, um den gedanklichen Aufbau, die zeitgenössische Rezeption und die Frage der Realitätsbezogenheit zu beleuchten.
- Die Form und Sprache des Gedichts
- Der Inhalt und gedankliche Aufbau des Gedichts
- Die Kritik an Schillers Gedicht und die Überarbeitung der zweiten Fassung
- Die Relevanz des Gedichts für den Schulunterricht
- Die Bedeutung des Gedichts für das Verständnis des Humanismus und Schillers als Autor
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung legt die Ziele der Arbeit dar, die einen detaillierten Überblick über „Die Götter Griechenlands“ in sprachlicher und inhaltlicher Hinsicht anstreben. Dabei wird die Relevanz des Gedichts für den Schulunterricht betont. Die Einleitung erläutert außerdem die Kritik, die Schiller wegen bestimmter Elemente seines Gedichts erfuhr, und die Überarbeitung der zweiten Fassung. Schließlich wird die Brauchbarkeit des Gedichts im Schulunterricht in Hinblick auf seine Aussagekraft über den Humanismus und die Bedeutung seines Autors erörtert.
II. Hauptteil
1. Wissenschaftlicher Teil
Der wissenschaftliche Teil befasst sich mit der Form und Sprache des Gedichts. Hier werden die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Fassung hinsichtlich der Strophenanzahl, des Versaufbaus und des Reimes hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der sprachlichen Gestaltung und ihrer Bedeutung für die Vermittlung der Inhalte.
Weiterhin analysiert dieser Teil den Inhalt und den gedanklichen Aufbau des Gedichts. Dabei wird die Bedeutung der griechischen Mythen und Götter für die Darstellung des klassischen Zeitalters und den Kontrast zur Gegenwart des lyrischen Ichs untersucht. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle der Liebe, die durch die Göttin Venus Amathusia symbolisiert wird, und ihre Bedeutung für die Gottesauffassung Schillers.
III. Anhang
Der Anhang bietet eine detaillierte Erklärung der Mythologie und Eigennamen, die in der ersten und zweiten Fassung des Gedichts vorkommen. Diese Erklärungen sind für ein tieferes Verständnis des Textes unerlässlich.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: „Die Götter Griechenlands“, Schiller, klassische Literatur, griechische Mythologie, Humanismus, Form und Sprache, Inhalt und gedanklicher Aufbau, Kritik, Überarbeitung, Rezeption, Schulunterricht.
- Citar trabajo
- Str Cajetan Bittkau (Autor), 2005, Schiller im Schulunterricht. Sprach- und Inhaltsanalyse von „Die Götter Griechenlands“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287080