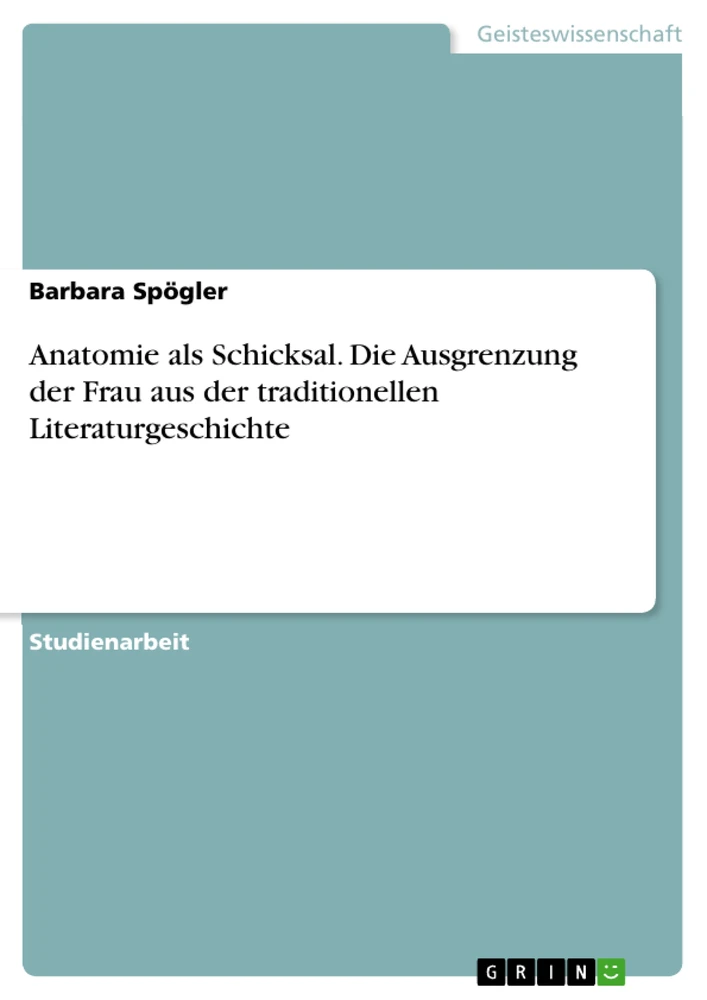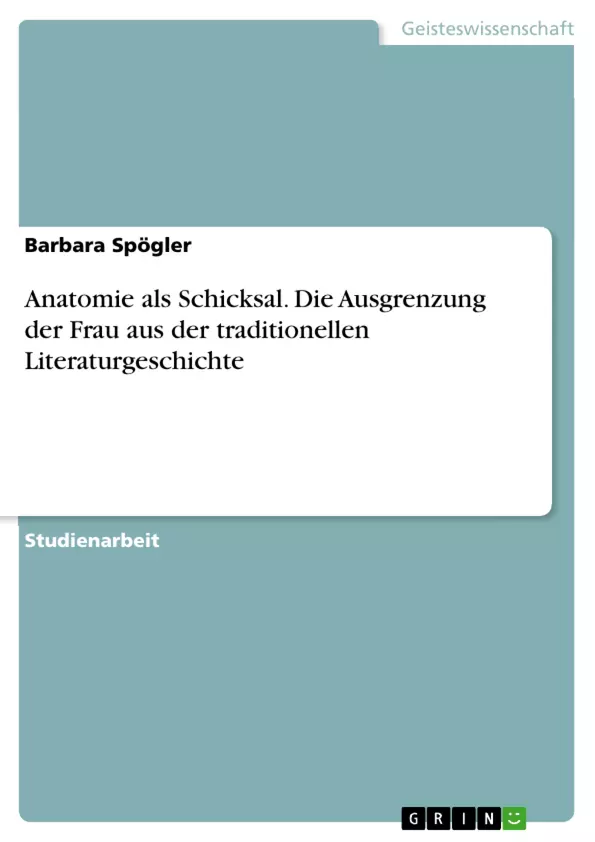Die vorliegende Arbeit untersucht die Darstellungsweisen sowie die effektive Präsenz der Frau in der Kultur- und Literaturgeschichte, wobei insbesondere die Ursachen und Folgen der hierarchischen Geschlechterverhältnisse und der phallogozentrischen Praxis der Literaturwissenschaft analysiert werden sollen.
Nach einer soziohistorischen Einführung über den folgenschweren Paradigmenwechsel in der Geschlechterordnung zu Beginn des 19. Jahrhunderts und die Beschneidung der Frau durch Sigmund Freuds Mythos der kastrierten Frau, wird anhand von zwei Schlüsselautorinnen des Feminismus das Missverhältnis zwischen der Überrepräsentation imaginierter Frauenbilder in den Kulturproduktionen männlicher Autoren und der Absenz und Einflusslosigkeit der realen Frau in der Gesellschaft respektive in der (Literatur)Geschichte herausgearbeitet.
Anschließend werden die Ausgrenzungsmechanismen und Marginalisierungsstrategien der Frau aus der traditionellen Literaturgeschichte durch die Analyse von Literaturgeschichten für den Schul- und Universitätsgebrauch veranschaulicht und einem kritischen Blick unterzogen.
Die Tatsache, dass die Untersuchung unter einer stark feministisch geprägten Perspektive auf die Literaturgeschichte erfolgt, soll keinesfalls die Errungenschaften der Gender Studies übergehen, sondern erscheint mir angesichts des Untersuchungsfeldes marginalisierter Weiblichkeit lediglich als besonders produktiv und aussagekräftig.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Asymmetrische Geschlechterverhältnisse: männliche Macht - weibliche Ohnmacht - Wie kam es dazu?
- 2.1 Das Zwei-Geschlechter-Modell als Beschneidung der Frau
- 2.2 Sigmund Freud und der Mythos der kastrierten Frau als „Container“ männlicher Fantasien
- 3. Die Literaturgeschichte als Spiegel der weiblichen Repression
- 3.1 Virginia Woolfs Suche nach einer weiblichen Schreibtradition
- 3.2 Von der Diskrepanz zwischen „Schattenexistenz und Bilderreichtum“
- 4. Oppressive Repräsentation von Autorinnen in den Literaturgeschichten
- 4.1 Die Autorin als „Sonderkapitel“ der Literaturgeschichte
- 4.2 „Le lien masculin“
- 4.3 Biografismus als Entzug der Autorschaft nach Foucault
- 4.4 „Unter falschem Namen“
- 5. Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung und Präsenz der Frau in der Kultur- und Literaturgeschichte. Im Fokus stehen die Ursachen und Folgen hierarchischer Geschlechterverhältnisse und die phallogozentrische Praxis der Literaturwissenschaft. Analysiert werden soziohistorische Entwicklungen, die Auswirkungen des Zwei-Geschlechter-Modells und die Repräsentation von Autorinnen in traditionellen Literaturgeschichten.
- Die Auswirkungen des Zwei-Geschlechter-Modells auf die Darstellung der Frau.
- Die Unterrepräsentation von Frauen in der Literaturgeschichte und die Gründe dafür.
- Die Strategien der Ausgrenzung und Marginalisierung von Frauen in der Literatur.
- Der Einfluss von Sigmund Freud auf das Verständnis der Frau in der Literatur.
- Die Suche nach einer weiblichen Schreibtradition.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage nach der Darstellung und Präsenz der Frau in der Literaturgeschichte und kündigt den methodischen Ansatz an, der die hierarchischen Geschlechterverhältnisse und die phallogozentrische Perspektive der Literaturwissenschaft kritisch beleuchtet. Es wird ein feministischer Blickwinkel angekündigt, der die marginalisierte Weiblichkeit als Untersuchungsgegenstand in den Mittelpunkt stellt. Die Arbeit verspricht eine soziohistorische Einführung und die Analyse von Ausgrenzungsmechanismen.
2. Asymmetrische Geschlechterverhältnisse: männliche Macht - weibliche Ohnmacht - Wie kam es dazu?: Dieses Kapitel beleuchtet die asymmetrischen Geschlechterverhältnisse anhand von Simone de Beauvoirs Werk "Das andere Geschlecht". Es analysiert die fehlende Gleichberechtigung, die Ausgrenzung des Weiblichen durch die Bipolarität und die Unterordnung der Frau unter den Mann. Das Kapitel untersucht die Ursachen dieser Hierarchie und bereitet die Analyse des Zwei-Geschlechter-Modells vor.
2.1 Das Zwei-Geschlechter-Modell als Beschneidung der Frau: Dieser Abschnitt analysiert den Paradigmenwechsel vom antiken Ein-Geschlechter-Modell zum bürgerlichen Zwei-Geschlechter-Modell des 19. Jahrhunderts. Es wird aufgezeigt, wie die Biologisierung des Geschlechts zu einer patriarchalischen Trennung von Geist und Natur führte, die Frau auf die private Sphäre beschränkte und ihr die Partizipation am öffentlichen Leben verweigerte. Das Zwei-Geschlechter-Modell wird als strategisches männliches Machtinstrument zur Legitimierung der Beschneidung der Frau interpretiert.
3. Die Literaturgeschichte als Spiegel der weiblichen Repression: Dieses Kapitel untersucht, wie die Literaturgeschichte die weibliche Repression widerspiegelt. Es analysiert das Missverhältnis zwischen der Überrepräsentation imaginierter Frauenbilder in männlichen Werken und der Abwesenheit und Einflusslosigkeit realer Frauen in der Gesellschaft und Literaturgeschichte. Es kündigt die Analyse von Literaturgeschichten für den Schul- und Universitätsgebrauch an, um die Ausgrenzungsmechanismen zu veranschaulichen.
4. Oppressive Repräsentation von Autorinnen in den Literaturgeschichten: Das Kapitel analysiert die Ausgrenzungsmechanismen und Marginalisierungsstrategien der Frau in traditionellen Literaturgeschichten. Es untersucht die Darstellung von Autorinnen als „Sonderkapitel“, den „Le lien masculin“, den Biografismus als Entzug der Autorschaft (nach Foucault) und die Publikation „unter falschem Namen“. Die Analyse von Literaturgeschichten verdeutlicht die einseitig männliche Ausrichtung des literarischen Kanons.
Schlüsselwörter
Geschlechterverhältnisse, Literaturgeschichte, Frauen, Repräsentation, Ausgrenzung, Marginalisierung, Feminismus, Phallogozentrismus, Zwei-Geschlechter-Modell, Weiblichkeit, Macht, Autorinnen, Kanon.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Asymmetrische Geschlechterverhältnisse und weibliche Repräsentation in der Literaturgeschichte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung und Präsenz von Frauen in der Kultur- und Literaturgeschichte. Im Fokus stehen die Ursachen und Folgen hierarchischer Geschlechterverhältnisse und die phallogozentrische Praxis der Literaturwissenschaft. Analysiert werden soziohistorische Entwicklungen, die Auswirkungen des Zwei-Geschlechter-Modells und die Repräsentation von Autorinnen in traditionellen Literaturgeschichten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen des Zwei-Geschlechter-Modells auf die Darstellung der Frau, die Unterrepräsentation von Frauen in der Literaturgeschichte und deren Gründe, die Strategien der Ausgrenzung und Marginalisierung von Frauen in der Literatur, den Einfluss von Sigmund Freud auf das Verständnis der Frau in der Literatur und die Suche nach einer weiblichen Schreibtradition.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu asymmetrischen Geschlechterverhältnissen (inkl. Unterkapitel zum Zwei-Geschlechter-Modell und Sigmund Freud), ein Kapitel zur Literaturgeschichte als Spiegel weiblicher Repression, ein Kapitel zur repressiven Repräsentation von Autorinnen in Literaturgeschichten und ein Nachwort.
Wie wird das Zwei-Geschlechter-Modell analysiert?
Das Zwei-Geschlechter-Modell wird als strategisches männliches Machtinstrument interpretiert, welches die Frau durch eine patriarchale Trennung von Geist und Natur auf die private Sphäre beschränkt und ihr die Partizipation am öffentlichen Leben verwehrt. Der Paradigmenwechsel vom antiken Ein-Geschlechter-Modell zum bürgerlichen Zwei-Geschlechter-Modell des 19. Jahrhunderts wird kritisch beleuchtet.
Wie wird die Repräsentation von Autorinnen in der Literaturgeschichte dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Ausgrenzung von Autorinnen durch verschiedene Mechanismen: Ihre Darstellung als „Sonderkapitel“, den „Le lien masculin“ (die männliche Verbindung), den Biografismus als Entzug der Autorschaft (nach Foucault) und die Publikation „unter falschem Namen“. Die einseitig männliche Ausrichtung des literarischen Kanons wird deutlich gemacht.
Welche Rolle spielt Sigmund Freud?
Die Arbeit untersucht den Mythos der kastrierten Frau in Freuds Werk und analysiert, wie seine Theorien das Verständnis der Frau in der Literatur beeinflusst haben und zur Perpetuierung patriarchaler Strukturen beitragen.
Welche methodische Perspektive wird eingenommen?
Die Arbeit nimmt eine feministische Perspektive ein und beleuchtet die marginalisierte Weiblichkeit kritisch. Sie kombiniert soziohistorische Analysen mit der Untersuchung literaturwissenschaftlicher Ausgrenzungsmechanismen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geschlechterverhältnisse, Literaturgeschichte, Frauen, Repräsentation, Ausgrenzung, Marginalisierung, Feminismus, Phallogozentrismus, Zwei-Geschlechter-Modell, Weiblichkeit, Macht, Autorinnen, Kanon.
- Citar trabajo
- Barbara Spögler (Autor), 2013, Anatomie als Schicksal. Die Ausgrenzung der Frau aus der traditionellen Literaturgeschichte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287347