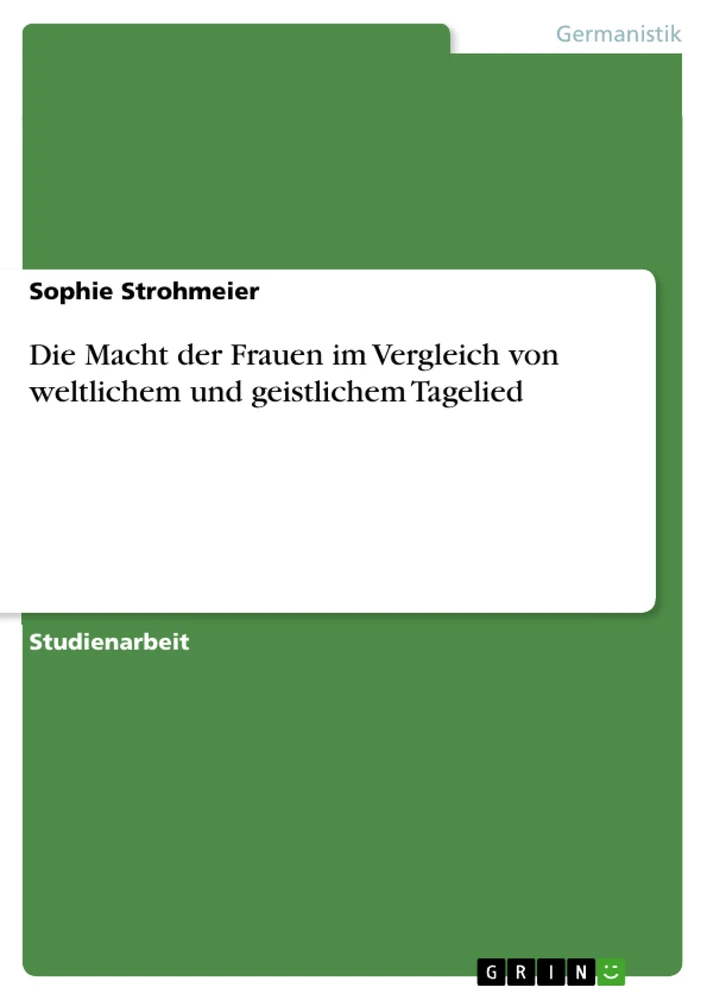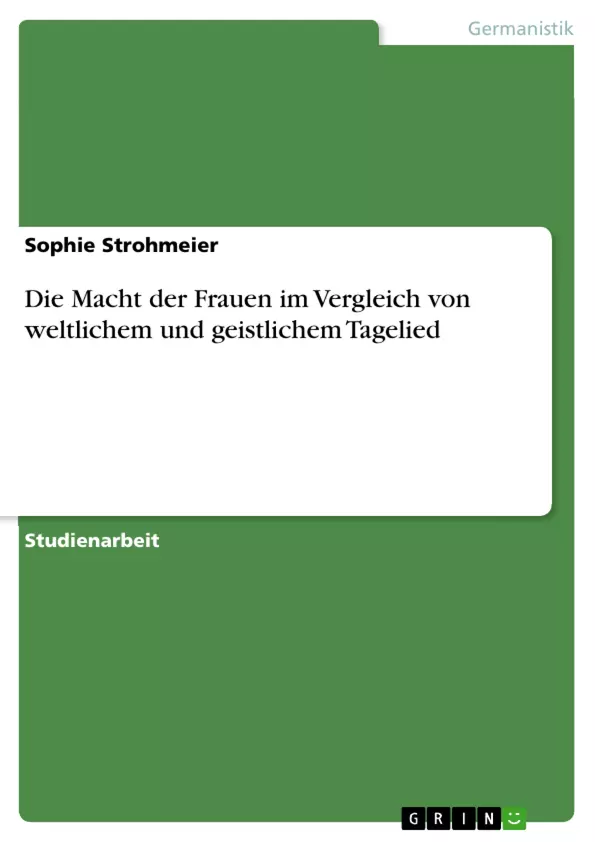Der Beginn volkssprachlicher Literatur ist zwar aufgrund der wenigen Überlieferungen schwer zu datieren, fand aber recht sicher in den Zentren der Bildung im Mittelalter, in Klöstern, statt, war also eindeutig geistlich ausgerichtet (Schiewer 2011: S.10) . Geistlich kommt hier von lateinisch "spiritalis", also alles was von Geist ergriffen und auf Geistliches ausgerichtet ist (Huber 2000: S.3). Das Geistliche und der Geist beziehen sich im Deutschland des Mittelalters natürlich auf den christlichen Gott. Um 1000 n.Chr. war die Produktion von Literatur nicht mehr ausschließlich hinter Klostermauern verborgen, sondern wurde an den, auch für Laien zugänglichen, Bischofshof verlegt. Die ersten Überlieferungen volkssprachlicher, weltlich ausgerichteter Dichtung, wie beispielsweise das „Annolied“, das weltliche und geistliche Elemente verknüpft, stammen aus dieser Zeit und bestätigen die Entwicklung einer „weltlich- geistlichen Mischkultur“ (Schiewer 2011: S.15).
Die weltliche Literatur ist also nicht nur als Begriff von der geistlichen Literatur abgeleitet: Auch allgemein ist weltlich alles was nicht- geistlich ist, aber umgekehrt ist nicht alles geistlich was nicht- weltlich ist. Die beiden Begriffe stehen also in einer Polarität zueinander, die sie gleichzeitig definiert (Huber 2000: S.3f.)- sie können ohne ihren Gegensatz nicht existieren. Trotzdem lässt diese Polarität sehr verschiedene Perspektiven bei der Definition von „Weltlichem“ und „Geistlichem“ für den Einzelnen zu. In der Entwicklung der volkssprachlichen Literatur in Deutschland entstanden, während der Etablierung der höfischen Kultur die ersten weltlichen und geistlichen Dichtungen getrennt voneinander, wie die „Kaiserchronik“ und der Eneas-Roman von Heinrich von Veldeke (Schiewer 2011: S.16). An den Fürstenhöfen war Produktion und Vortrag von Literatur eine wichtige Institution geworden und es gab immer mehr Literati unter den Adligen, was sich durch die Überlieferung von vielen Autornamen aus dieser Zeit recht gut belegen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- A) Entstehung der volkssprachlichen geistlichen und weltlichen Literatur.
- B) Das weltliche Tagelied.
- I. Das weltliche Tagelied „Sîne klawen“.
- II. Das geistliche Tagelied „vrône wahter nû erwecke“
- III. Irdische und geistliche Liebe im Mittelalter.
- IV. Die Liebe in den beiden Gedichten.
- V. Geschlechterkonzeptionen im Mittelalter.
- VI. Geschlechtertausch und Machtverhältnisse in der deutschen Literatur des Mittelalters
- 1. Definition der Macht.
- 2. Mächtige Frauen in der Literatur des deutschen Mittelalters.
- 3. Die Macht der Frau im geistlichen Tagelied.
- 4. Die Macht der Frau im weltlichen Tagelied.
- 5. Resümee.
- C) Das geistliche Tagelied.
- E) Vergleich des geistlichen und weltlichen Tagelieds.
- F) Veränderung des Tagelieds und somit der Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau im späten Mittelalter.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Frau in weltlichen und geistlichen Tageliedern des Mittelalters. Sie analysiert die unterschiedlichen Geschlechterkonzeptionen und Machtverhältnisse, die in diesen Texten zum Ausdruck kommen.
- Entstehung und Entwicklung der volkssprachlichen Literatur im Mittelalter.
- Charakteristika des weltlichen und geistlichen Tagelieds.
- Liebe und Geschlechterrollen in der Literatur des Mittelalters.
- Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau in Tageliedern.
- Veränderungen in der Darstellung von Macht und Geschlecht im späten Mittelalter.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel A: Dieses Kapitel behandelt die Entstehung der volkssprachlichen Literatur im Mittelalter, wobei der Schwerpunkt auf die Entstehung geistlicher und weltlicher Texte liegt. Es zeigt die Entwicklung von Literatur aus Kloster- und Bischofshöfen, die Entstehung von „weltlich- geistlichen Mischkultur“ und die Etablierung von festen Genres wie dem Minnesang.
- Kapitel B: Dieses Kapitel befasst sich mit dem weltlichen Tagelied. Es definiert die Grundmerkmale des Genres, darunter der Dialog zwischen einem Liebespaar und die Spannung, die durch die gesellschaftliche Ablehnung ihrer Liebe entsteht. Das Kapitel beleuchtet auch die Rolle des Sängers als Erzähler und die narrative Struktur des Tagelieds.
- Kapitel C: Dieses Kapitel widmet sich dem geistlichen Tagelied. Es analysiert die spezifischen Merkmale des Genres, wie die Verwendung religiöser Motive und die Verbindung von Liebe und Gottesverehrung. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Liebe im geistlichen Kontext.
- Kapitel E: Dieses Kapitel vergleicht das weltliche und geistliche Tagelied. Es untersucht die Unterschiede in den Darstellungen von Liebe, Geschlechterrollen und Machtverhältnissen in beiden Genres.
- Kapitel F: Dieses Kapitel untersucht, wie sich die Darstellung von Machtverhältnissen zwischen Mann und Frau im späten Mittelalter verändert. Es zeigt auf, wie das Tagelied als Genre im Wandel der Zeit neue Formen und Inhalte annimmt.
Schlüsselwörter
Tagelied, Mittelalter, deutsche Literatur, geistliche Literatur, weltliche Literatur, Geschlechterrollen, Machtverhältnisse, Liebe, Religion, Minnesang, höfische Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ursprung der volkssprachlichen Literatur im Mittelalter?
Die Literatur entstand primär in Klöstern und war geistlich ausgerichtet, bevor sie sich um 1000 n. Chr. an die Bischofshöfe verlagerte und auch für Laien zugänglich wurde.
Was charakterisiert ein weltliches Tagelied?
Ein weltliches Tagelied beschreibt meist den Dialog eines Liebespaares bei Tagesanbruch und die Spannung durch die gesellschaftliche Ablehnung ihrer Liebe.
Wie unterscheiden sich geistliche und weltliche Tagelieder?
Während weltliche Lieder irdische Liebe thematisieren, nutzen geistliche Tagelieder religiöse Motive und verbinden Liebe mit der Gottesverehrung.
Welche Rolle spielt die Macht der Frau in diesen Texten?
Die Arbeit analysiert die spezifischen Machtverhältnisse und Geschlechterkonzeptionen, die in den Werken „Sîne klawen“ und „vrône wahter nû erwecke“ zum Ausdruck kommen.
Wie veränderten sich die Machtverhältnisse im späten Mittelalter?
Kapitel F untersucht den Wandel des Genres und wie sich die Darstellung der Beziehung zwischen Mann und Frau über die Zeit hinweg transformierte.
- Quote paper
- Sophie Strohmeier (Author), 2013, Die Macht der Frauen im Vergleich von weltlichem und geistlichem Tagelied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287837