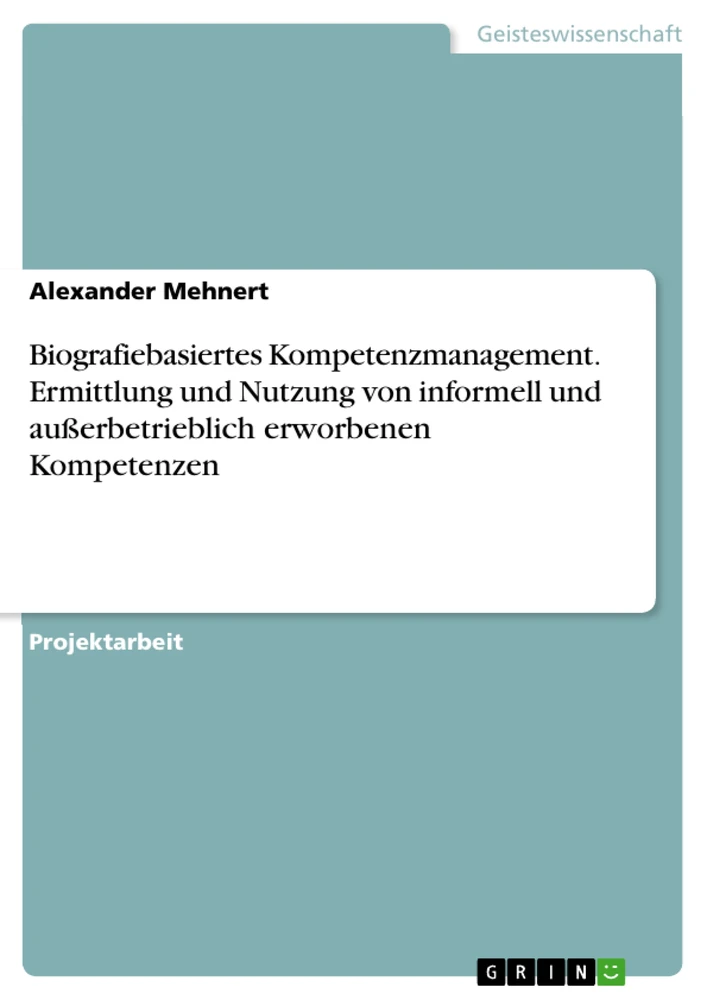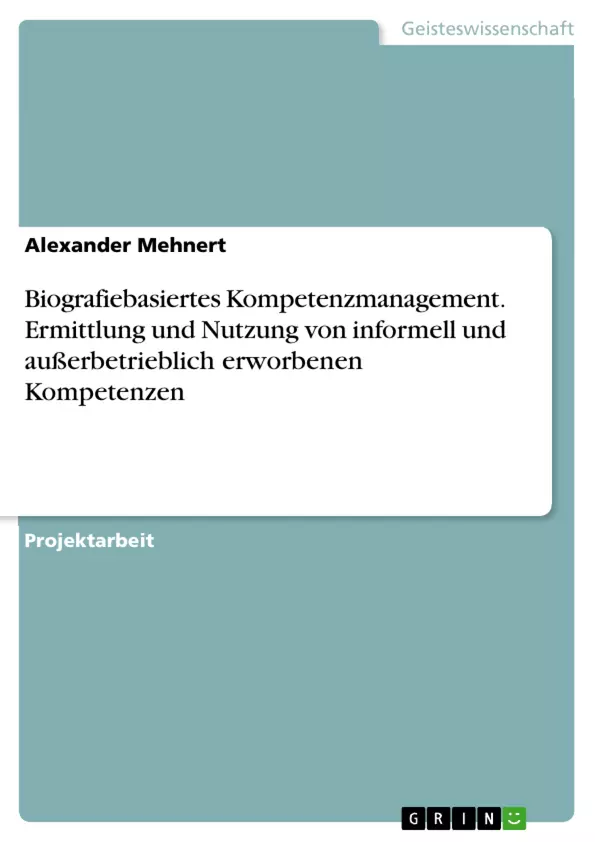Beschäftigte entwickeln sich stetig weiter. Nur ein kleiner Teil dieser Entwicklung findet im Betrieb statt. Vielmehr bauen sie ihre neuen Kompetenzen in der Freizeit auf.
Schafft es das Unternehmen, die Beschäftigten entsprechend diesen privat erworbenen Kompetenzen einzusetzen, gewinnen beide. Das Unternehmen bindet einen hochmotivierten Mitarbeiter, den es interessengerecht einsetzen kann. Der Mitarbeiter bekommt eine Arbeit, die seinen Neigungen entspricht.
Das Kompetenzmanagement macht persönliche Fortschritte sicht- und vergleichbar und trägt durch die Ermöglichung der Selbstverwirklichung zur Berufszufriedenheit bei.
Diese Arbeit gliedert sich in drei Teile: Nach einer Einführung in die allgemeine Theorie von Kompetenzen werden in einem zweiten Schritt derzeit genutzte Verfahren zur Kompetenzmessung vorgestellt und im Vergleich gegenübergestellt. Der dritte Teil schließlich widmet sich der praktischen Entwicklung eines Kompetenzmanagementsystems und ermöglicht so die Beantwortung der Grundfrage, wie Kompetenzen, die Beschäftigte im Verlauf ihrer Biografie erworben haben, erkannt und im betrieblichen Umfeld nutzbar gemacht werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Kompetenzmanagement – Theorie
- Fertigkeiten, Qualifikationen und Kompetenzen – eine Abgrenzung
- Lernformen
- Kompetenzdimensionen
- Einstufung der Kompetenzen
- Kompetenzanalyseverfahren
- Kategorisierung und Auswahl von Kompetenzmodellen
- Kompetenzstrukturmodelle
- Kompetenzniveaumodelle
- Gegenüberstellung der Verfahren
- Kompetenzmanagement in der Praxis
- Zielsetzung und Implementierung definieren
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Datenschutz
- Kollektives Arbeitsrecht
- Definition des Kompetenzmodells
- Erstellung von Soll-Profilen
- Kompetenzdiagnostik
- Quantitative Erfassung
- Qualitative Analyse
- Kompetenzen visualisieren
- Evaluation des Kompetenzmodells
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Kompetenzmanagement und zeigt auf, wie Unternehmen die Kompetenzen ihrer Beschäftigten erkennen, erfassen und im betrieblichen Umfeld optimal nutzen können. Dabei liegt der Fokus auf dem biografiebasierten Ansatz, der die individuellen Kompetenzen der Mitarbeiter unabhängig von formalen Qualifikationen berücksichtigt.
- Definition und Abgrenzung von Kompetenzen, Fähigkeiten und Qualifikationen
- Analyse von Methoden und Verfahren zur Kompetenzmessung
- Entwicklung eines Kompetenzmanagementsystems in der Praxis
- Herausforderungen und Chancen des Kompetenzmanagements in einem sich ständig wandelnden Arbeitsumfeld
- Bedeutung von Lebenslangem Lernen und informellen Qualifikationserwerb für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der technologischen Entwicklung für Unternehmen ergeben und zeigt die Bedeutung von Lebenslangem Lernen sowie der Nutzung informeller Kompetenzen auf.
- Kompetenzmanagement – Theorie: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung von Kompetenz, Fähigkeit und Qualifikation und stellt verschiedene Lernformen sowie Kompetenzdimensionen vor.
- Kompetenzanalyseverfahren: Das Kapitel befasst sich mit verschiedenen Verfahren zur Kompetenzmessung und zeigt die Vor- und Nachteile von Kompetenzstrukturmodellen und Kompetenzniveaumodelle auf.
- Kompetenzmanagement in der Praxis: Dieses Kapitel behandelt die praktische Entwicklung eines Kompetenzmanagementsystems, beginnend mit der Zielsetzung und Implementierung bis hin zur Evaluation des Modells. Es werden auch die rechtlichen Rahmenbedingungen im Kontext von Datenschutz und Arbeitsrecht beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kompetenzmanagement, Lebenslanges Lernen, Kompetenzmessung, Kompetenzmodell, Biografiebasiertes Kompetenzmanagement, Kompetenzdiagnostik, Kompetenzentwicklung, Rechtliche Rahmenbedingungen, Datenschutz, Arbeitsrecht
Häufig gestellte Fragen
Was ist biografiebasiertes Kompetenzmanagement?
Es ist ein Ansatz, der nicht nur formale Qualifikationen, sondern auch informell und privat erworbene Kompetenzen aus der gesamten Lebensbiografie eines Mitarbeiters erfasst und nutzt.
Warum sollten Unternehmen informelle Kompetenzen nutzen?
Die Nutzung privat erworbener Fähigkeiten steigert die Motivation der Mitarbeiter, ermöglicht eine passgenauere Besetzung von Stellen und erhöht die Flexibilität des Unternehmens.
Wie unterscheiden sich Qualifikation und Kompetenz?
Qualifikationen sind formale Nachweise (z.B. Zeugnisse), während Kompetenzen die tatsächliche Fähigkeit beschreiben, Wissen und Fertigkeiten in komplexen Situationen erfolgreich anzuwenden.
Welche rechtlichen Aspekte sind beim Kompetenzmanagement wichtig?
Besonders relevant sind der Datenschutz bei der Erfassung persönlicher Daten sowie das kollektive Arbeitsrecht (Mitbestimmung des Betriebsrats).
Welche Verfahren zur Kompetenzmessung gibt es?
Es wird zwischen Kompetenzstrukturmodellen (Inhalte) und Kompetenzniveaumodellen (Entwicklungsstufen) unterschieden, die quantitativ oder qualitativ ausgewertet werden können.
- Quote paper
- Alexander Mehnert (Author), 2013, Biografiebasiertes Kompetenzmanagement. Ermittlung und Nutzung von informell und außerbetrieblich erworbenen Kompetenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288039