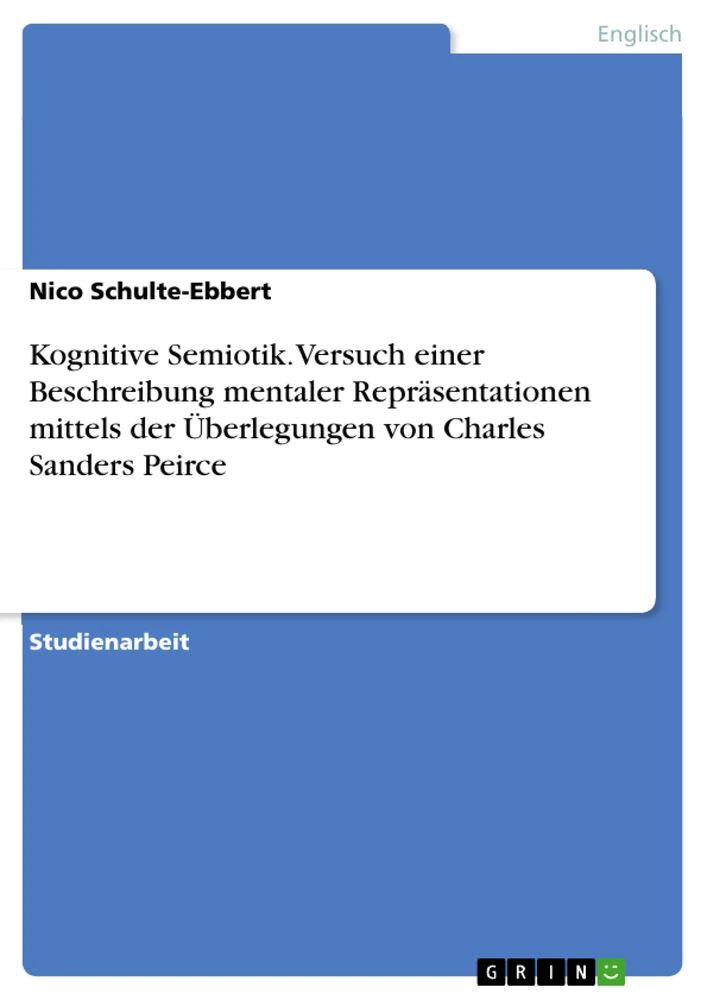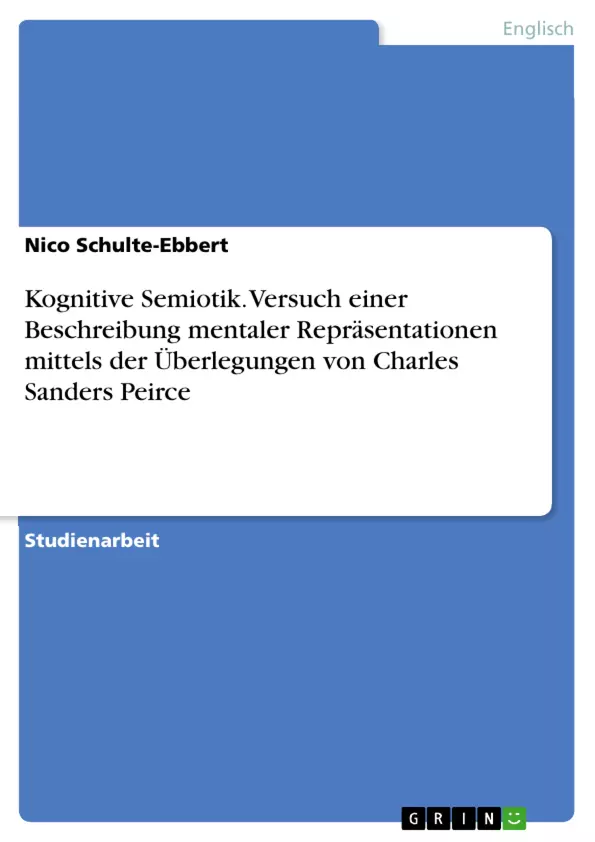Das oftmals Leibniz zugeschriebene sensualistische Diktum Thomas’ »nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu«, demzufolge alle Erkenntnis aus subjektiv gefärbten Sinnesdaten und neurophysiologischen Prozessen abgeleitet wird, kann als wegweisender Impuls einer auf die (frühen) Arbeiten Charles Sanders Peirce’ Bezug nehmenden kognitiven Semiotik betrachtet werden, deren operationale Struktur in der vorliegenden Studie zu skizzieren versucht werden soll. Dabei sieht sich das Vorhaben mit zwei epistemologischen Hindernissen konfrontiert: Zum einen steckt die Disziplin der Kognitiven Semiotik noch weitgehend in den Kinderschuhen, was terminologische und definitorische Differenzen der mit ihr verknüpften Forschungsrichtungen (Kognitive Semantik, Kognitive Linguistik, Hirnforschung et al.) sowie überdies zahlreiche zu attestierende innere Inkonsistenzen, methodische Unzulänglichkeiten und konzeptuelle Ausuferungen zur Folge hat; zum anderen erweist sich das umfangreiche Werk Peirce’ als schier überwältigend und kaum handhabbar, zumal sich etwa drei Viertel der Peirceschen Schriften noch im Nachlaß befinden.
Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit liegt im Versuch einer Fruchtbarmachung und Anwendung des in eine hochgradig komplexe semiotische Erkenntnistheorie eingebetteten Peirceschen Begriffsinstrumentariums zur Beschreibung mentaler Repräsentationen. Dabei sei die These vertreten, daß weder ein analog-ikonisches noch ein neurophysiologisch-indexikalisches noch ein propositional-symbolisches Modell kognitive Darstellungen überzeugend darzulegen vermag; plausibler erscheint hingegen ein Modell, das das Zusammenspiel unterschiedlicher Zeichenarten toleriert, die als unterschiedliche Repräsentationsmodi geistiger Inhalte aufzufassen sind. Vor dem Hintergrund dieser These werden zunächst einige gängige Modelle mentaler Repräsentationen kritisch vorgestellt (Kapitel II). Im Anschluß daran wird das Zeichenkonzept Peirce’ in groben Zügen darzustellen versucht; der für die Thematik wichtigen Subklassifikationen soll dabei verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden (Kapitel III). In Kapitel IV liegt das Augenmerk auf der für die Peircesche Semiotik so wichtigen Semiose und ihrer Bedeutung für mentale Operationen. Das abschließende fünfte Kapitel präsentiert die vom frühen Peirce aufgestellten vier Thesen – die sogenannten ›vier Unvermögen‹ – bezüglich der Grenzen mentaler Fähigkeiten. Ein kurzes Fazit (Kapitel VI) summiert die wichtigsten Punkte der Studie.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- I. Einführung in die Thematik
- II. Mentale Repräsentationen
- III. Allgemeine Zeichenlehre
- 1. Die Universalkategorien des Phanerons
- 2. Peirce' triadische Determinationsrelation
- 3. Klassifikation der Zeichen
- IV. Denken, Geist und Quasi-Geist: Peirce' Semiose-Konzept
- V. Peirce' Theory of Cognition
- VI. Fazit
- VII. Siglen- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studie beabsichtigt, die Theorie Charles Sanders Peirce' zur Beschreibung mentaler Repräsentationen zu untersuchen. Sie stellt die These auf, dass weder ein analog-ikonisches, noch ein neurophysiologisch-indexikalisches, noch ein propositional-symbolisches Modell kognitive Operationen ausreichend erklären kann. Das Hauptziel liegt darin, das komplexe semiotische Begriffsinstrumentarium Peirce' zur Beschreibung mentaler Repräsentationen fruchtbar zu machen.
- Analyse der Grenzen gängiger Modelle mentaler Repräsentationen
- Darstellung des Zeichenkonzepts Peirce' und seiner Subklassifikationen
- Bedeutung der Semiose für mentale Operationen
- Untersuchung der Grenzen mentaler Fähigkeiten im Kontext von Peirce' "vier Unvermögen"
- Veranschaulichung, wie verschiedene Zeichenarten als Repräsentationsmodi geistiger Inhalte betrachtet werden können
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einführung in die Thematik: Diese Einleitung beleuchtet die Bedeutung des sensualistischen Diktums "nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu" für die kognitive Semiotik und skizziert die Herausforderungen, die sich aus der Komplexität des Peirceschen Werkes und dem jungen Entwicklungsstand der Disziplin ergeben.
- II. Mentale Repräsentationen: Dieses Kapitel präsentiert eine kritische Analyse gängiger Modelle mentaler Repräsentationen und zeigt auf, dass diese alle auf zeichentheoretischen Fundamenten beruhen.
- III. Allgemeine Zeichenlehre: Dieses Kapitel widmet sich einer grundlegenden Darstellung des Zeichenkonzepts Peirce' und untersucht insbesondere seine Subklassifikationen.
- IV. Denken, Geist und Quasi-Geist: Peirce' Semiose-Konzept: Dieser Abschnitt erörtert die wichtige Rolle der Semiose in der Peirceschen Semiotik und ihre Bedeutung für mentale Operationen.
- V. Peirce' Theory of Cognition: Dieses Kapitel präsentiert die von Peirce aufgestellten "vier Unvermögen" als Aussagen über die Grenzen mentaler Fähigkeiten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf zentrale Themen wie kognitive Semiotik, mentale Repräsentationen, semiotische Erkenntnistheorie, Zeichenlehre, Charles Sanders Peirce, Semiose, Phaneroskopie, Ikonizität, Indexikalität, Similarität, Kontiguität, "vier Unvermögen".
Häufig gestellte Fragen
Was ist kognitive Semiotik?
Es ist eine Disziplin, die untersucht, wie mentale Repräsentationen und Denkprozesse als Zeichenprozesse (Semiose) verstanden werden können, basierend auf der allgemeinen Zeichentheorie.
Welche Rolle spielt Charles Sanders Peirce in dieser Studie?
Peirce' triadische Zeichentheorie dient als Grundlage, um zu erklären, wie der Geist Informationen verarbeitet und in Form von Ikonen, Indizes und Symbolen repräsentiert.
Was sind die „vier Unvermögen“ nach Peirce?
Peirce stellte Thesen auf, die die Grenzen mentaler Fähigkeiten beschreiben, unter anderem dass wir keine Fähigkeit zur Intuition im Sinne einer erkenntnisunabhängigen Schau haben und dass alles Denken in Zeichen erfolgt.
Warum reicht ein rein neurophysiologisches Modell laut der Studie nicht aus?
Die Studie argumentiert, dass kognitive Inhalte durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Repräsentationsmodi (ikonisch, indexikalisch, symbolisch) entstehen, die rein physische Prozesse allein nicht vollständig erklären können.
Was bedeutet der Satz „nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu“?
Es bedeutet: „Nichts ist im Verstand, was nicht zuvor in den Sinnen war.“ Dies unterstreicht, dass alle Erkenntnis auf Sinnesdaten und deren semiotischer Verarbeitung beruht.
- Quote paper
- Nico Schulte-Ebbert (Author), 2010, Kognitive Semiotik. Versuch einer Beschreibung mentaler Repräsentationen mittels der Überlegungen von Charles Sanders Peirce, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288235