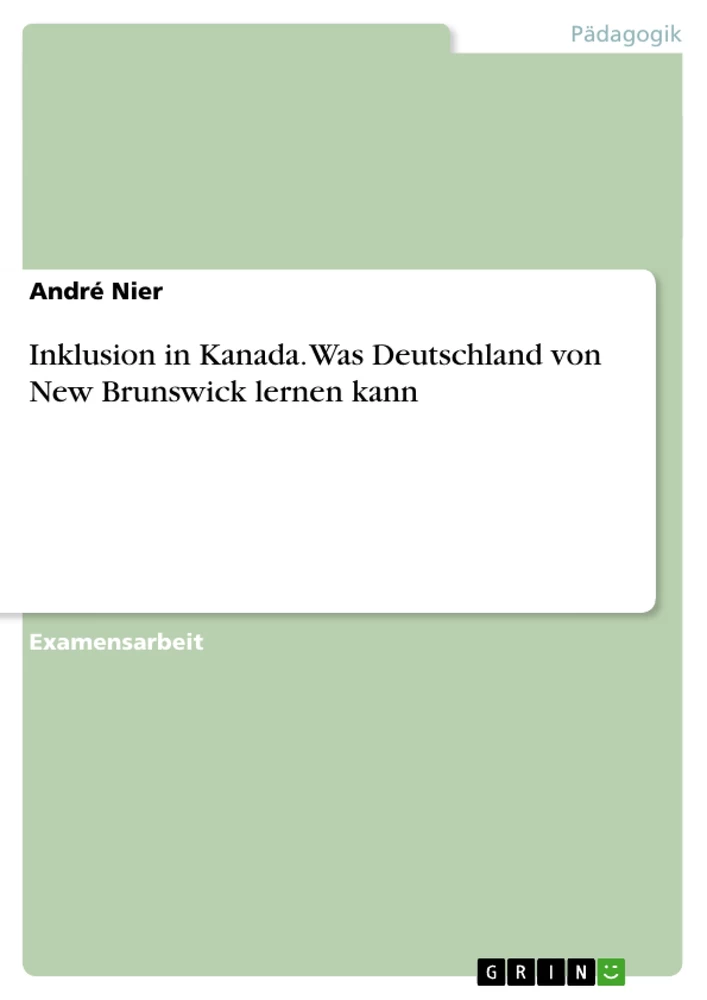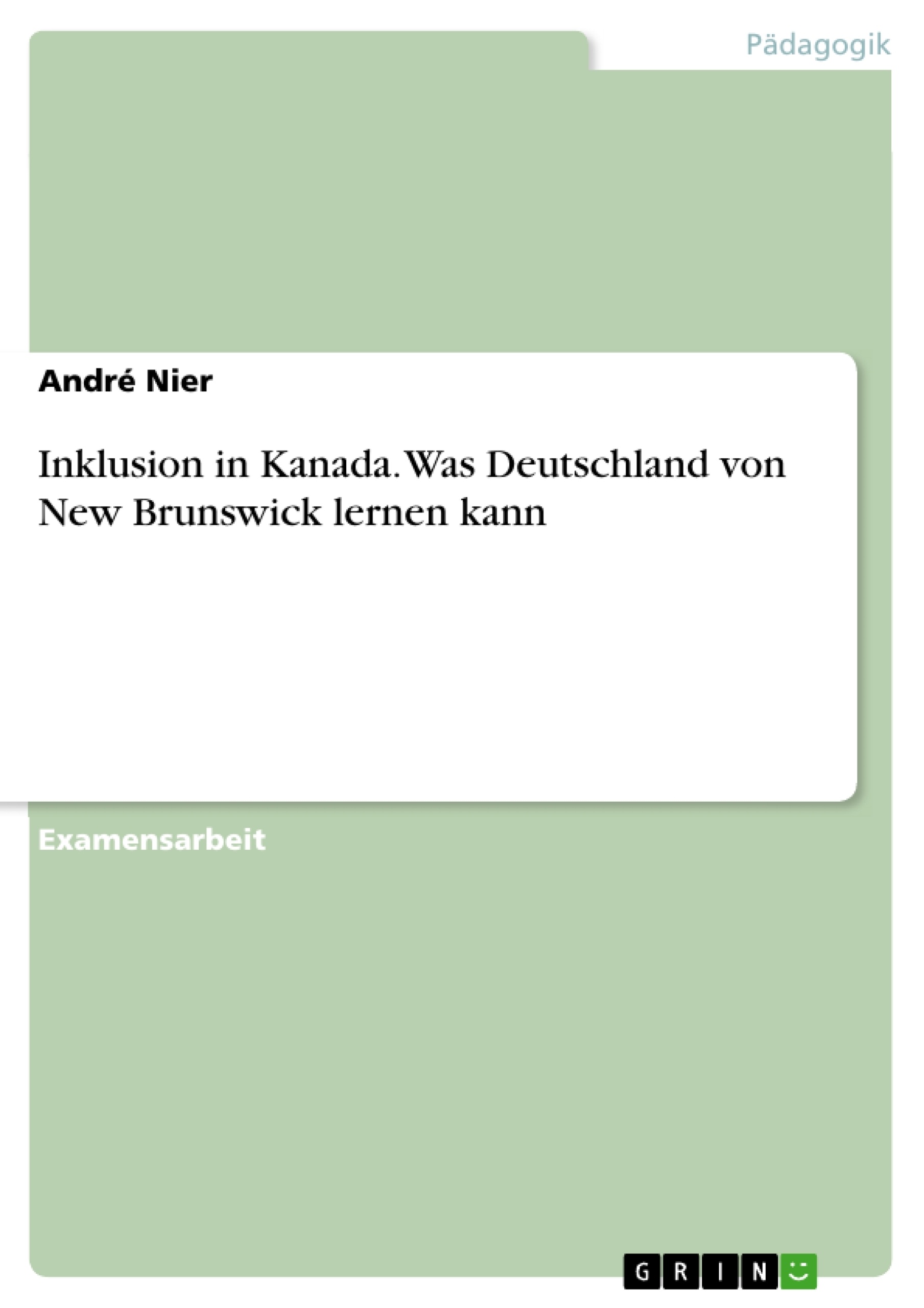Das Thema Inklusion, der gemeinsame Unterricht aller SchülerInnen, beschäftigt die Lehrerinnen und Lehrer aktuell wie kaum ein anderes Thema. Das von den Vereinten Nationen bereits 2006 verabschiedete „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“, auch: UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) genannt, trat schon im Jahre 2008 in Kraft. Am 24. Februar 2009 wurde die BRK auch von Deutschland ratifiziert und stellt damit einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag für die Bundesregierung dar. Damit sind nun auch, spätestens seit der Ratifizierung, die Länder gefragt, die in der Bundesrepublik für Bildungsfragen verantwortlich sind, das Bildungssystem an die neuen Herausforderungen anzupassen. Bisher findet die Anwendung bundesweit meist in kleineren Projekten und nur im beschränkten Umfang statt.
Die Modellschulen zeigen aber auch in Deutschland, dass es möglich ist, Inklusion umzusetzen, wenn auch bisher nur vereinzelt und im teilweise sehr kleinen Rahmen. Es scheint der Wille zu fehlen, die veralteten Strukturen im Schulsystem zu verändern und flächendeckend einen kompletten Neuanfang zu wagen. Am Beispiel von New Brunswick wird deutlich, dass es möglich ist, Inklusion auch auf breiterer Ebene zu verwirklichen. Hier wagte man schon 1986 den Schritt zu einer Schule für alle Kinder und seither wird dort überall gemeinsamer Unterricht angeboten. Im Rest des Landes sieht es aber nicht unbedingt schlechter aus: Alle exeptional children werden in Kanada gemeinsam unterrichtet und bekommen eine individuelle Förderung, genauso wie auch alle anderen SchülerInnen, die Hilfe benötigen, diese bei Bedarf in verschiedenen Einrichtungen innerhalb der Schule bekommen können.
Man darf sich in diesem Kontext bewusst die Frage stellen, warum muss ein Kind gut genug für eine bestimmte Schule sein? Sollte es nicht eher anders herum sein? Denn gerade die Aufgaben der Schule sehen doch vor, das Kind zu einer „guten“ Schülerin oder einem „guten“ Schüler zu machen. Wieso soll dann ein Kind nur auf eine Regelschule dürfen, wenn es „gut genug“ dafür ist?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Inklusion?
- Begriffsklärung
- Die Verwendung des Inklusionsbegriffs in Deutschland
- Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen
- Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit
- Dazugehörigkeit und Teilhabe
- Inklusion in Kanada
- Wurzeln des kanadischen Inklusionskonzepts
- Das kanadische Schulsystem
- Migrationspolitik als Schlüsselfaktor?
- New Brunswick - Ein Beispiel für Inklusion
- Geschichte des Inklusionsgedankens in New Brunswick
- Die Besonderheiten des Schulsystems in New Brunswick
- Special Education Plan
- Zusätzliche Födermaßnahmen
- Bildungsfinanzierung
- PISA 2000
- Die Lehren aus PISA 2000
- Evaluation der SchülerInnen
- Evaluation und Reflexion des Inklusionsprozesses
- Ziele: Aktionsplan 2012 bis 2015
- Zwischenfazit
- Inklusion am deutschen Beispiel
- Das Inklusions-Projekt der Gesamtschule Hungen
- Voraussetzungen an der Schule
- Die Projektklasse der Gesamtschule Hungen
- Wichtige Aspekte der pädagogischen Arbeit in der Projektklasse
- Wie inklusiv ist die Projektklasse wirklich?
- Ergebnisse der Abschlussarbeiten in der Projektklasse
- Vorschläge für die Zukunft des Projekts
- Diskussion
- Was kann Deutschland von New Brunswick lernen?
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Frage, welche Elemente des Inklusionsmodells aus New Brunswick die Umsetzung von Inklusion in Deutschland voranbringen können. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Inklusionsgedankens in New Brunswick und untersucht, welche spezifischen Maßnahmen und Strategien zur erfolgreichen Integration von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Bedürfnissen beitragen. Ziel ist es, Erkenntnisse aus dem kanadischen Kontext zu gewinnen, die für die Gestaltung eines inklusiven Bildungssystems in Deutschland relevant sind.
- Der Inklusionsbegriff und seine Bedeutung in Deutschland und Kanada
- Die Rolle der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen
- Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit im Kontext von Inklusion
- Das kanadische Schulsystem und seine Inklusionspolitik
- Die Umsetzung von Inklusion in New Brunswick und ihre Erfolgsfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Inklusion ein und erläutert die Relevanz der Thematik im Kontext der aktuellen Bildungslandschaft. Sie stellt die UN-Behindertenrechtskonvention als völkerrechtlich verbindlichen Vertrag vor und beleuchtet die Inklusionsvorgaben im Hessischen Schulgesetz. Die Einleitung verdeutlicht die Notwendigkeit einer umfassenden Umsetzung von Inklusion in Deutschland.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Inklusionsbegriff und seiner Bedeutung. Es werden verschiedene Definitionen von Inklusion vorgestellt und die Verwendung des Begriffs in Deutschland und Kanada analysiert. Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen wird als wichtiger Rahmen für die Umsetzung von Inklusion betrachtet. Das Kapitel beleuchtet außerdem die Bedeutung von Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit im Kontext von Inklusion.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Thema Inklusion in Kanada. Es werden die Wurzeln des kanadischen Inklusionskonzepts und die Besonderheiten des kanadischen Schulsystems beleuchtet. Die Rolle der Migrationspolitik als Schlüsselfaktor für die Entwicklung von Inklusion in Kanada wird untersucht. Das Kapitel fokussiert auf New Brunswick als Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung von Inklusion und analysiert die Geschichte des Inklusionsgedankens, die Besonderheiten des Schulsystems, die Bildungsfinanzierung und die Evaluation des Inklusionsprozesses.
Das vierte Kapitel untersucht die Umsetzung von Inklusion am deutschen Beispiel. Es wird das Inklusions-Projekt der Gesamtschule Hungen vorgestellt und die Voraussetzungen, die Projektklasse, die pädagogische Arbeit und die Ergebnisse des Projekts werden analysiert. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Inklusion in Deutschland.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Förderschwerpunkt Lernen, den inklusiven und exklusiven Unterricht sowie die schulische Inklusion, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Empirische Forschungsergebnisse werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bielefelder Längsschnittstudie (BiLieF-Projekt), die die Leistungsentwicklung und das Wohlbefinden von Schülern in inklusiven und exklusiven Förderarrangements vergleicht. Weitere Themen sind Förderempfehlungen, die Herausforderungen der Inklusion sowie Implikationen für die Schulentwicklung und Inklusionspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Was kann Deutschland von New Brunswick beim Thema Inklusion lernen?
New Brunswick zeigt, dass eine flächendeckende „Schule für alle“ seit 1986 erfolgreich möglich ist, wenn der politische Wille zur Strukturveränderung und individuellen Förderung vorhanden ist.
Was ist die rechtliche Basis für Inklusion in Deutschland?
Die wichtigste Grundlage ist die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK), die Deutschland 2009 ratifiziert hat und die ein inklusives Bildungssystem völkerrechtlich vorschreibt.
Wie sieht das Inklusionsmodell in New Brunswick aus?
Alle Kinder, auch solche mit sonderpädagogischem Förderbedarf (exceptional children), werden gemeinsam unterrichtet und erhalten bei Bedarf Unterstützung durch spezialisierte Einrichtungen innerhalb der Regelschule.
Welche Rolle spielt die Migrationspolitik in Kanada für die Inklusion?
Die kanadische Migrationspolitik hat eine Kultur der Vielfalt und Teilhabe geschaffen, die als Schlüsselfaktor für die Akzeptanz und Umsetzung inklusiver Schulmodelle gilt.
Gibt es erfolgreiche Inklusionsprojekte in Deutschland?
Ja, ein Beispiel ist die Gesamtschule Hungen, die durch Modellklassen zeigt, dass gemeinsamer Unterricht auch unter deutschen Rahmenbedingungen positive Ergebnisse erzielen kann.
- Citation du texte
- André Nier (Auteur), 2014, Inklusion in Kanada. Was Deutschland von New Brunswick lernen kann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288315