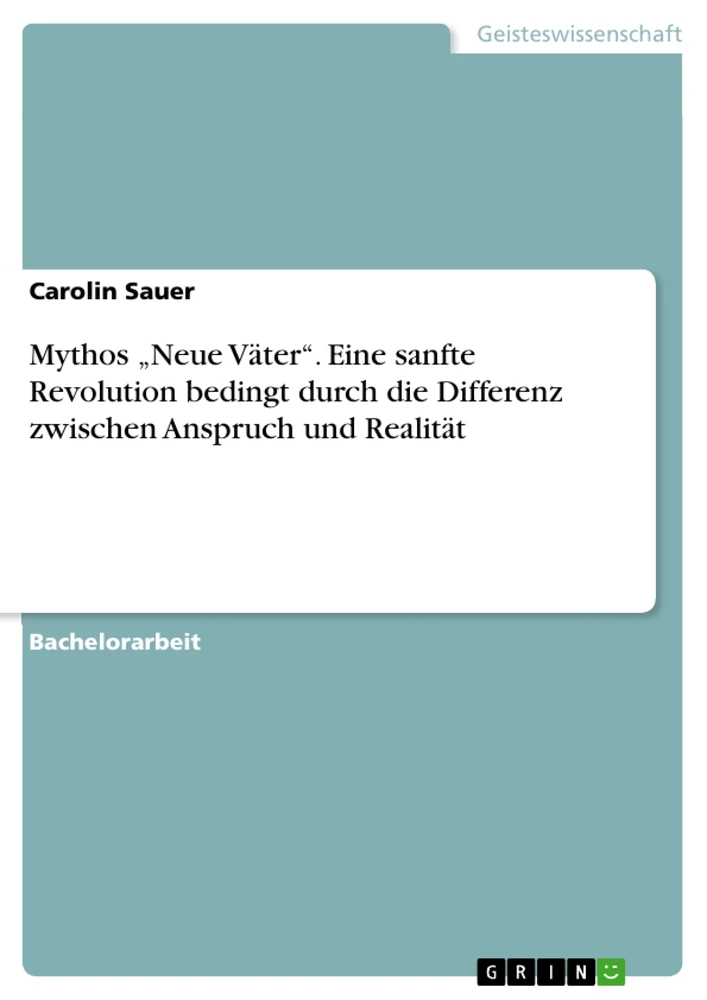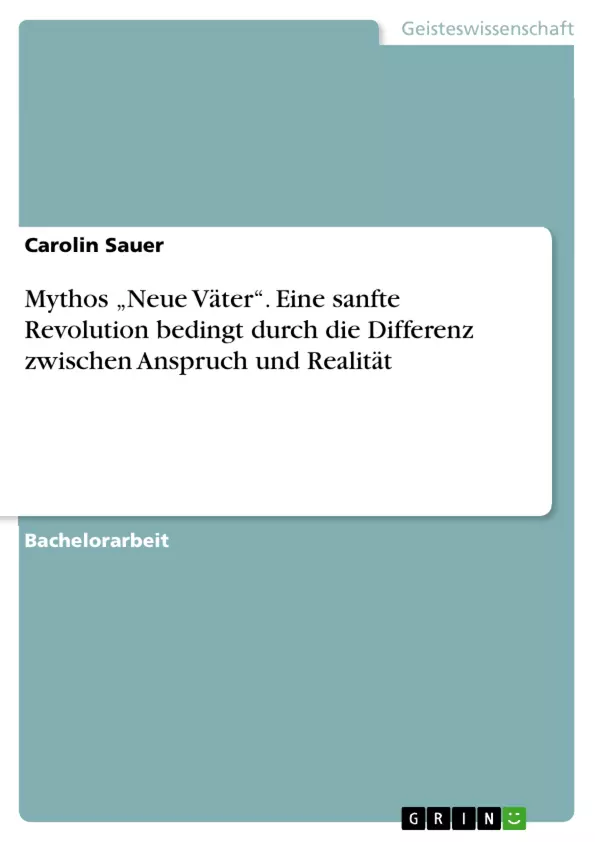Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die These, dass allein strukturelle Bedingungen zur Erklärung des nicht vollzogenen Wandels hin zu einer „neuen Vaterschaft“ nicht genügen - es sind auch tief verankerte Rollenerwartungen, welche die Umgestaltung erschweren. Um dieser Behauptung nachgehen zu können, ist es notwendig, die innerhalb unserer Gesellschaft manifestierten Geschlechterunterschiede herauszuarbeiten. Der Fokus dieser Arbeit liegt, obwohl sich europaweit Veränderungen bezüglich der Geschlechterverhältnisse und dem Verständnis von einer neuen, engagierten Vaterschaft abzeichnen, auf den Entwicklungen und Hindernissen in Deutschland, ohne dabei jedoch näher auf Milieu- oder Bildungsbedingte Unterschiede einzugehen. Mit einer Auseinandersetzung des rollentheoretischen Ansatzes nach Dahrendorf soll im zweiten Kapitel wegebreitend eine Annäherung an das Thema erfolgen. Abgeleitet von dem Begriff der sozialen Rolle werden die besonderen Charakteristika der Geschlechterrolle vorgestellt. Da die Verhältnisse und Ungleichheiten der Geschlechterrollen in der Institution der Familie besonders deutlich zum Ausdruck kommen, steht im Mittelpunkt des dritten Kapitels der Wandel der Familie, insbesondere die Entstehung und Umbrüche der bürgerlichen Familie als „Normalfamilie“. Das vierte Kapitel widmet sich der Figur des Vaters. In Abgrenzung zur traditionellen Vaterrolle wird ein Verständnis von „neuer Vaterschaft“ und ihren Grenzen erarbeitet. Die folgenden Kapitel fragen nach den Ursachen für einen nicht vollzogenen Wandel hin zu den „neuen Vätern“. Dabei wird in strukturelle Hindernisse (Kapitel 5) und in Blockaden durch tradierte Rollenbilder innerhalb der Familie (Kapitel 6) unterschieden. Wünschenswertes Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag dazu leisten zu können, dass traditionelle Geschlechterrollenbilder und Aufgabenverteilungen bewusst hinterfragt und aufgebrochen werden, um „neue Väter“ und Paare, die sich für eine egalitärere Gestaltung der Familienverantwortung entscheiden, zu stärken und eventuell in eine neue Bewegung zu bringen, hin zu einer neuen Elternschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rollentheoretische Grundlagen
- Soziale Rolle nach Dahrendorf
- Neukonstruktion von Rollenvorschriften
- Geschlechterrolle
- Wandel der Familie
- Der Familienbegriff
- Entstehung der „Normalfamilie“
- Krise der „Normalfamilie“
- Der Vater
- Vaterschaftsmodelle
- Neue Väter
- Neue Väter - alte Muster
- Strukturelle Barrieren
- Elternzeit
- Einkommensverhältnisse
- Berufstätigkeit des Mannes
- Mangelnde Väterfreundlichkeit der Unternehmen
- Intrafamiliäre Barrieren
- Tradierte Rollenbilder
- Wollen Mütter den neuen Vater?
- Macht und Kontrolle
- Weichensteller-Funktion der Mutter
- Das Bild der „guten Mutter“
- Fehlende Vorbilder
- Zusammenfassung - der Weg zu einer „neuen Elterlichkeit“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen dem Anspruch auf eine „neue Vaterschaft“ und der gelebten Realität in Deutschland. Sie analysiert die strukturellen und intrafamiliären Barrieren, die den Wandel von traditionellen Vaterschaftsmodellen zu einer egalitären Partner- und Elternschaft behindern.
- Die Rolle der traditionellen Geschlechterrollen und der Familie in der Gestaltung von Vaterschaftsmodellen
- Die Bedeutung von strukturellen Bedingungen wie Elternzeit, Einkommen und Arbeitsmarkt für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Väter
- Die intrafamiliären Barrieren, die von traditionellen Rollenbildern und Machtdynamiken innerhalb der Familie ausgehen
- Die Auswirkungen der „neuen Väterlichkeit“ auf die Sozialisierung von Kindern und die Gestaltung der Familienbeziehungen
- Die Bedeutung von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen für die Wahrnehmung von Väterrollen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte um die „neue Vaterschaft“ und die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
- Das zweite Kapitel analysiert verschiedene rollentheoretische Ansätze und ihre Relevanz für das Verständnis von Vaterrollen.
- Das dritte Kapitel untersucht den Wandel des Familienbegriffs und beleuchtet die Entstehung und Krise der „Normalfamilie“.
- Kapitel vier fokussiert auf das Vaterbild und präsentiert verschiedene Vaterschaftsmodelle sowie die Herausforderungen der „neuen Väter“.
- Das fünfte Kapitel analysiert strukturelle Barrieren, die die Umsetzung einer „neuen Vaterschaft“ behindern, wie zum Beispiel die Elternzeitregelung, Einkommensverhältnisse und die mangelnde Väterfreundlichkeit von Unternehmen.
- Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit intrafamiliären Barrieren, die aus traditionellen Rollenbildern, Machtdynamiken und dem Einfluss der Mutterrolle resultieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themen „Neue Vaterschaft“, „Tradierte Rollenbilder“, „Strukturelle Barrieren“, „Intrafamiliäre Barrieren“, „Elternzeit“, „Familienbegriff“, „Geschlechterrollen“, „Macht und Kontrolle“ und „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“. Sie analysiert die Differenz zwischen normativer Orientierung und faktischem Verhalten von Vätern im Kontext gesellschaftlicher Strukturen und familiärer Dynamiken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These der Arbeit zum Mythos „Neue Väter“?
Die These besagt, dass strukturelle Bedingungen allein nicht ausreichen, um den Wandel zur neuen Vaterschaft zu erklären; tief verankerte Rollenerwartungen erschweren die Umsetzung ebenfalls.
Welche strukturellen Barrieren werden in Deutschland identifiziert?
Genannt werden die Elternzeitregelungen, Einkommensunterschiede zwischen den Partnern sowie die mangelnde Väterfreundlichkeit vieler Unternehmen.
Was sind „intrafamiliäre Barrieren“ für neue Väter?
Dazu gehören tradierte Rollenbilder, Machtdynamiken in der Familie und die „Weichensteller-Funktion“ der Mutter (Gatekeeping).
Welchen theoretischen Ansatz nutzt die Arbeit?
Die Arbeit nutzt den rollentheoretischen Ansatz nach Dahrendorf, um soziale Rollen und Geschlechterrollen zu analysieren.
Was versteht man unter der Krise der „Normalfamilie“?
Es beschreibt den Umbruch des bürgerlichen Familienmodells hin zu neuen, egalitäreren Formen der Elternschaft und Lebensgestaltung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit möchte dazu beitragen, traditionelle Rollenbilder bewusst zu hinterfragen und Paare bei einer egalitären Aufteilung der Familienverantwortung zu stärken.
- Citar trabajo
- Carolin Sauer (Autor), 2012, Mythos „Neue Väter“. Eine sanfte Revolution bedingt durch die Differenz zwischen Anspruch und Realität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288455