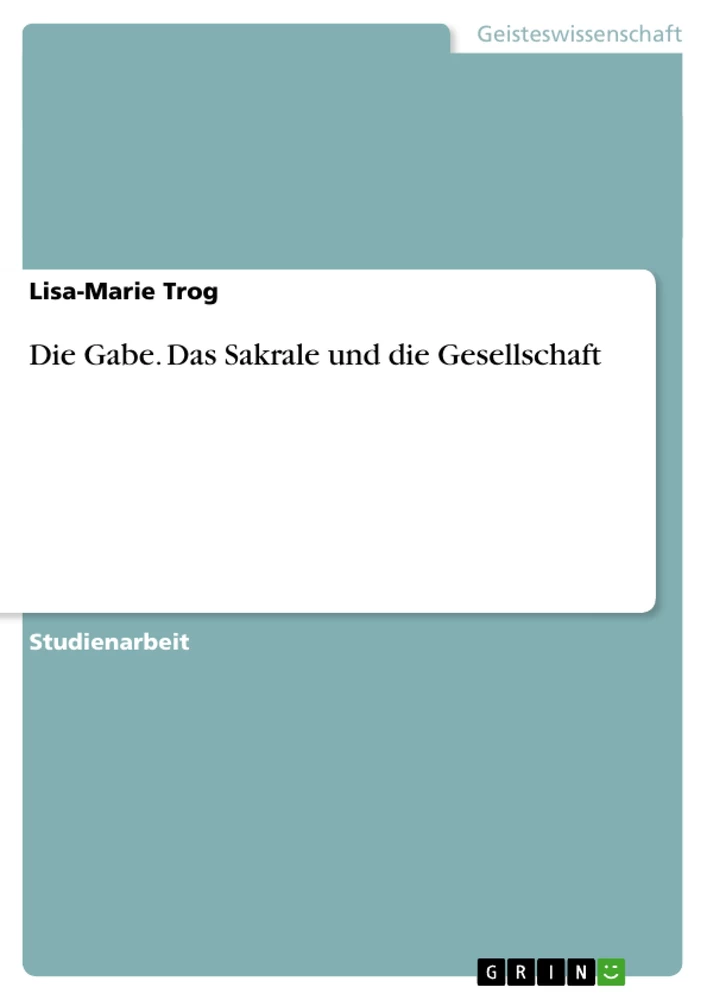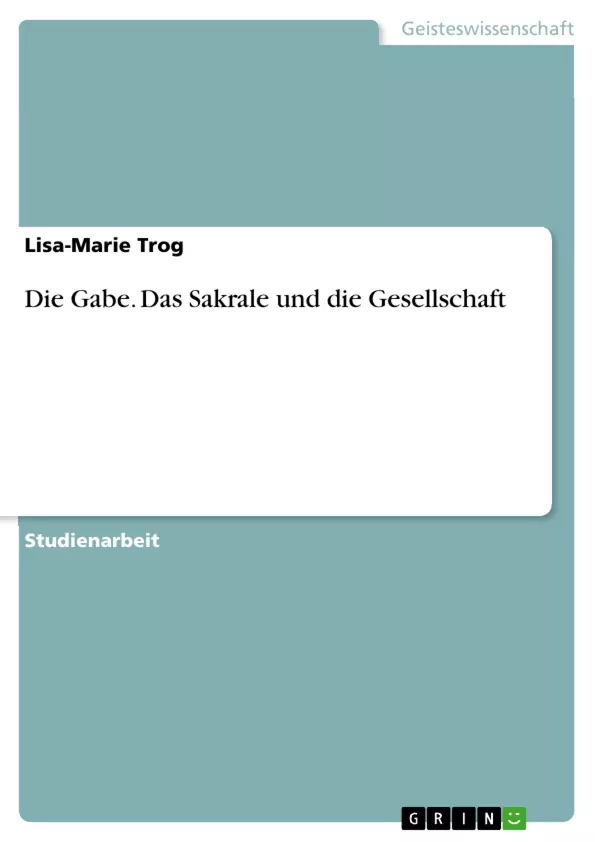Wieso gibt man? Menschen gehen neue Beziehungen zu anderen Menschen ein, da sie sich dadurch einen Vorteil erhoffen. Beziehungen basieren auf der Erwartung des Zweckes. Der eine oder andere Nachbar könnte später noch zu etwas taugen, zum Beispiel zum Austausch von Gartengeräten. Somit könnte man von einem Austausch profitieren und hält sich zum Beispiel die Option des Nachbarn offen. In der heutigen Gesellschaft ist es die Pflicht eines jeden zu bestimmten Anlässen etwas zu schenken. Sei es am Valentinstag, Weihnachten oder zum Geburtstag. Diese Riten wurden in unserer Gesellschaft verankert und sie werden positiv oder negativ sanktioniert. Hierbei sind auch die Rollenerwartungen an die jeweilige Person zu berücksichtigen. Nach Ralf Dahrendorf gibt es drei Arten der Erwartung: Die Kann-Erwartung, Soll-Erwartung und Muss-Erwartung. Diese drei Arten bestimmen auch das Geben und Nehmen in Gesellschaften mit. Bei der Kann-Erwartung wird von einem Menschen ein bisschen mehr erwartet als es seine Pflicht ist. Er muss es nicht tun aber es wird positiv sanktioniert wenn er es tut. Es steigert sein Ansehen, das er zum Beispiel in einer Gruppe genießt. Bei der Soll-Erwartung geht man davon aus, dass etwas gemacht wird, jedoch ohne dass dies zum Beispiel in Form von Rechtsregeln festgelegt sein muss. Zum Beispiel die Vorbereitung des Essens der Familie. Diese Art kann positiv als auch negativ sanktioniert werden. Muss-Erwartungen jedoch sind Pflichten, welche mit Rechtsregeln festgelegt sind und somit auch verbindlich und negativ sanktioniert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gabe nach Mauss
- Gabe an Menschen und Götter in archaischen Gesellschaften
- Gabe an Menschen und Götter in modernen Gesellschaften
- Kritik Derridas an Mauss
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Phänomen der Gabe in archaischen Gesellschaften und analysiert die Bedeutung des Gebens, Nehmens und Erwiderns im Kontext sozialer Beziehungen. Dabei werden die theoretischen Ansätze von Marcel Mauss und Jacques Derrida beleuchtet und die Rolle der Gabe in verschiedenen Kulturen und Gesellschaften untersucht.
- Die Gabe als totales gesellschaftliches Phänomen
- Die Logik des Gebens, Nehmens und Erwiderns
- Die Bedeutung der Gabe für soziale Beziehungen und Machtverhältnisse
- Die Kritik an der Vorstellung des selbstlosen Schenkens
- Der Potlatsch als Beispiel eines Systems totaler Leistungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Reziprozität und des Gebens ein und stellt die Relevanz des Themas für das Verständnis menschlicher Beziehungen und gesellschaftlicher Strukturen heraus. Sie beleuchtet die verschiedenen Formen des Gebens und die damit verbundenen Erwartungen und Sanktionen.
Das Kapitel „Die Gabe nach Mauss“ analysiert die Theorie von Marcel Mauss, der die Gabe als ein totales gesellschaftliches Phänomen betrachtet. Mauss untersucht die Gabe in archaischen Gesellschaften und zeigt, wie sie soziale Beziehungen, Machtverhältnisse und das Prestige von Individuen und Gruppen beeinflusst. Er analysiert die verschiedenen Formen der Gabe, die mit Verpflichtungen und Erwartungen verbunden sind, und stellt die Frage nach der Motivation des Gebens.
Häufig gestellte Fragen
Warum geben und schenken Menschen laut Marcel Mauss?
Geben ist ein "totales gesellschaftliches Phänomen", das auf der dreifachen Verpflichtung zum Geben, Nehmen und Erwidern basiert und soziale Bindungen sowie Prestige schafft.
Was sind die Erwartungsarten nach Ralf Dahrendorf?
Dahrendorf unterscheidet Muss-Erwartungen (rechtlich bindend), Soll-Erwartungen (gesellschaftliche Normen) und Kann-Erwartungen (freiwilliges Engagement).
Was ist ein "Potlatsch"?
Der Potlatsch ist ein System totaler Leistungen in archaischen Gesellschaften, bei dem durch exzessives Schenken und Zerstören von Gütern Macht und Status demonstriert werden.
Wie kritisiert Jacques Derrida den Begriff der Gabe?
Derrida hinterfragt die Möglichkeit einer "reinen" oder selbstlosen Gabe, da jede Form der Reziprozität die Gabe bereits in einen ökonomischen Tausch verwandelt.
Welche Rolle spielen Sanktionen beim Schenken?
Schenken wird oft positiv sanktioniert (Ansehen steigt), während das Verweigern von Gegengeschenken zu sozialem Ausschluss oder Prestigeverlust führen kann.
- Quote paper
- Lisa-Marie Trog (Author), 2010, Die Gabe. Das Sakrale und die Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288551