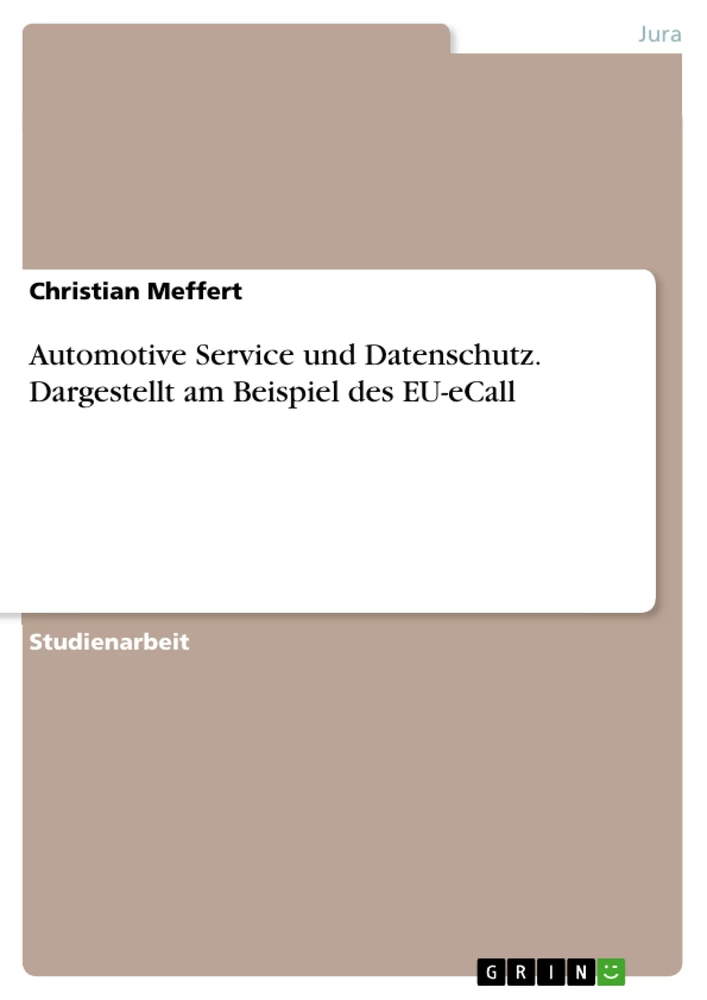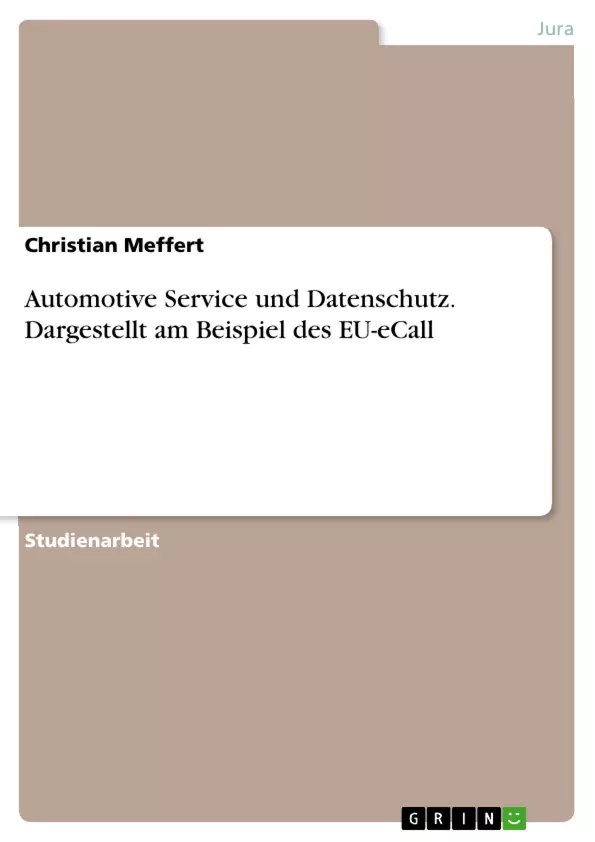Die stetige voranschreitende Vernetzung diverser Geräte, wie zum Beispiel Smartphones bis hin zu Fernsehern, hat sich zum Trend entwickelt. Man spricht auch vom „Internet der Dinge“ – eine Vernetzung immer neuer Geräte mit dem Ziel, dem Nutzer immer individualisierbarere digitalisierte Dienste anzubieten.
Diesen Trend hat die Automobilindustrie ebenso erkannt und BMW bietet beispielsweise bereits heute ein breites Portfolio an Vernetzten Diensten im Rahmen von BMW ConnectedDrive und ist damit nach einer aktuellen Studie im Auftrag von Vodafone Marktführer.
Realisieren lassen sich solche Dienste, oder fortfolgend auch Automotive Services genannt, durch eine Anbindung an das Internet. Dies wird ermöglicht durch ein im Automobil verbautes Subscriber Identity Module (kurz SIM(-Karte)).
Neben den Chancen, welche die Automotive Services beispielsweise für die Sicherheit im Straßenverkehr bieten, bestehen ebenso die Gefahren durch einen Missbrauch dieser Daten. Den Vorteil von Automotive Services will man beispielsweise dadurch nutzen, dass ab 2015 für alle in der Europäischen Union (EU) produzierten Neuwagen der intelligente Notruf (eCall) Pflicht wird und folglich die Vernetzung von Fahrzeugen deutlich steigt.
Entgegen der positiven Aspekte sehen Datenschützer hier ein hohes Risiko durch den Missbrauch dieser Daten. Nicht zuletzt seit der NSA-Affäre hat die Gesellschaft sich für das Thema Datenschutz sensibilisiert und so befürchten Kritiker, dass Autofahrer nahtlos überwacht werden könnten – man spricht auch vom „Gläsernen Autofahrer“.
So sagte bereits der Volkswagen-Vorstandschef M. Winterkorn auf der CeBit 2014 sinngemäß, dass unsere Fahrzeuge heute schon rollende Rechenzentren mit beispielsweise mehr als 50 Steuergeräten sind und das Auto nicht zur Datenkrake werden dürfe
.
Die Problemstellung die sich daraus ergibt ist die Frage, wie sich Automotive Services und das Thema Datenschutz zueinander verhalten – Überwiegen die Chancen dieser Technologie(n) die damit neu entstehenden Risiken und welche Gefahren kann dies bedeuten?
Die Zielsetzung dieser Arbeit soll es sein, dieser Fragestellung am Beispiel des EU-eCall nachzugehen und eine Antwort auf die Frage zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1.)
- 1.1) Thematische Einführung
- Motivation
- 1.2) Problemstellung & Zielsetzung
- 1.3) Aufbau der Arbeit
- 1.1) Thematische Einführung
- 2.) Das Technisches Konzept
- 2.1) Erläuterungen zum EU-eCall
- Hintergrund - die Initiative „Vision Zero"
- 2.2) Der Prozess im Notfall
- 2.3) Datenschutz beim EU-eCall
- 2.1) Erläuterungen zum EU-eCall
- 3.) Datenschutz beim EU-eCall
- 4.) Fazit & Ausblick
- Anhang
- Quellen der verwendeten Grafiken innerhalb der Abbildung 3 - Prozessablauf des Eu-eCall
- Fahrzeugrettungskarte
- Positionsbestimmung mittels GSM
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit dem EU-eCall, einem automatischen Notrufsystem für Fahrzeuge, das im Falle eines Unfalls automatisch eine Rettungsleitstelle alarmiert. Die Arbeit analysiert das technische Konzept des EU-eCall, untersucht den Prozessablauf im Notfall und beleuchtet die datenschutzrechtlichen Aspekte. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des EU-eCall zu vermitteln und die Bedeutung des Systems für die Verkehrssicherheit und den Datenschutz zu beleuchten.
- Technisches Konzept des EU-eCall
- Prozessablauf im Notfall
- Datenschutzrechtliche Aspekte des EU-eCall
- Bedeutung des EU-eCall für die Verkehrssicherheit
- Herausforderungen und Chancen des EU-eCall
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in das Thema EU-eCall ein und erläutert die Motivation für die Entwicklung des Systems. Es werden die Ziele und die Problemstellung der Arbeit dargestellt sowie der Aufbau der Arbeit erläutert. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem technischen Konzept des EU-eCall. Es werden die Funktionsweise des Systems, die verwendeten Technologien und die Datenübertragung erläutert. Außerdem wird der Prozessablauf im Notfall detailliert beschrieben. Das dritte Kapitel widmet sich dem Datenschutz beim EU-eCall. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Datenschutzbestimmungen und die Herausforderungen im Bereich des Datenschutzes beleuchtet. Das vierte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des EU-eCall.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den EU-eCall, die Verkehrssicherheit, den Datenschutz, die automatische Notrufsysteme, die Fahrzeugrettung, die Positionsbestimmung, die Datenübertragung, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Herausforderungen des EU-eCall.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der EU-eCall?
Der eCall ist ein automatisches Notrufsystem für Kraftfahrzeuge, das bei einem Unfall über das Mobilfunknetz die Rettungskräfte alarmiert und den Standort übermittelt.
Welche Daten werden beim eCall übertragen?
Übertragen werden der minimale Datensatz (MSD), der den Standort, den Zeitpunkt des Unfalls und die Fahrtrichtung umfasst, um schnelle Hilfe zu ermöglichen.
Welche Datenschutzbedenken gibt es beim eCall?
Kritiker befürchten den „gläsernen Autofahrer“ durch eine potenzielle Dauerüberwachung oder den Missbrauch der Bewegungsdaten durch Dritte.
Ist der eCall für Neuwagen verpflichtend?
Ja, gemäß EU-Verordnung müssen alle in der EU produzierten Neuwagen ab einem bestimmten Zeitpunkt (in der Arbeit mit 2015 angegeben) mit diesem System ausgestattet sein.
Was ist das Ziel der Initiative „Vision Zero“?
„Vision Zero“ verfolgt das Ziel, die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten im Straßenverkehr auf null zu reduzieren, wobei Technologien wie der eCall eine Schlüsselrolle spielen.
- Citation du texte
- Christian Meffert (Auteur), 2015, Automotive Service und Datenschutz. Dargestellt am Beispiel des EU-eCall, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288630