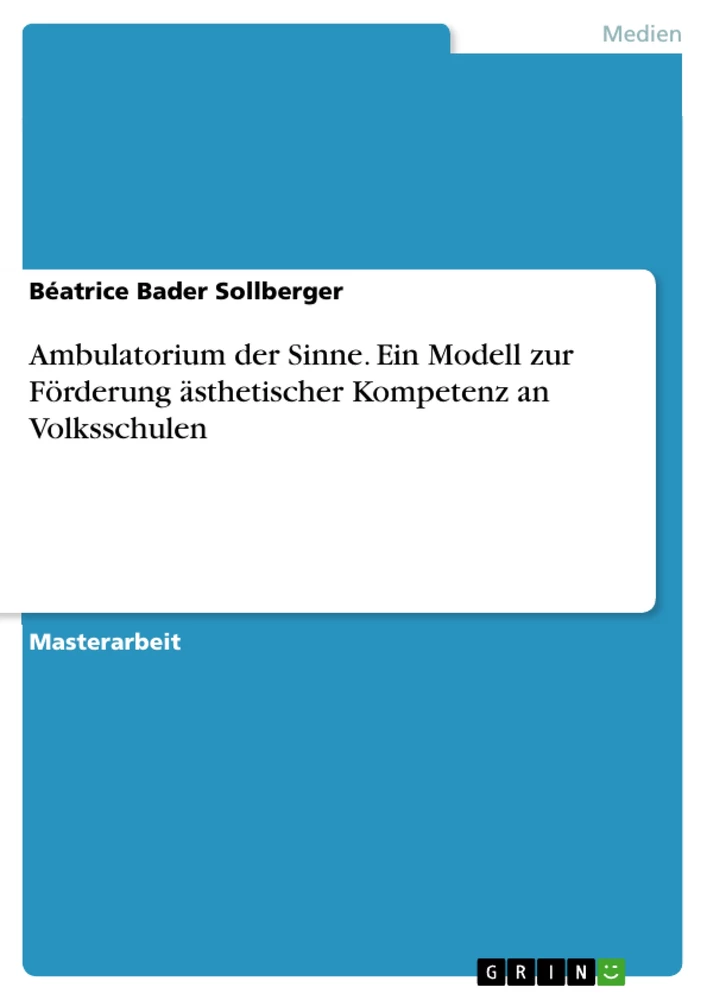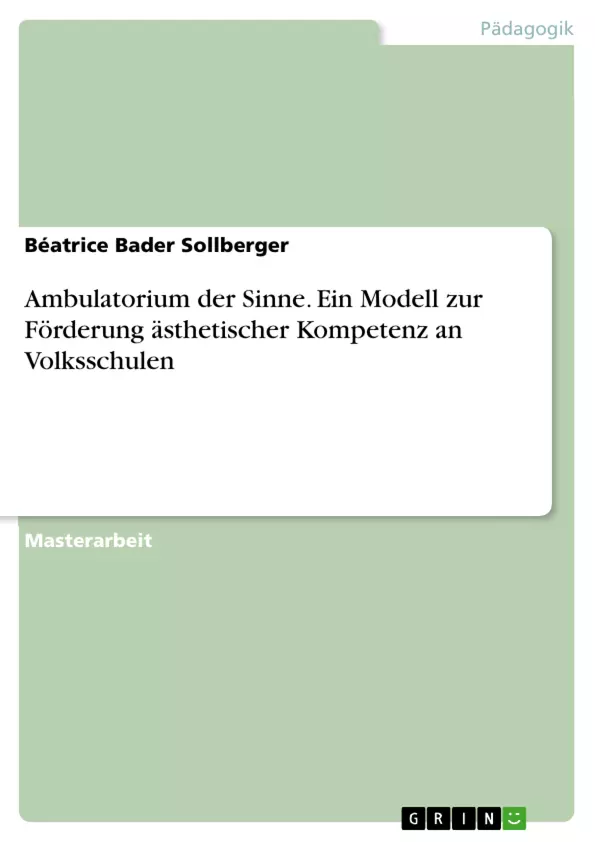Ausgelöst durch die PISA-Studien der OECD erfährt die künstlerische Bildung in der Volksschule eine drastische Marginalisierung vor allem dadurch, dass deren Wert und Bedeutung in der Wissensvermittlung nur am Rande der institutionalisierten Bildung vorkommt. In der Theorie interessiert daher die Frage, wie sich aufgrund des aktuellen Diskurses der Forderung nach künstlerischer Bildung in Schulen nachkommen lässt.
Ich stelle die These auf, dass durch den Einsatz künstlerischer Strategien und Handlungsweisen die Förderung ästhetischer Kompetenz parallel zur Stoffvermittlung möglich ist und sich positiv auf Selbstwahrnehmung und Lernerfolg der Lernenden auswirkt.
Durch die Kompetenz-Diskussion fällt ein neues Licht auf die Schlüsselkompetenzen und deren Erwerb: die Ästhetik als eigenständige wissenschaftliche Disziplin - in Deutschland begründet durch Alexander Gottlieb Baumgarten - bezeichnet die sinnliche Wahrnehmung im Sinne der Aneignung von Welt durch Erfahrung. Die von unterschiedlichen Autoren wie John Dewey, Michael Brater oder Matthias Duderstadt beschriebenen Erkenntnisse über die ästhetische Erfahrung durch Kunst in der Wissensproduktion werden an an zwei Positionen untersucht: am Spiel und an künstlerischen Handlungsweisen, wobei die für die Förderung ästhetischer Kompetenz relevanten Methoden herausgearbeitet werden. Die Bedeutung des Spiels wird anhand philosophischer und künstlerischer Positionen aufgezeigt, u.a. der Frankfurter Schule, DADA und der Situationistischen Internationale. Die künstlerische Praxis wird ergänzend am Beispiel des Sammelns als künstlerische Strategie formuliert. Dabei werden Zusammenhang und Bedeutung von Spiel und Ästhetik anhand künstlerischen Herangehensweisen aufgezeigt und in das Modell Ambulatorium der Sinne zur Förderung ästhetischer Kompetenz transformiert.
Inhaltsverzeichnis
- Der Begriff der Ästhetik als eigenständige Philosophie
- Der Begriff der Ästhetik im historischen Kontext
- Überblick über den Begriff der Ästhetik in der Lern- und Wissensvermittlung
- Ästhetische Bildung als Entwicklung, Differenzierung und Kultivierung des Wahrnehmungsvermögens
- Schwerpunkte des ästhetisch bildenden Unterrichts am Beispiel der Waldorfpädagogik
- Schwerpunkte des ästhetisch bildenden Unterrichts am Beispiel der Reggio-Pädagogik
- Die Bedeutung des Spiels als Grundlage ästhetischer Kompetenz
- Das Spiel bei Theodor Adorno
- Das Spiel bei Walter Benjamin
- Das Spiel bei der Situationistischen Internationale (SI)
- Bei Guy Debord
- Bei Asger Jorn
- Bei Hannah Höch
- Bei Kurt Schwitters
- Die Bedeutung des Begriffs der ästhetischen Kompetenz in der Wissensvermittlung
- Künstlerische Handlungsweisen zur Förderung ästhetischer Kompetenz am Beispiel des Sammelns
- Die Bedeutung des Sammelns als künstlerische Strategie
- Modell zur Förderung ästhetischer Kompetenz in der öffentlichen Schule
- Bedeutung der Förderung ästhetischer Kompetenz in der öffentlichen Schule
- Leitlinien zur Förderung ästhetischer Kompetenzen in der öffentlichen Schule
- Zwischenfazit
- Modell Ambulatorium der Sinne
- Grundlagen und Ziele
- Theoretische Zugänge zum den Inhalten
- Einleitung
- Standortwahl
- Laufzeit
- Zielgruppe
- Öffentliche Veranstaltungen
- Struktur und Reflexion
- Szenografie
- Materialsammlung
- Anleitung
- Praktische Umsetzung
- Fazit
- Bibliografie
- Bildanhang
- Eigene Werkbeispiele zum Sammeln als künstlerische Strategie
- Weitere Bildbeispiele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterthesis befasst sich mit der Frage, wie die ästhetische Kompetenz von Kindern gefördert werden kann. Sie untersucht die Relevanz von Spiel und Sinnesbetätigung in Verbindung mit künstlerischen Strategien im Kontext der öffentlichen Schule. Die Arbeit analysiert die Bedeutung des Spiels für die Entwicklung ästhetischer Kompetenz und entwickelt ein Modell, das die Förderung dieser Kompetenz im Schulalltag ermöglicht.
- Die Bedeutung des Spiels für die Entwicklung ästhetischer Kompetenz
- Die Rolle künstlerischer Handlungsweisen in der ästhetischen Bildung
- Die Förderung ästhetischer Kompetenz in der öffentlichen Schule
- Das Modell "Ambulatorium der Sinne" als Ansatz zur Förderung ästhetischer Kompetenz
- Die Bedeutung der Sinneswahrnehmung und des kreativen Experimentierens für das Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Ästhetik und seiner historischen Entwicklung. Es beleuchtet die Bedeutung der Ästhetik in der Lern- und Wissensvermittlung und analysiert verschiedene Ansätze zur ästhetischen Bildung, wie z.B. die Waldorfpädagogik und die Reggio-Pädagogik.
Das zweite Kapitel untersucht die Bedeutung des Spiels als Grundlage ästhetischer Kompetenz. Es analysiert die Spieltheorien von Theodor Adorno, Walter Benjamin und der Situationistischen Internationale, um die Rolle des Spiels für die Entwicklung von Kreativität, Fantasie und ästhetischem Empfinden zu beleuchten.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Begriffs der ästhetischen Kompetenz in der Wissensvermittlung. Es analysiert künstlerische Handlungsweisen, wie z.B. das Sammeln, als Mittel zur Förderung ästhetischer Kompetenz und untersucht die Bedeutung des Sammelns als künstlerische Strategie.
Das vierte Kapitel präsentiert das Modell "Ambulatorium der Sinne" zur Förderung ästhetischer Kompetenz in der öffentlichen Schule. Es beschreibt die Grundlagen und Ziele des Modells, die theoretischen Zugänge zu den Inhalten und die praktische Umsetzung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die ästhetische Kompetenz, die Förderung der ästhetischen Kompetenz, das Spiel, die Sinnesbetätigung, künstlerische Handlungsweisen, das Sammeln, die öffentliche Schule, das Modell "Ambulatorium der Sinne" und die Bedeutung der Sinneswahrnehmung für das Lernen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Modells „Ambulatorium der Sinne“?
Das Modell zielt darauf ab, die ästhetische Kompetenz von Grundschülern durch künstlerische Strategien und Sinneswahrnehmung im Schulalltag zu fördern.
Warum wird künstlerische Bildung in Volksschulen vernachlässigt?
Laut Autor führt die Fokussierung auf PISA-Studien und messbare Wissensvermittlung zu einer Marginalisierung künstlerischer Fächer.
Welche Rolle spielt das „Spiel“ in diesem pädagogischen Ansatz?
Das Spiel gilt als Grundlage der ästhetischen Kompetenz und als notwendiges Werkzeug zur kreativen Aneignung der Welt.
Was wird als „künstlerische Strategie“ zur Förderung genutzt?
Die Arbeit hebt insbesondere das „Sammeln“ als Strategie hervor, um Wahrnehmung und Ordnungssinn künstlerisch zu schulen.
Wer begründete den Begriff der Ästhetik historisch?
Die Ästhetik als eigenständige wissenschaftliche Disziplin wurde in Deutschland durch Alexander Gottlieb Baumgarten begründet.
- Quote paper
- Béatrice Bader Sollberger (Author), 2013, Ambulatorium der Sinne. Ein Modell zur Förderung ästhetischer Kompetenz an Volksschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288800