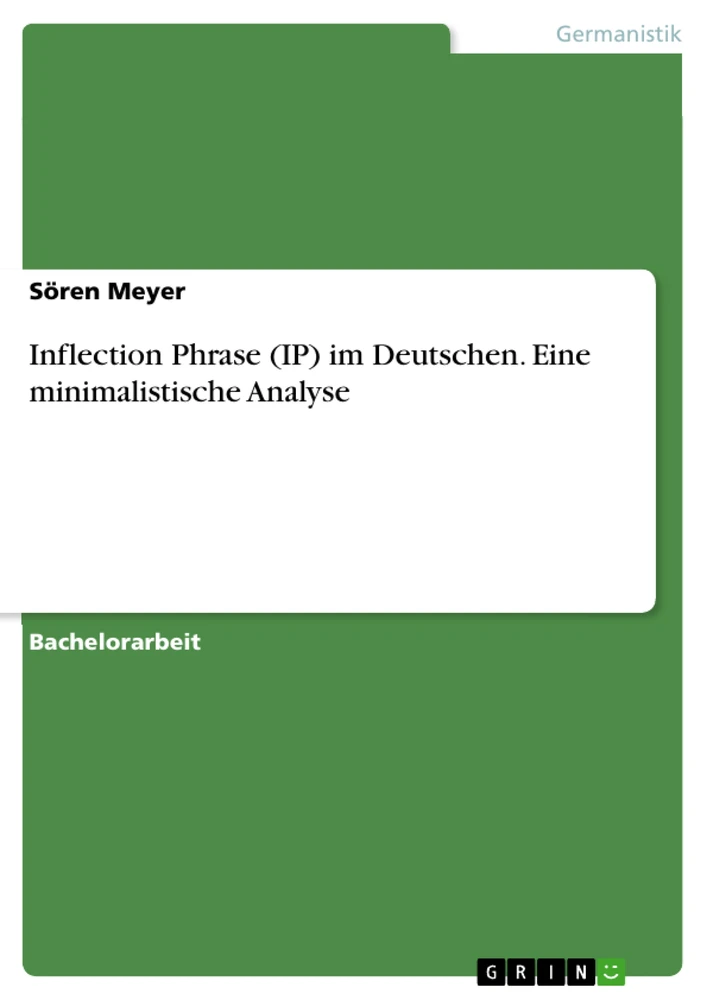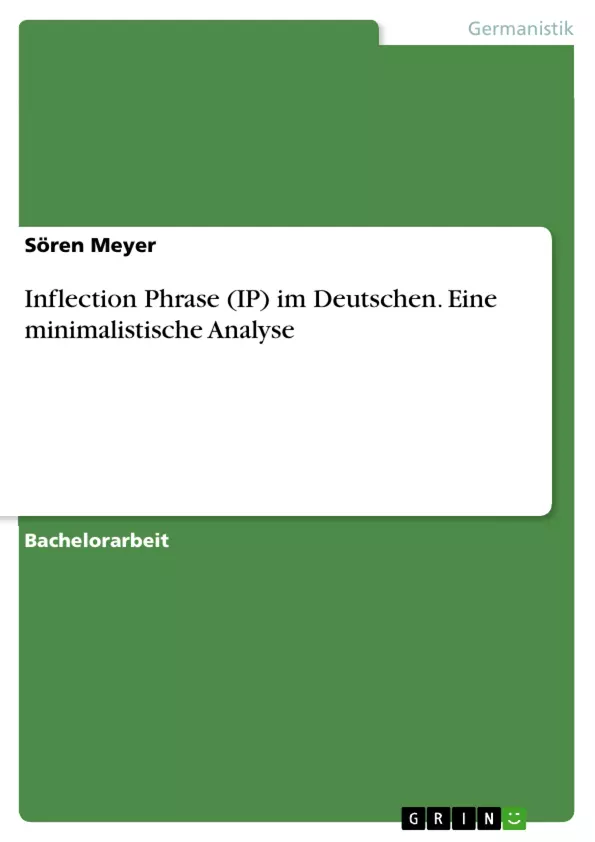Die Frage nach der Ableitung der Kongruenz ist im Minimalismus von zentraler Bedeutung.
Hierbei spielt unter anderem die Flexionsmorphologie und ihre Auswirkung auf die Syntax eine große Rolle. Syntaktische Relationen lassen sich an der Morphologie von Flexionsaffixen ablesen, da die Kategorien Kasus, Person, Numerus und Genus sowohl morphologisch anhand spezieller Merkmale realisiert werden als auch die Kongruenz und Rektion abbilden können (vgl. Sternefeld 2007: 1). So verwundert es nicht, dass Sternefeld ähnliche Mechanismen bei der Erzeugung morphologischer Strukturen bei Wörtern auch für die Syntax annimmt. Mit Bezug auf Wurzel (1984) betont Sternefeld (2007) zudem die Gemeinsamkeiten zwischen Syntax und Morphologie in Bezug auf die Interfaces. Die Interfaces stellen jene Stufe der Satzgenerierung dar, wo die derivational erzeugte Struktur zum einen hinsichtlich ihrer logischen Form, d.h. semantisch und zum anderen hinsichtlich ihrer phonologischen Form, d.h. wie sie lautlich – in Form eines akustischen Outputs – realisiert werden muss. Hierauf wird an späterer Stelle genauer eingegangen. Im Prinzip soll die Eigenschaft, dass hier zwischen lautlicher Form und Inhalt vermittelt wird unterstrichen werden (vgl. Sternefeld 2007: 1).
Die Tatsache, dass es vor allem im Deutschen spezielle und teilweise distinktive Morpheme gibt, die syntaktische Verhältnisse wie Kongruenz ausdrücken, wirft die Frage auf, inwieweit man dieses Phänomen syntaktisch analysiert. In dieser Arbeit wird in erster Linie versucht, die Kongruenz zwischen Subjekt und Verb im Deutschen näher zu beleuchten. Hierbei handelt es sich um eine explizite Relation, die sich in Form von Merkmalen aus der Morphologie konkret manifestiert. Dennoch ist nicht unmittelbar klar, wie eine derartige Relation strukturell auszusehen hat. Man muss quasi zwei Elemente hinsichtlich ihrer Eigenschaften miteinander abgleichen, um das passende Affix zu generieren. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass keines der beiden Elemente das andere dominiert, da eine Dominanzrelation bedeuten müsste, dass der dominierende Teil seine Eigenschaften projiziert.
In der Theorie muss geklärt werden, wie dieses besondere Verhältnis beschrieben werden kann. Eine Möglichkeit dieser Beschreibung lieferte die Einführung einer sogenannten
funktionalen Kategorie IP. IP steht für Inflection Phrase. Ziel ist eine genaue Untersuchung dieser Phrase hinsichtlich ihrer Relevanz für eine minimalistische Analyse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorien der IP gesteuerten Kongruenz in der Generativen Syntax
- Strukturelle Positionen von I
- Affix-Hopping
- Die Deutsche Verbbewegung als V nach I Bewegung
- Theorie der Merkmale
- Operationen des Minimalismus
- Nähere Betrachtung der I-Position im typologischen Vergleich
- Verbpositionen im Deutschen und im Englischen
- Infinitivpartikel und ihrer syntaktische Position
- I-Analyse im Deutschen
- Das externe Subjekt
- Anwendung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse der Kongruenz zwischen Subjekt und Verb im Deutschen im Rahmen der minimalistischen Syntax. Ziel ist es, die Rolle der funktionalen Kategorie IP bei der Steuerung der Kongruenz zu untersuchen und die Relevanz dieser Phrase für eine minimalistische Analyse des Deutschen zu beleuchten.
- Die IP als zentrale Kategorie für die Steuerung von Kongruenz zwischen Subjekt und Verb.
- Die Rolle von Flexionsmerkmalen und ihre Auswirkung auf die Syntax.
- Der Vergleich von Verbpositionen und Kongruenzmechanismen im Deutschen und Englischen.
- Die Relevanz der Ökonomie im Minimalismus und die Frage, ob die Reduzierung syntaktischer Komplexität auf Kosten einer Steigerung morphologischer Komplexität ermöglicht wird.
- Die Herausforderungen der minimalistischen Analyse von deutschen Sätzen im Kontext der IP-Theorie.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kongruenz im Minimalismus ein und stellt die Bedeutung der Flexionsmorphologie für die syntaktische Analyse heraus. Des Weiteren wird die Rolle der funktionalen Kategorie IP als Vermittler zwischen Subjekt und Verb im Hinblick auf Kongruenz vorgestellt.
Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Theorien der IP-gesteuerten Kongruenz, die innerhalb der generativen Syntax diskutiert werden. Hier werden Themen wie die strukturellen Positionen von I, Affix-Hopping und die Deutsche Verbbewegung als V nach I Bewegung behandelt.
Kapitel 3 befasst sich mit der Theorie der Merkmale im Minimalismus und betrachtet die Operationen des Minimalismus sowie die nähere Betrachtung der I-Position im typologischen Vergleich. Dabei werden Verbpositionen im Deutschen und Englischen sowie die syntaktische Position von Infinitivpartikeln analysiert.
Kapitel 4 widmet sich der Anwendung der theoretischen Konzepte auf die Analyse von konkreten Beispielen im Deutschen. In diesem Kapitel werden verschiedene Aspekte der IP-Analyse im Deutschen und das externe Subjekt behandelt.
Schlüsselwörter
Minimalistische Syntax, Kongruenz, IP (Inflection Phrase), Flexionsmorphologie, Subjekt-Verb-Kongruenz, Phi-Features, Deutsche Verbbewegung, Affix-Hopping, Typologischer Vergleich, Verbpositionen, Infinitivpartikel, Ökonomie, Reduktion syntaktischer Komplexität.
- Citation du texte
- Sören Meyer (Auteur), 2011, Inflection Phrase (IP) im Deutschen. Eine minimalistische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288915