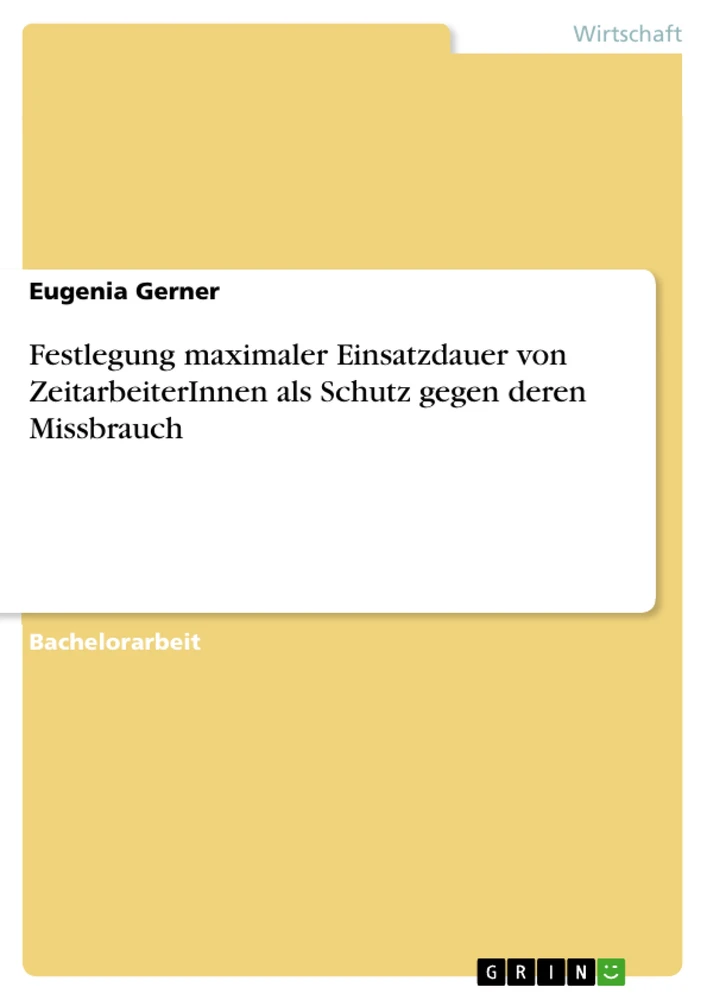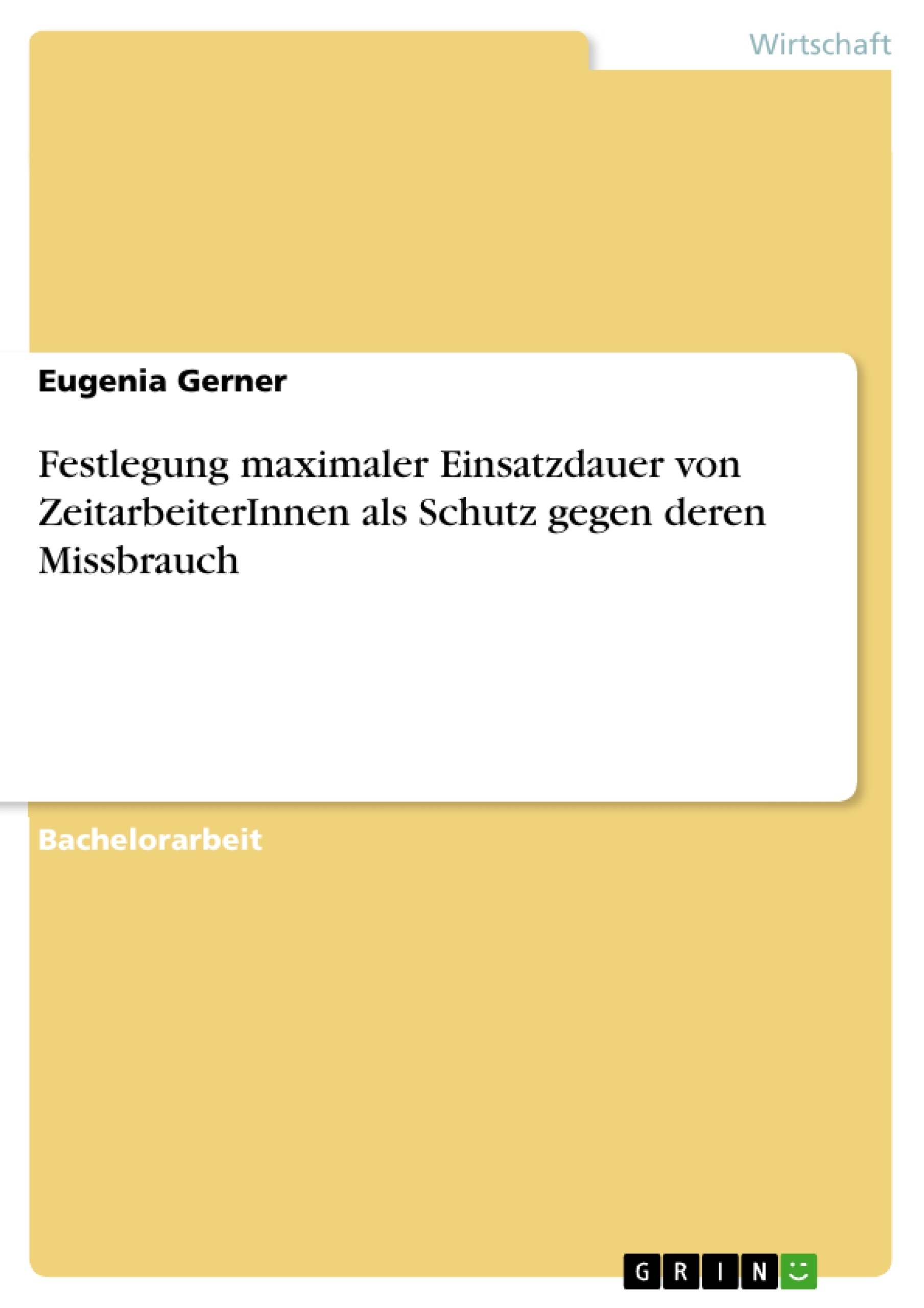Ein langjährig beschäftigter Leiharbeiter bei demselben Entleiher verklagte sein Aufnahmebetrieb auf eine Übernahme in das normale Arbeitsverhältnis und auf den Ausgleich der Lohndifferenz wegen der nicht mehr vorübergehenden
nach §1 Absatz 1 Satz 2 AÜG, sondern dauerhaften, Beschäftigung. (Vgl. BAG 2013) Seiner Klage gab das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg statt. (LAG) (Vgl. LAG 2012) Das Bundesarbeitsgericht (BAG) (Vgl. BAG 2013) lehnte die Klage des Beschäftigten jedoch aufgrund fehlender planwidriger Regelungslücke ab, denn bei vorhandener Überlassungserlaubnis gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 AÜG kein Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und den überlassenen Arbeitnehmer/innen auch bei nicht nur vorübergehender Arbeitnehmerüberlassung begründet wird. (Vgl. BAG 2013, Rn 9 ff.) Die angemessenen und abschreckenden Sanktionen einer nicht mehr vorübergehenden Überlassung kann der deutsche Gesetzgeber, laut der Richtlinie 2008/104/EG, festlegen. (Vgl. BAG 2014, 23)
Im Juni 2013 betrug die Zahl der Arbeitnehmer/innen auf Basis der Arbeitnehmerüberlassung 852 Tausend. (Vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014, 8) Die Arbeitnehmer/innen verrichten nicht nur die gleiche Arbeit wie die Stammbelegschaft der Einsatzbetriebe, sondern bringen auch häufig hohe Flexibilität und Erfahrung mit. (Vgl. Gutmann/Kilian 2011, 127 f.) Dabei haben sie oft, trotz des Gleichbehandlungsgrundsatzes im Sinne von § 10 Absatz 4 AÜG, nicht zufrieden stellende Arbeitsplatzbedingungen und geringere Bezahlung. (Vgl. Siemund 2013,, 246) Die überlassenen Arbeitnehmer/innen erhoffen einen unbefristeten Arbeitsvertrag und die Übernahme in die Einsatzfirma.
(Vgl. Galais at al. 2014, 1997) Für nur rund 14 Prozent der Beschäftigten geht dieser Wunsch in Erfüllung. (IW Consult GmbH 2011, 32 ff.) Offensichtlich liegt hier ein Missbrauch der Arbeitnehmer/innen vor. Um diesen zu reduzieren
wurde im Laufe der öffentlichen Diskussion zum Thema "Zeitarbeit" die zeitliche Definition des im Gesetz enthaltenen Wortlauts "vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung" von der Regierung gefordert. (Vgl. Stenslik/Heine 2013, 2183 f.) Daraufhin sieht der aktuelle Koalitionsvertrag eine maximale
Beschäftigungsdauer der Zeitarbeiter von 18 Monaten vor. (Vgl.
Bundesregierung 2014, 69) [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
- Arbeitnehmerüberlassung
- Begriff und Definition der Arbeitnehmerüberlassung
- Abgrenzung der Arbeitnehmerüberlassung
- Aktuelle Gesetzeslage
- Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Leiharbeit
- Das Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz AÜG)
- Tarifvertrag
- Rechtlicher Handlungsbedarf
- Festlegung maximaler Einsatzdauer der Arbeitnehmer/innen
- Geschichtliche Entwicklung der maximal zulässigen Überlassungsdauer der Zeitarbeitnehmer/innen
- Bedeutung der Arbeitnehmerüberlassung
- Arbeitnehmerüberlassung in der Gesellschaft
- Chancen und Risiken des Einsatzes der Zeitarbeitnehmer/innen für Aufnahmebetriebe
- Vor- und Nachteile bei der Aufnahme der Beschäftigung auf Basis der Arbeitnehmerüberlassung für Arbeitnehmer
- Handlungsbedarf/Kritische Betrachtung
- Denkbare Auswirkungen der Festlegung der maximalen Einsatzdauer der Arbeitnehmer
- Mögliche Alternativen/Weitere Lösungsansätze
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Auswirkungen der Festlegung einer maximalen Einsatzdauer von Zeitarbeitnehmern auf deren Schutz und den Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung. Sie untersucht, ob eine solche Begrenzung des Einsatzes von Zeitarbeitnehmern tatsächlich zu einer Reduzierung von Missbrauch führt oder möglicherweise sogar neue Probleme schafft.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Arbeitnehmerüberlassung
- Geschichtliche Entwicklung und aktuelle Problematik der Zeitarbeit
- Chancen und Risiken der Zeitarbeit für Arbeitnehmer und Unternehmen
- Auswirkungen der Festlegung einer maximalen Einsatzdauer auf die Beteiligten
- Mögliche Alternativen zur Begrenzung der Einsatzdauer
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Zielsetzung der Arbeit: Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und verdeutlicht die Relevanz der Thematik. Dabei wird der aktuelle Streitfall zur unbefristeten Überlassung von Zeitarbeitnehmern durch das Bundesarbeitsgericht beleuchtet. Die Arbeit untersucht, inwiefern die Festlegung einer maximalen Einsatzdauer von Zeitarbeitnehmern einen wirksamen Schutz vor Missbrauch bietet.
- Arbeitnehmerüberlassung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Arbeitnehmerüberlassung und beleuchtet die unterschiedlichen Bezeichnungen, die in der Praxis verwendet werden. Es werden die rechtlichen Grundlagen der Arbeitnehmerüberlassung sowie die Beziehungen zwischen Verleiher, Entleiher und Zeitarbeitnehmern erläutert.
- Aktuelle Gesetzeslage: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen der Arbeitnehmerüberlassung, insbesondere die Richtlinie 2008/104/EG und das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). Es werden die geltenden Regelungen und die Herausforderungen bei deren Umsetzung diskutiert.
- Festlegung maximaler Einsatzdauer der Arbeitnehmer/innen: Dieses Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der maximalen Einsatzdauer von Zeitarbeitnehmern und analysiert die Bedeutung der Arbeitnehmerüberlassung in der heutigen Gesellschaft. Es werden die Chancen und Risiken für Unternehmen und Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Zeitarbeit sowie die Herausforderungen und Kritikpunkte diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Arbeitnehmerüberlassung, Zeitarbeit, Leiharbeit, maximale Einsatzdauer, Missbrauch, Schutz der Arbeitnehmer, rechtliche Rahmenbedingungen, Chancen und Risiken, Handlungsbedarf, alternative Lösungsansätze, AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), Richtlinie 2008/104/EG.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die maximale Einsatzdauer für Zeitarbeiter laut aktuellem Koalitionsvertrag?
Der Koalitionsvertrag sieht eine maximale Überlassungsdauer von 18 Monaten vor, um eine dauerhafte Beschäftigung als Leiharbeitnehmer im selben Betrieb zu begrenzen.
Was ist das Ziel des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)?
Das AÜG regelt die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmern und soll sicherstellen, dass Leiharbeit nur vorübergehend erfolgt und Missbrauch sowie dauerhafte Lohndumping-Strukturen verhindert werden.
Welche Rolle spielt die EU-Richtlinie 2008/104/EG?
Diese Richtlinie bildet den europäischen Rahmen für Leiharbeit. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, angemessene Sanktionen für Verstöße gegen den Grundsatz der vorübergehenden Überlassung festzulegen.
Was versteht man unter dem Gleichbehandlungsgrundsatz in der Zeitarbeit?
Gemäß § 10 Absatz 4 AÜG haben Leiharbeitnehmer grundsätzlich Anspruch auf die gleichen wesentlichen Arbeitsbedingungen und das gleiche Arbeitsentgelt wie vergleichbare Stammarbeitnehmer im Einsatzbetrieb.
Wie viele Zeitarbeitnehmer werden tatsächlich in Festanstellungen übernommen?
Laut statistischen Erhebungen geht der Wunsch nach einer festen Übernahme nur für etwa 14 Prozent der Zeitarbeitnehmer in Erfüllung.
- Quote paper
- Eugenia Gerner (Author), 2014, Festlegung maximaler Einsatzdauer von ZeitarbeiterInnen als Schutz gegen deren Missbrauch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288971