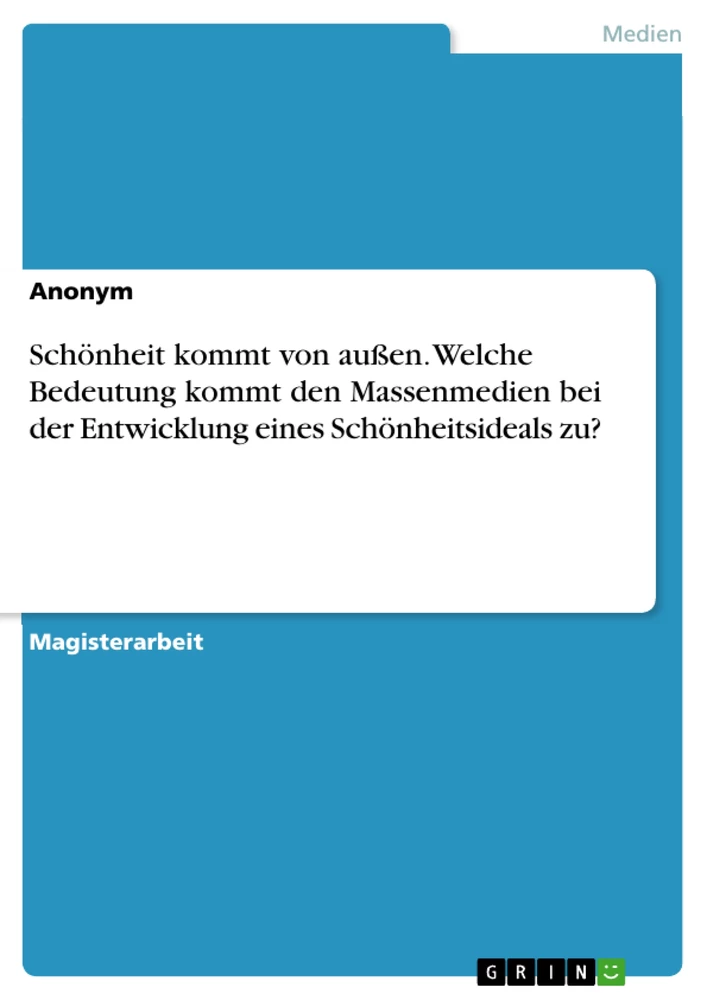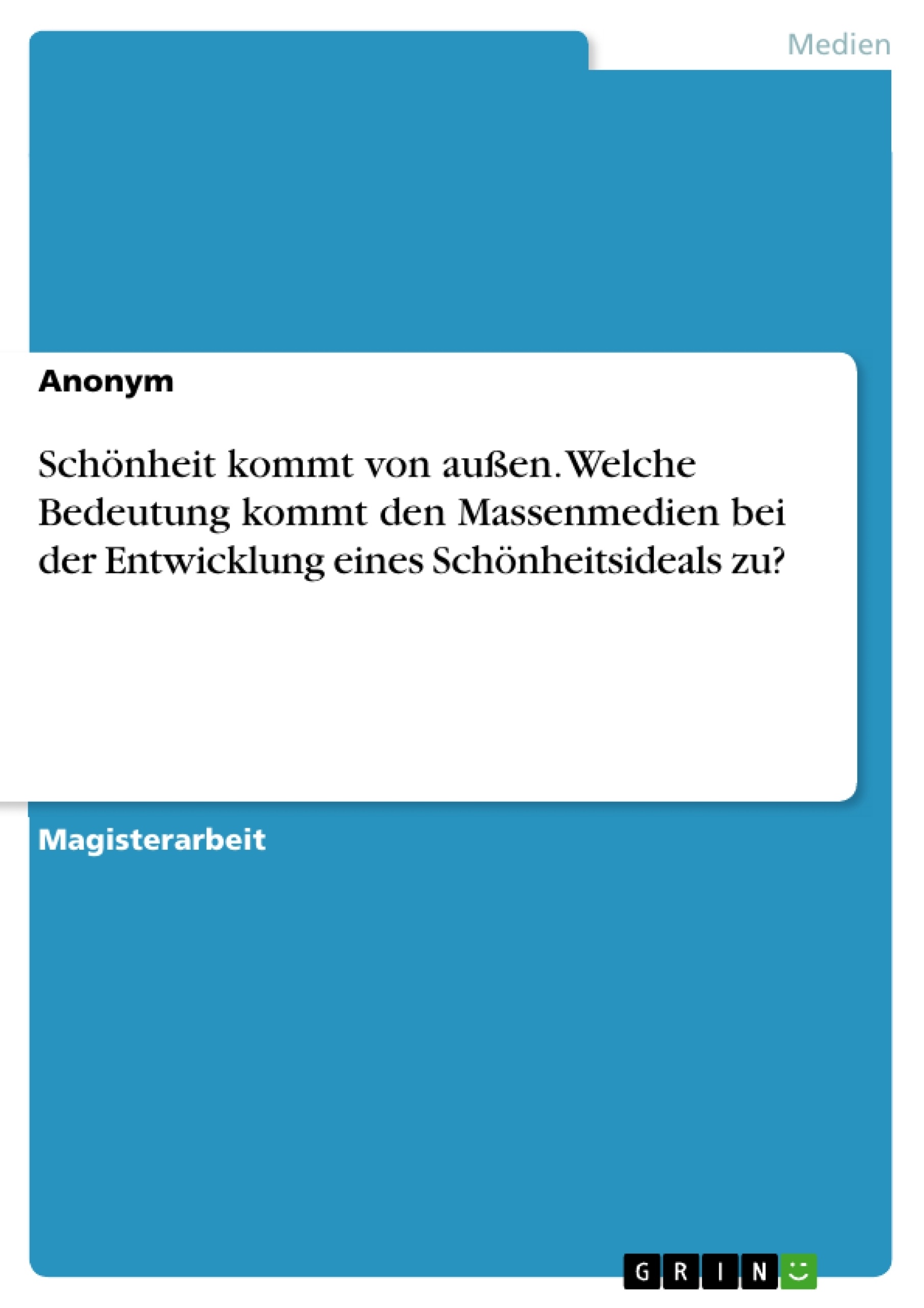"Die Modenschau beginnt, und Siebzehnjährige, die nicht mehr wiegen als ein Magermilchjoghurt, schweben an mir vorbei mit ausdruckslosen Engelsgesichtern, auf denen die Zeit noch keine Zeit gehabt hat, Spuren zu hinterlassen" (von Kürthy 2006: 42).
Soweit die realitätsferne Idealvorstellung der Modeindustrie, bezogen auf eine schöne Frau. Der Alltag vieler Menschen sieht anders aus...
Das Thema dieser Arbeit – "Schönheit kommt von außen. Welche Bedeutung kommt den Massenmedien bei der Entwicklung eines Schönheitsideals zu?" – fragt demnach, ob und wie die von Menschen entwickelten Massenmedien in sozialen Prozessen wirken und ob massenmediale Einflüsse tatsächlich das bestehende Schönheitsideal mit beeinflusst haben. Darüber hinaus soll herausgearbeitet werden, welche weiteren Instanzen, Gruppen oder Institutionen auf die Individuen Einfluss nehmen können und welche pathologischen Ausmaße das derzeitige Ideal im Gegensatz zu früheren Gesellschaften und Völkern annimmt.
Als Ausgangslage wird die These vertreten, dass eine direkte, unreflektierte Beeinflussung der Rezipienten durch die Massenmedien als nicht zutreffend angesehen werden kann.
Durchaus wird der Mensch gelenkt und beeinflusst, allerdings nicht allein durch mediale Reize, sondern durch ganze Märkte (wie Politik, Wirtschaft oder das soziale Umfeld), die an der Schaffung von Illusionen, Bedürfnissen und Idealen beteiligt sind.
Diese Arbeit soll zur Schärfung des Bewusstseins hinsichtlich der bestehenden Schönheitsideale und den damit verbundenen Manipulationen, Machtfragen und Instrumenten beitragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung des Arbeitstitels
- Massenmedien und Massenkommunikation
- Schönheitsideal
- Mediengeschichte
- Schönheitsideale im Wandel der Zeit
- Steinzeit
- Hochkultur Ägypten
- Antike
- Mittelalter
- Renaissance
- Barock
- Rokoko
- 19. Jahrhundert
- 1920er Jahre
- 1950er und 1960er Jahre
- 1980er Jahre
- 1990er Jahre
- Heute
- Schönheitsideale fernab der westlichen Kultur
- Attraktivitätsforschung
- Taille-Hüft-Verhältnis
- Die Faszination am schönen Durchschnittsgesicht
- Gesichtssymmetrie
- Kindchenschema
- Die Bedeutung der Massenmedien im Alltag
- Das Fernsehen
- Internet und Social Media
- Printmedien
- Werbung
- Werbemittel & Werbeträger
- Werbewirkungsmechanismen
- Werbung damals und heute
- Modelle der Werbewirkung
- Stimulus-Response-Modell
- Stimulus-Organismus-Response-Modell
- AIDA-Modell
- Sechs-Stufen-Modell
- Modell der persuasiven Kommunikation
- Uses-and-Gratifications-Approach
- Dynamisch-transaktionales Modell
- Der Beeinflussungsspielraum der Massenmedien
- Der Mythos der wertfreien Massenmedien
- Medienrealität: Nichtmediales und mediales Welterleben
- Das homogenisierte Schönheitsideal der Massenmedien
- Unterschiede zwischen Frauen- und Männermagazinen
- Die Herabsetzung der Frauen im Film
- Cultural Studies
- Der Forschungsbereich der Cultural Studies
- Der Medienbegriff der Cultural Studies
- Körperkonzepte: Was ist ein Körper?
- Die Gesellschaft schreibt sich in den Körper ein
- Soziales Handeln
- Schönheitshandeln
- Schönheitshandeln in den Medien
- Negative Folgen des Schönheitshandelns
- Fitnesswahn
- Kosmetika und Körperpflegemittel
- Diät, Schlanksein und Gesundheit
- Fett-Hass
- Schönheitschirurgie
- Alter
- Schönheit als soziales Kapital: Der Halo-Effekt
- Der soziale Vergleich
- Entwicklung eigener Identität am Beispiel der Mead'schen Rollentheorie
- Der Mensch ist ein Herdentier
- Das Schönheitsideal: individuell oder universell?
- Bedeutung der Schönheit erklärt anhand der Theorie von Pierre Bourdieu
- Körperwahrnehmung und Zufriedenheit
- No fat talk: Wie lassen sich die Medien positiv nutzen?
- Schönheit als Teil des Glücklichseins?
- Medien als Spiegel der Gesellschaft?
- Wer hat Schuld am Schönheitswahn?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Bedeutung von Massenmedien bei der Entwicklung von Schönheitsidealen. Ziel ist es, den Einfluss der Medien auf die Konstruktion und Verbreitung von Schönheitsidealen zu analysieren und die damit verbundenen gesellschaftlichen Auswirkungen zu beleuchten.
- Wandel von Schönheitsidealen im Laufe der Geschichte
- Einfluss der Attraktivitätsforschung auf die Medien
- Wirkungsmechanismen von Werbung auf die Körperwahrnehmung
- Rolle der Medien im Kontext von Körperkonzepten und sozialem Handeln
- Kritik an der Medienkonstruktion von Schönheit und deren Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Magisterarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Fragestellung. Es wird die Forschungsfrage formuliert und die methodische Vorgehensweise skizziert. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Einflusses der Massenmedien auf die Konstruktion von Schönheitsidealen und deren gesellschaftliche Folgen.
Mediengeschichte: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung von Schönheitsidealen in verschiedenen Epochen der Geschichte, von der Steinzeit bis in die Gegenwart. Es werden dabei sowohl westliche als auch nicht-westliche Kulturen betrachtet, um die Vielfältigkeit und den Wandel von Schönheitsidealen aufzuzeigen und die Rolle kultureller und gesellschaftlicher Faktoren zu beleuchten. Der Vergleich verschiedener Epochen ermöglicht die Herausarbeitung von Kontinuitäten und Brüchen in der Wahrnehmung von Schönheit.
Attraktivitätsforschung: Dieses Kapitel befasst sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Attraktivitätsforschung. Es analysiert Faktoren wie das Taille-Hüft-Verhältnis, die Gesichtssymmetrie und das Kindchenschema, die als objektive Maßstäbe für Attraktivität gelten. Der Zusammenhang zwischen diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der medialen Darstellung von Schönheit wird diskutiert. Dies legt den Grundstein für das Verständnis, wie diese wissenschaftlichen Erkenntnisse von den Medien aufgegriffen und gegebenenfalls instrumentalisiert werden.
Die Bedeutung der Massenmedien im Alltag: Dieses Kapitel analysiert den alltäglichen Einfluss von Fernsehen, Internet und Printmedien auf die Wahrnehmung von Schönheit. Es werden die verschiedenen Kanäle und deren spezifische Wirkungsmöglichkeiten untersucht, um zu zeigen, wie diese Medien unser Bild von Schönheit prägen und beeinflussen. Hier wird die omnipräsente Wirkung der Medien auf die Konstruktion von Schönheit verdeutlicht.
Werbung: Der Abschnitt befasst sich mit den Werbemitteln und -trägern, den Werbewirkungsmechanismen und dem Vergleich von Werbung früher und heute. Es werden die unterschiedlichen Strategien und Techniken der Werbung untersucht, die darauf abzielen, Konsumverhalten zu beeinflussen und Schönheitsideale zu etablieren. Die Analyse von Werbestrategien ermöglicht ein Verständnis dafür, wie die Medien gezielt Schönheitsideale verbreiten und diese mit Produkten und Dienstleistungen verknüpfen.
Modelle der Werbewirkung: Hier werden verschiedene Modelle der Werbewirkung vorgestellt und analysiert, wie z.B. das Stimulus-Response-Modell, das AIDA-Modell und das Uses-and-Gratifications-Approach. Der Vergleich verschiedener Modelle ermöglicht ein umfassenderes Verständnis der komplexen Wirkungsmechanismen und den unterschiedlichen Ansätzen der Beeinflussung. Dies liefert wichtige theoretische Grundlagen für die Analyse der Medienwirkung.
Der Beeinflussungsspielraum der Massenmedien: Dieser Abschnitt untersucht den Einfluss der Medien auf die Konstruktion eines homogenisierten Schönheitsideals und beleuchtet kritisch den Mythos der wertfreien Massenmedien. Es werden Unterschiede zwischen der Darstellung von Schönheit in Frauen- und Männermagazinen analysiert und die kritische Auseinandersetzung mit der medialen Darstellung von Frauen im Film verdeutlicht. Hier wird die kritische Perspektive auf die mediale Konstruktion von Schönheit eingenommen.
Cultural Studies: Das Kapitel stellt den Forschungsbereich der Cultural Studies und dessen Medienbegriff vor, um ein theoretisches Fundament für die Analyse der gesellschaftlichen Konstruktion von Schönheit zu schaffen. Dies liefert einen soziologischen Rahmen zur Interpretation der medialen Darstellung von Schönheit.
Körperkonzepte: Was ist ein Körper?: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Konzepte von Körperlichkeit und deren gesellschaftliche Bedeutung. Es beleuchtet die soziale Konstruktion des Körpers und seine Bedeutung im Kontext von Schönheitsidealen.
Die Gesellschaft schreibt sich in den Körper ein: Hier wird die Verknüpfung von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen mit der Körperwahrnehmung analysiert. Es werden die Mechanismen untersucht, wie gesellschaftliche Ideale in den Körper eingeschrieben werden.
Soziales Handeln: Dieses Kapitel analysiert Schönheitshandeln in den Medien und dessen negative Folgen (Fitnesswahn, Kosmetika, Diäten, Schönheitschirurgie etc.). Es wird der Einfluss des Schönheitsideals auf die Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl untersucht, einschließlich des sozialen Vergleichs und des Halo-Effekts. Die gesellschaftlichen Folgen des Schönheitsideals werden beleuchtet.
Entwicklung eigener Identität am Beispiel der Mead'schen Rollentheorie: In diesem Kapitel wird die Entwicklung der eigenen Identität im Kontext der Mead'schen Rollentheorie betrachtet. Der Zusammenhang zwischen Identität, Selbstwahrnehmung und den Medien wird analysiert.
Der Mensch ist ein Herdentier: Das Kapitel beleuchtet den Einfluss sozialer Gruppen und des Gruppenzwangs auf die Entwicklung von Schönheitsidealen und die Körperwahrnehmung.
Das Schönheitsideal: individuell oder universell?: Die Frage nach der individuellen vs. universellen Natur von Schönheitsidealen wird in diesem Kapitel erörtert.
Bedeutung der Schönheit erklärt anhand der Theorie von Pierre Bourdieu: Hier wird die Bedeutung von Schönheit im Kontext von Pierre Bourdieus Theorie des sozialen Kapitals beleuchtet.
Körperwahrnehmung und Zufriedenheit: Der Abschnitt betrachtet den Zusammenhang zwischen Körperwahrnehmung, Medienkonsum und Zufriedenheit, und diskutiert Wege, Medien positiv für die Körperwahrnehmung zu nutzen.
Medien als Spiegel der Gesellschaft?: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Medien als Spiegel der Gesellschaft und deren Einfluss auf die Entwicklung von Schönheitsidealen.
Wer hat Schuld am Schönheitswahn?: Abschließend werden die Verantwortlichkeiten für den Schönheitswahn diskutiert.
Schlüsselwörter
Schönheitsideal, Massenmedien, Attraktivitätsforschung, Werbung, Körperwahrnehmung, Soziales Handeln, Cultural Studies, Medienwirkung, Identität, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Der Einfluss der Massenmedien auf die Konstruktion von Schönheitsidealen
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Einfluss der Massenmedien auf die Entwicklung und Verbreitung von Schönheitsidealen und deren gesellschaftliche Auswirkungen. Es wird analysiert, wie Medien die Konstruktion von Schönheit beeinflussen und welche Folgen dies für die Körperwahrnehmung und das Selbstwertgefühl von Individuen hat.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt einen breiten Themenkomplex, der die historische Entwicklung von Schönheitsidealen, die Erkenntnisse der Attraktivitätsforschung, die Wirkungsmechanismen von Werbung, die Rolle der Medien im Kontext von Körperkonzepten und sozialem Handeln sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der Medienkonstruktion von Schönheit umfasst. Die Arbeit betrachtet verschiedene Medien wie Fernsehen, Internet, Printmedien und befasst sich mit verschiedenen theoretischen Ansätzen wie den Cultural Studies und der Rollentheorie nach Mead.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in verschiedene Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und einer Definition des Arbeitstitels. Es folgen Kapitel zur Mediengeschichte mit einer Analyse der Schönheitsideale in verschiedenen Epochen, zur Attraktivitätsforschung, zur Bedeutung der Massenmedien im Alltag, zur Werbung und deren Wirkungsmodellen. Weitere Kapitel befassen sich mit dem Beeinflussungsspielraum der Massenmedien, den Cultural Studies, Körperkonzepten, sozialem Handeln und der Entwicklung der eigenen Identität. Die Arbeit schließt mit Kapiteln zur Körperwahrnehmung, zur Frage nach der individuellen oder universellen Natur von Schönheitsidealen und einer Diskussion der Verantwortlichkeiten für den Schönheitswahn.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit skizziert eine methodische Vorgehensweise in der Einleitung, die jedoch im gegebenen Preview nicht im Detail erläutert wird. Die Analyse basiert auf einer Kombination aus historischer Betrachtung, wissenschaftlichen Erkenntnissen der Attraktivitätsforschung und theoretischen Ansätzen der Medien- und Kulturwissenschaften. Es wird sowohl eine deskriptive als auch eine kritische Analyse der Medienwirkung durchgeführt.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Schönheitsideal, Massenmedien, Attraktivitätsforschung, Werbung, Körperwahrnehmung, Soziales Handeln, Cultural Studies, Medienwirkung, Identität und Gesellschaft.
Welche konkreten Fragestellungen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht den Wandel von Schönheitsidealen im Laufe der Geschichte, den Einfluss der Attraktivitätsforschung auf die Medien, die Wirkungsmechanismen von Werbung auf die Körperwahrnehmung, die Rolle der Medien im Kontext von Körperkonzepten und sozialem Handeln sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der Medienkonstruktion von Schönheit und deren Folgen. Die Arbeit beleuchtet auch die Frage nach der individuellen oder universellen Natur von Schönheitsidealen und analysiert die Verantwortlichkeiten für den Schönheitswahn.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit sind im vorliegenden Preview nicht explizit dargestellt. Die Zusammenfassung der Kapitel deutet jedoch darauf hin, dass die Arbeit eine kritische Auseinandersetzung mit dem Einfluss der Massenmedien auf die Konstruktion von Schönheitsidealen und deren gesellschaftlichen Folgen liefern wird.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für die Themen Schönheitsideale, Medienwirkung, Körperwahrnehmung und gesellschaftliche Normen interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende der Medienwissenschaft, Soziologie, Kommunikationswissenschaft und verwandter Disziplinen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Schönheit kommt von außen. Welche Bedeutung kommt den Massenmedien bei der Entwicklung eines Schönheitsideals zu?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288975