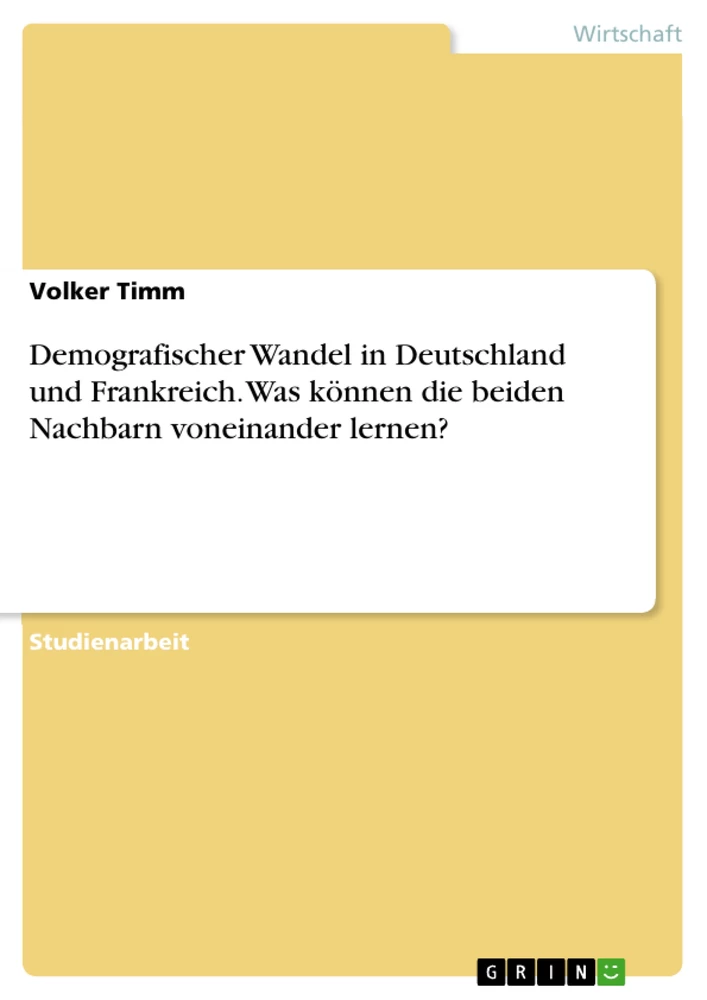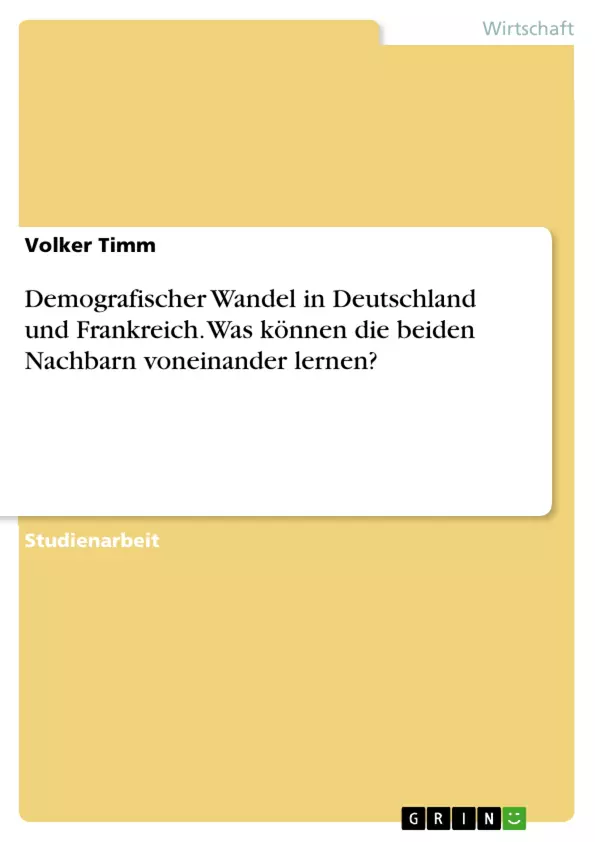Die Entwicklung der Weltbevölkerung kennt nur eine Richtung: steil nach oben. Lebten im Jahr 1950 etwa 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde, sind es zurzeit etwa sieben Milliarden. Modellrechnungen der Vereinten Nationen (UN) gehen von elf Milliarden Menschen im Jahr 2100 aus.
Diese eigentlich positive Entwicklung ist jedoch problematisch: bereits im Jahr 2001 standen einer Milliarde gut bzw. sogar überernährter Weltbürger eine Milliarde Hungernde gegenüber.
Erschwerend kommt hinzu, dass die höchsten Geburtenraten in den Ländern zu verzeichnen sind, die zu den ärmsten der Welt zählen. Hier liegt diese Rate bei 4,2 Geburten je Frau. Das ist doppelt so hoch, wie das Bestandserhaltungsniveau von 2,1 Geburten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problembeschreibung
- Ziel der Hausarbeit
- Verlauf der Hausarbeit
- Demografischer Wandel in Deutschland und Frankreich
- Zukünftige Auswirkungen des demografischen Wandels in der Bundesrepublik
- Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit 1871
- Bevölkerungssituation in Frankreich
- Bevölkerungssituation heute
- Bevölkerungssituation 2050
- Vergleichende Betrachtung Deutschland und Frankreich
- Entwicklung der Gesamtbevölkerungen
- Geburtenraten
- Wanderungsbewegungen
- Alterung
- Handlungsempfehlungen für Gegenstrategien
- Deutschland - (k)ein Einwanderungsland?
- Familienförderung in Deutschland
- Ist der französische Sozialstaat zukunftsfähig?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Elektronische Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den demografischen Wandel in Deutschland und Frankreich und untersucht die Auswirkungen auf die beiden Volkswirtschaften. Ziel ist es, die Ursachen des Wandels zu identifizieren und Handlungsempfehlungen für Gegenstrategien zu entwickeln. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Länder und der Identifizierung von Best-Practice-Beispielen.
- Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Wirtschaft und Gesellschaft
- Vergleich der demografischen Entwicklung in Deutschland und Frankreich
- Analyse von Handlungsempfehlungen zur Bewältigung des demografischen Wandels
- Bewertung der Zukunftsfähigkeit der Sozialsysteme in Deutschland und Frankreich
- Identifizierung von Best-Practice-Beispielen für die Bewältigung des demografischen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des demografischen Wandels dar und erläutert die Zielsetzung der Hausarbeit. Kapitel 2 beleuchtet die demografische Entwicklung in Deutschland und Frankreich, wobei die Bevölkerungsentwicklung seit 1871 sowie die aktuelle und zukünftige Situation im Fokus stehen. Kapitel 3 vergleicht die demografische Entwicklung der beiden Länder anhand von Kennzahlen wie Geburtenraten, Wanderungsbewegungen und Alterung. Kapitel 4 präsentiert Handlungsempfehlungen für Gegenstrategien, die sich auf die Einwanderungspolitik, Familienförderung und die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaates konzentrieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den demografischen Wandel, die Bevölkerungsentwicklung, die Geburtenrate, die Alterung der Gesellschaft, die Einwanderungspolitik, die Familienförderung, den Sozialstaat, Deutschland und Frankreich. Die Hausarbeit analysiert die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die beiden Länder und entwickelt Handlungsempfehlungen für Gegenstrategien.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und Frankreich?
Frankreich weist traditionell eine höhere Geburtenrate auf als Deutschland, was zu einer langsameren Alterung der Gesellschaft führt.
Was sind die Hauptgründe für den demografischen Wandel?
Wesentliche Faktoren sind sinkende Geburtenraten und eine gleichzeitig steigende Lebenserwartung, was das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Rentnern verschiebt.
Welche Rolle spielt die Einwanderungspolitik in diesem Kontext?
Die Arbeit diskutiert, inwieweit gezielte Zuwanderung den Fachkräftemangel abmildern und die Sozialsysteme stabilisieren kann.
Was kann Deutschland von der französischen Familienpolitik lernen?
Frankreich bietet oft eine bessere Infrastruktur für Kinderbetreuung und steuerliche Anreize, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert.
Sind die Sozialsysteme beider Länder zukunftsfähig?
Die Untersuchung analysiert Reformbedarf in den Renten- und Gesundheitssystemen, um den Herausforderungen einer alternden Bevölkerung gerecht zu werden.
- Citation du texte
- Volker Timm (Auteur), 2015, Demografischer Wandel in Deutschland und Frankreich. Was können die beiden Nachbarn voneinander lernen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293162