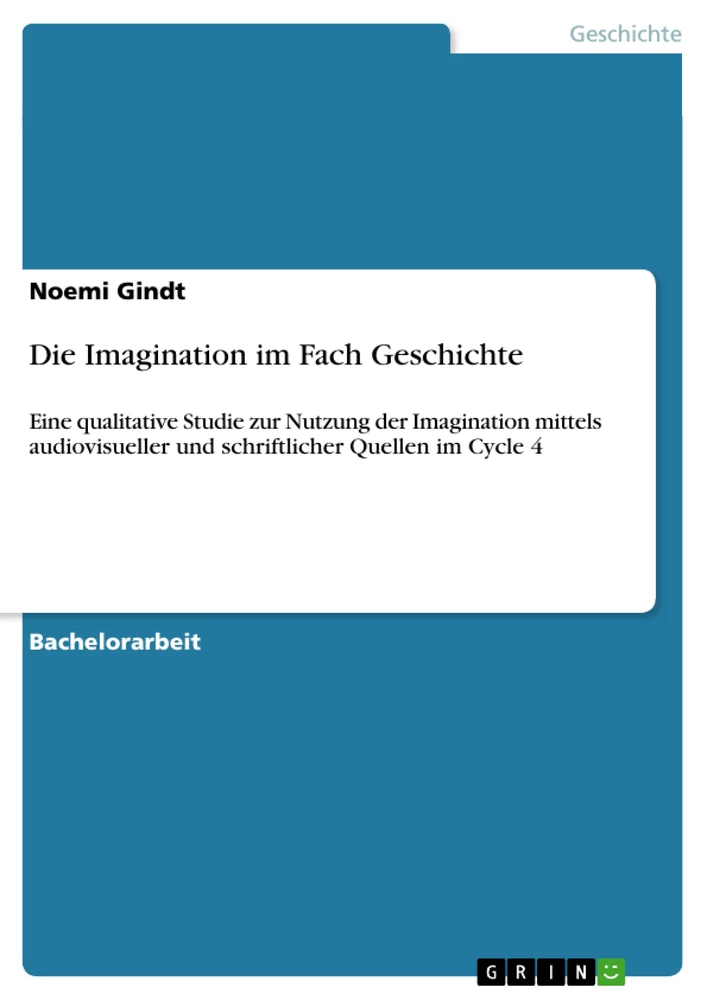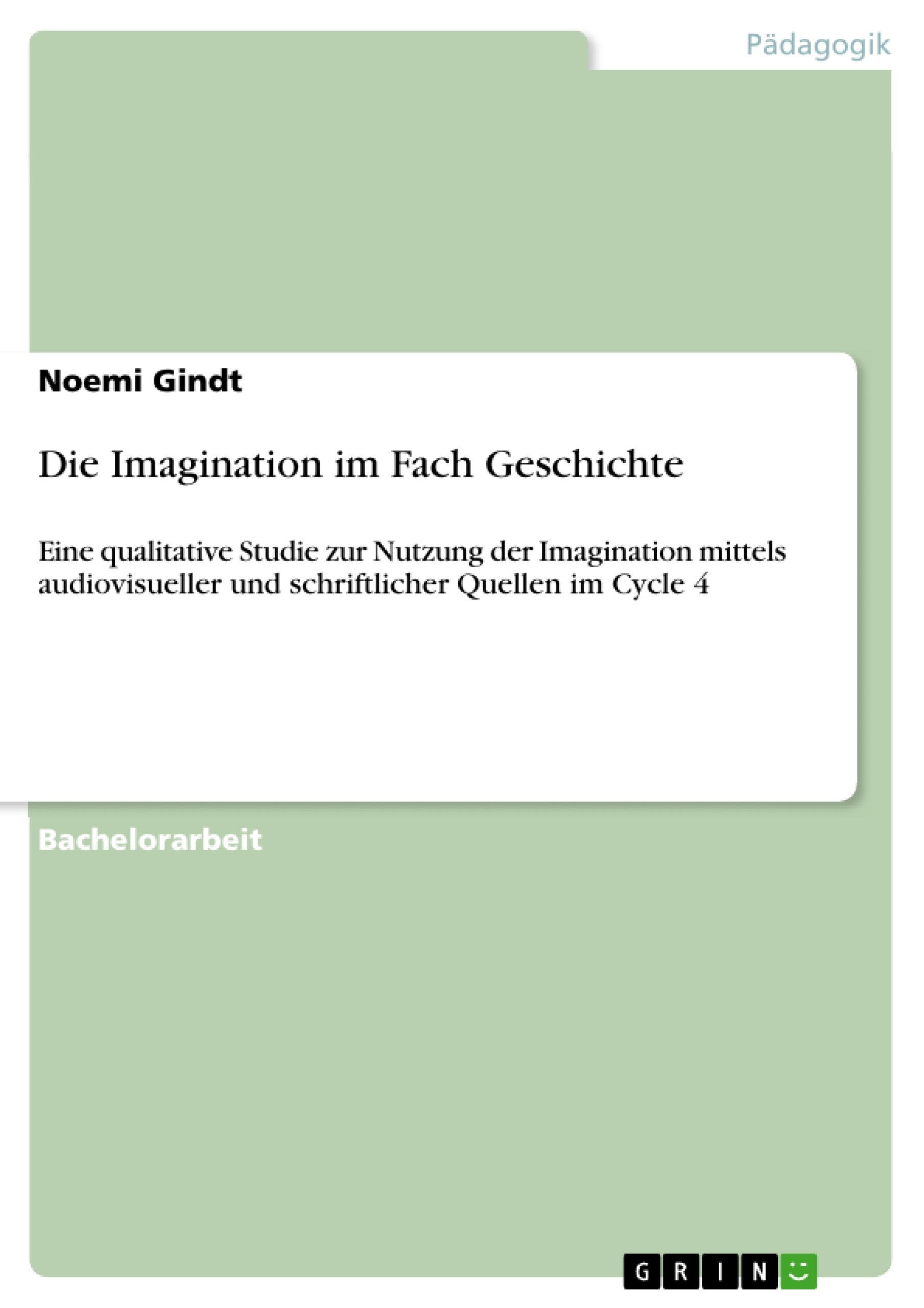Auch wenn die Imagination als pädagogischer Ansatz bis zu diesem Zeitpunkt noch wenig erforscht ist, kann behauptet werden, dass sie eine gewisse Rolle beim Lernen und Verstehen spielt. Besonders im Fach Geschichte scheint sie eine Voraussetzung zu sein, um die SchülerInnen auf anschauliche Weise an historische Ereignisse heranzuführen. Daher beschäftigt sich diese Studie mit der Bedeutung der Imagination im Fach Geschichte und geht darauf ein, wie SchülerInnen mit Hilfe ihrer eigenen Imagination Vergangenes kennen lernen und verstehen können. Genauer analysiert sie, welche Unterschiede es bei den imaginativen Prozessen gibt, wenn die SchülerInnen historische Themen mittels audiovisueller bzw. schriftlicher Quellen erarbeiten. Ziel dieser Arbeit ist es neue, pädagogische und didaktische
Vorgehensweisen in Bezug auf imaginative Aufgaben im Fach Geschichte zu erfassen.
Hierfür wurden unterschiedliche Aktivitäten mit einer Klasse von 14 SchülerInnen durchgeführt. Während einerseits das Thema des Mittelalters mit Hilfe von audiovisuellen Quellen erarbeitet wurde, eigneten sich andererseits die SchülerInnen
das Thema der Hexenverfolgung durch schriftliche Quellen an. Zu jedem der beiden Themen wurden unterschiedliche imaginative Aufgaben durchgeführt. Die Daten wurden anhand einer Produktanalyse, einer qualitativen Beobachtung, und einer
qualitativen Befragung der SchülerInnen, sowie des Klassenlehrers erhoben.
Die Ergebnisse fielen unterschiedlich aus. Während die Art der Quellen einen gewissen Einfluss auf die inneren Vorstellungsbilder der SchülerInnen ausübte, schien es bei der
Empathiefähigkeit keine Rolle zu spielen, mit welchen Quellen sie arbeiteten. Eine bedeutende Rolle bei imaginativen Aufgaben spielten auch die Bilder der audiovisuellen Quellen, da sie zu einem besseren Verständnis, sowie zu einem
größeren Lernzuwachs beitrugen. Sollten jedoch Vorstellungsbilder de- und rekonstruiert werden, so hing der Erfolg nicht von der Art der Quellen ab, sondern eher von der Form der Konfrontation der SchülerInnen mit der Thematik. Aus dieser Studie geht schlussendlich hervor, dass die audiovisuellen Quellen einen interessanten Ausgangspunkt für imaginative Aufgaben darstellen und nicht als Antagonismus der Imagination fungieren.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Résumé
- Danksagungen
- 1. Einleitung
- 1.1. Die Imagination im Fach Geschichte
- 1.2. Forschungsfrage und Zielsetzung
- 1.3. Forschungsdesign und Methodik
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1. Imagination
- 2.2. Imagination im Fach Geschichte
- 2.3. Empathie
- 2.4. Quellen im Geschichtsunterricht
- 3. Methodisches Vorgehen
- 3.1. Forschungsdesign
- 3.2. Stichprobe
- 3.3. Datenerhebung
- 3.4. Datenanalyse
- 4. Ergebnisse
- 4.1. Die Rolle der Quellen
- 4.2. Die Rolle der Bilder
- 4.3. Die Rolle der Empathie
- 5. Diskussion
- 5.1. Die Bedeutung der Imagination im Fach Geschichte
- 5.2. Die Rolle der Quellen
- 5.3. Die Rolle der Bilder
- 5.4. Die Rolle der Empathie
- 6. Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Bedeutung der Imagination im Fach Geschichte und untersucht, wie SchülerInnen mit Hilfe ihrer eigenen Imagination Vergangenes kennen lernen und verstehen können. Die Arbeit analysiert die Unterschiede in den imaginativen Prozessen, wenn SchülerInnen historische Themen mittels audiovisueller bzw. schriftlicher Quellen erarbeiten. Ziel ist es, neue pädagogische und didaktische Vorgehensweisen in Bezug auf imaginative Aufgaben im Fach Geschichte zu erfassen.
- Die Rolle der Imagination im Geschichtsunterricht
- Der Einfluss von audiovisuellen und schriftlichen Quellen auf die Imagination
- Die Bedeutung von Bildern für das Verständnis und den Lernzuwachs
- Die Rolle der Empathie bei imaginativen Aufgaben
- Neue pädagogische und didaktische Ansätze für imaginative Aufgaben im Fach Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Imagination im Fach Geschichte ein und erläutert die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit. Sie beschreibt das Forschungsdesign und die Methodik, die für die Studie verwendet wurden.
Das zweite Kapitel stellt den theoretischen Rahmen der Arbeit dar. Es werden die Konzepte der Imagination, der Empathie und der Quellen im Geschichtsunterricht beleuchtet. Dabei wird insbesondere auf die Bedeutung der Imagination für das Verstehen historischer Ereignisse eingegangen.
Das dritte Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Studie. Es werden das Forschungsdesign, die Stichprobe, die Datenerhebung und die Datenanalyse erläutert.
Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es werden die Auswirkungen der Art der Quellen, der Bilder und der Empathie auf die imaginativen Prozesse der SchülerInnen untersucht.
Das fünfte Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie und beleuchtet die Bedeutung der Imagination im Fach Geschichte, die Rolle der Quellen, der Bilder und der Empathie. Es werden Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen für die Praxis gegeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Imagination, die Empathie, das Schulfach Geschichte, audiovisuelle und schriftliche Quellen sowie Kinder. Die Arbeit untersucht, wie die Imagination im Geschichtsunterricht eingesetzt werden kann, um SchülerInnen zum Verstehen historischer Ereignisse zu befähigen. Dabei wird der Einfluss von verschiedenen Quellenarten auf die imaginativen Prozesse der SchülerInnen analysiert. Die Studie beleuchtet die Bedeutung von Bildern für das Verständnis und den Lernzuwachs sowie die Rolle der Empathie bei imaginativen Aufgaben.
- Arbeit zitieren
- Noemi Gindt (Autor:in), 2014, Die Imagination im Fach Geschichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293654