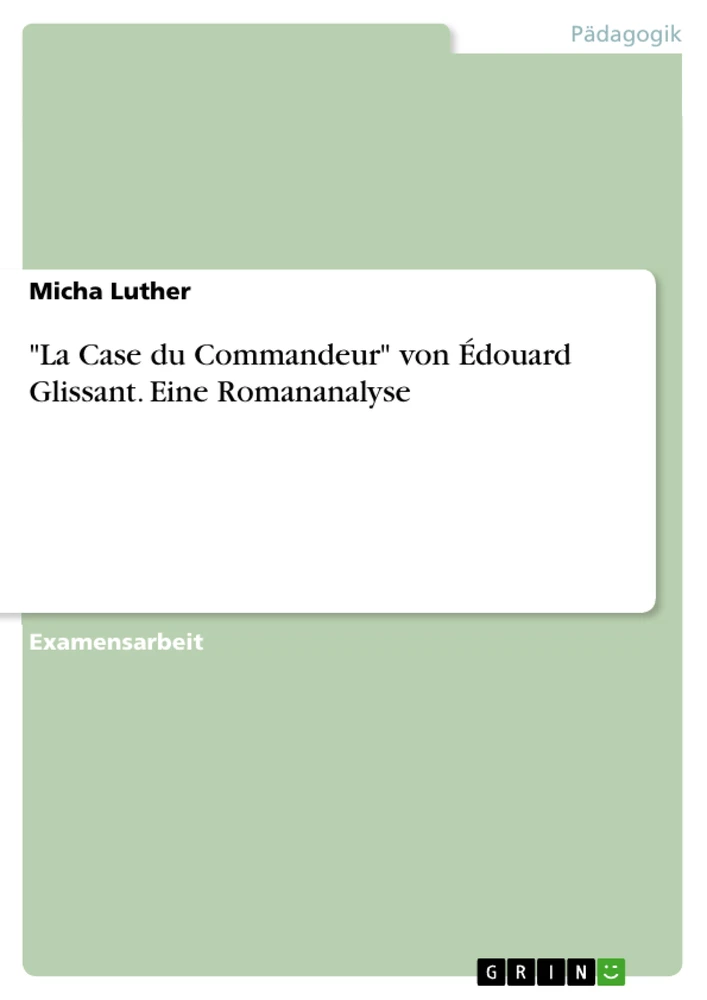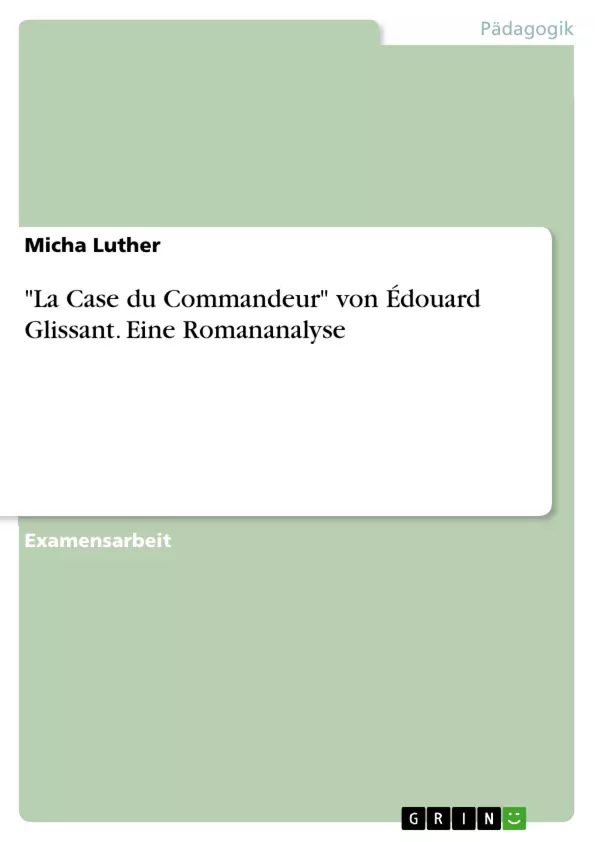In dieser Arbeit sollen zunächst die wichtigsten Themen und Begriffe erläutert werden, die Glissant im Discours antillais (1981) behandelt. Von der dépossession der Antillaner über die aufgezwungene Histoire bis hin zur exploration créatrice und der Möglichkeit, durch literarisches Schaffen das kollektive Bewusstsein zu stärken. Daraufhin soll eine exemplarische Analyse des Romans La case du commandeur (1981) erfolgen. Dabei soll insbesondere untersucht werden, inwieweit die im Discours antillais behandelte Thematik im Roman wieder aufgegriffen und verarbeitet wird. Im Mittelpunkt wird die Frage stehen, wie die Konflikte der antillanischen Gesellschaft im Roman dargestellt werden und mit welchen literarischen Mitteln Glissant versucht, die rhizomatisch vernetzte Spurensuche der Protagonisten zu veranschaulichen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Le Discours antillais
- II.1. Die Krise der Antillen
- II.1.1. Retour und Détour
- II.1.2. Das délire verbal
- II.1.3. Dépossession
- II.1.4. Unproduktivität
- II.1.5. Ambivalenz
- II.1.6. ,,Recherche d'identité"
- II.2. Die kreative Erforschung der Geschichte
- II.2.1. Literatur und Geschichte: Mythos und Märchen
- II.2.2. Das Wir
- II.2.3. Literarische Techniken
- II.2.4. Die Landschaft im amerikanischen Roman
- II.2.5. Oralität und Schrift
- II.2.6. Die Kreolsprache
- III. La case du commandeur
- III.1. Aufbau
- III.2. Die Geschichte der Familie Celat
- III.2.1. Reflexionen über das Wir
- III.2.2. Die Geburt Mycéas
- III.2.3. Die Nachforschungen Pythagores
- III.2.4. Ozonzos Märchen
- III.2.5. Auguste Celat und der Aufseher Euloge
- III.2.6. Anatolie Celat, der Geschichtenerzähler
- III.3. Mycéa auf der Trace du Temps d'Avant
- III.3.1. Die Generation der Nachkriegszeit
- III.3.2. Patrice Celat
- III.3.3. Odono Celat
- III.3.4. Marie Celats délire
- III.3.5. Die Hütte des Aufsehers
- IV. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert Édouard Glissants Roman „La case du commandeur" und setzt ihn in Beziehung zu seinem einflussreichen Essay „Discours antillais". Die Arbeit untersucht die zentralen Themen der antillanischen Identität, der Dekolonisierung und der Suche nach einer neuen Geschichte, die von der Erfahrung der Sklaverei und den Folgen des Kolonialismus geprägt ist.
- Die Krise der antillanischen Identität: Die Folgen der Kolonialisierung und die Suche nach einer neuen Selbstdefinition
- Die Dépossession der Antillaner: Enteignungsprozesse und die Entfremdung von Raum und Zeit
- Die Exploration Créatrice: Glissants Konzept einer kreativen Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Suche nach einer neuen Erzählform
- Die Bedeutung der Literatur: Der Roman als Mittel der Bewusstseinsbildung und der Kritik an kolonialen Strukturen
- Die Suche nach einer neuen Geschichte: Die „Non-Histoire" der Antillen und die Notwendigkeit, die Geschichte aus einer nicht-linearen Perspektive zu betrachten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Glissants Werk in den Kontext der antillanischen Literatur und skizziert die zentralen Thesen des Discours antillais. Das zweite Kapitel analysiert die Krisensituation der Antillen, die durch Kolonialisierung und Dépossession geprägt ist. Es beleuchtet die verschiedenen Symptome dieser Krise, wie etwa das Délire verbal, die Unproduktivität und die Ambivalenz der antillanischen Identität. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Glissants Konzept der „Exploration Créatrice" und seiner Analyse der Beziehung zwischen Literatur und Geschichte.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie Dépossession, Non-Histoire, Exploration Créatrice, Délire verbal, Ambivalenz und der Suche nach einer neuen antillanischen Identität. Im Fokus stehen die Auswirkungen der Kolonialisierung auf die antillanische Gesellschaft und die Rolle der Literatur in der Dekolonisierung und der Bewusstseinsbildung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Themen behandelt Édouard Glissant in seinem Werk?
Glissant thematisiert die antillanische Identität, die Folgen der Sklaverei, die Enteignung (Dépossession) und die Suche nach einer eigenen Geschichte.
Was bedeutet der Begriff „Dépossession“?
Er beschreibt die materielle und geistige Enteignung der Antillaner durch den Kolonialismus, was zu einer Entfremdung von Raum und Zeit führt.
Was versteht Glissant unter „Exploration Créatrice“?
Es ist das Konzept einer kreativen Erforschung der Geschichte durch Literatur, um das kollektive Bewusstsein der antillanischen Gesellschaft zu stärken.
Welche Rolle spielt die Sprache in seinem Roman?
Glissant untersucht das Spannungsfeld zwischen Oralität (Mündlichkeit), der Kreolsprache und der schriftlichen französischen Literatur.
Worum geht es in „La case du commandeur“?
Der Roman analysiert die Geschichte der Familie Celat und ihre rhizomatische Spurensuche nach der eigenen Vergangenheit und Identität.
- Citation du texte
- Micha Luther (Auteur), 2014, "La Case du Commandeur" von Édouard Glissant. Eine Romananalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293693