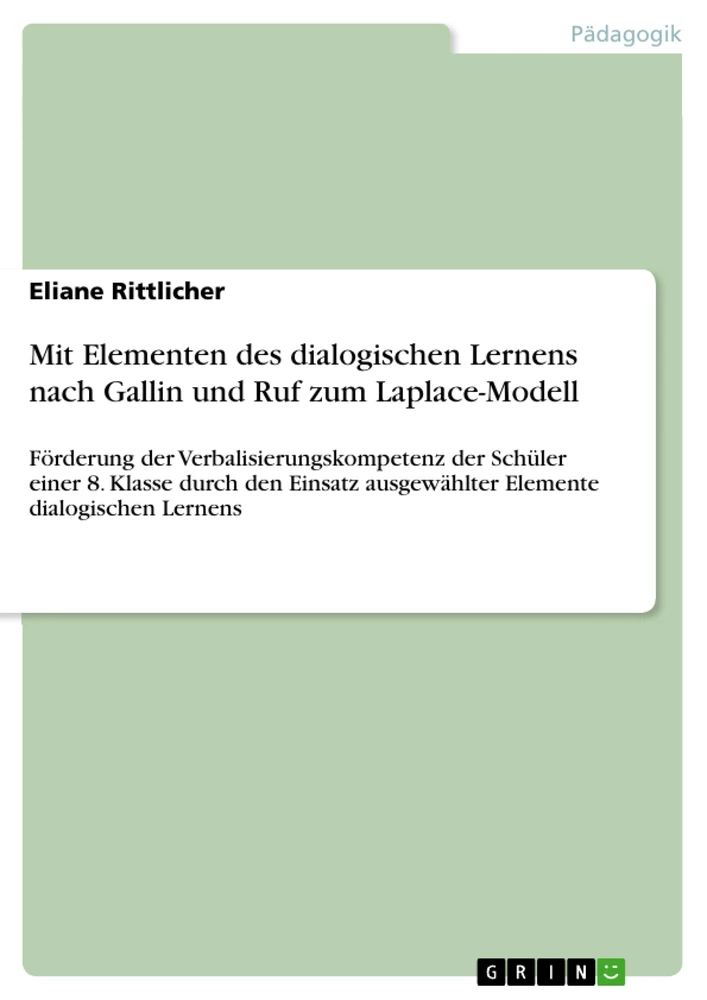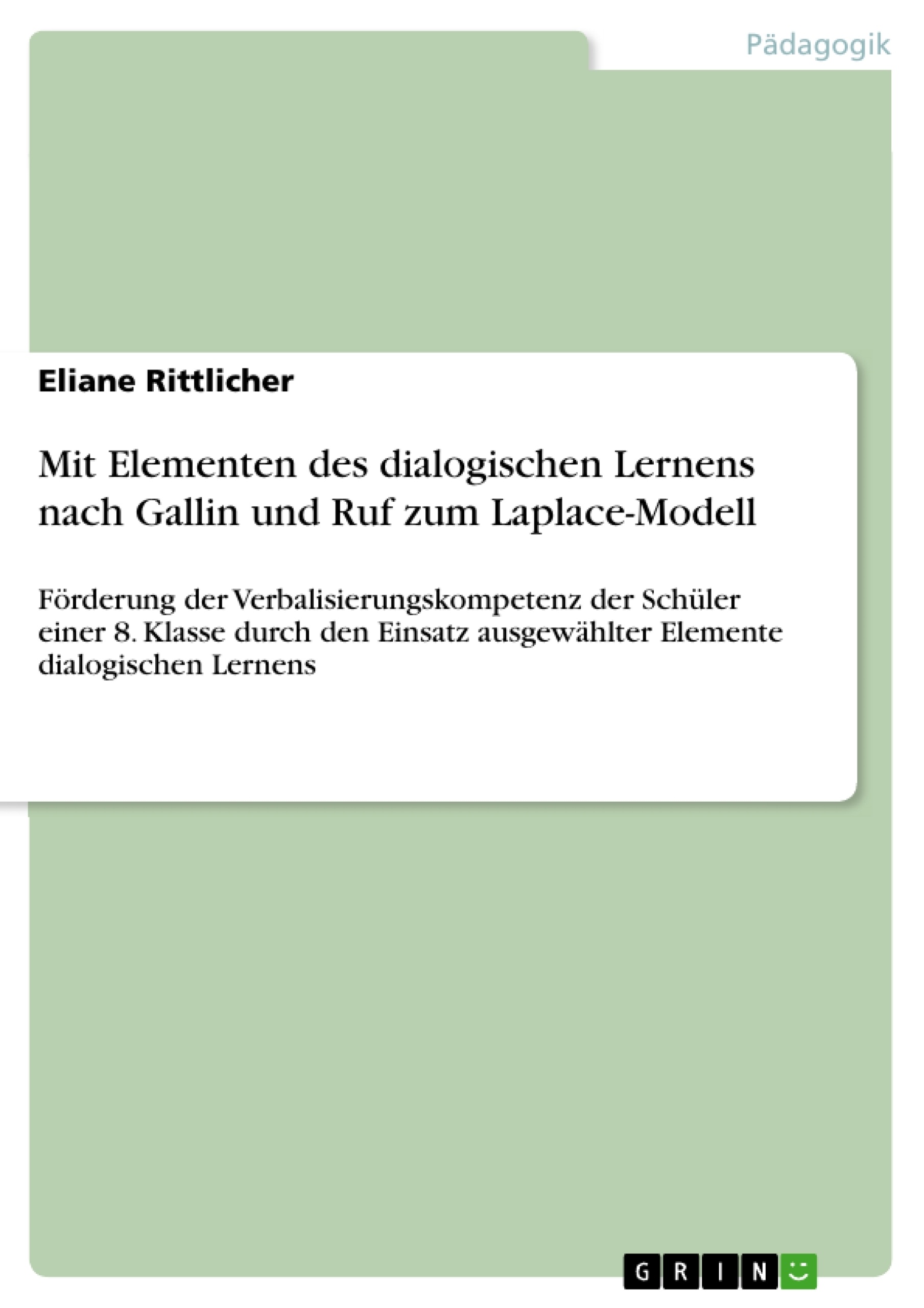Ein geeignetes Mittel, um dem gedankenlosen Hantieren mit Formeln und Verfahren zu begegnen und die Sprachkompetenz der S. zu fördern, ist das Schreiben von Lerntagebüchern. Die Schweizer Gymnasiallehrer Peter Gallin (Mathematik) und Urs Ruf (Deutsch) haben auf dem Gebiet der Lerntagebücher „Pionierarbeit“ geleistet. Gallin und Ruf entwickelten ihr Konzept des dialogischen Lernens für den Mathematik- und Deutschunterricht mit dem Ziel, den als defizitär empfundenen schulischen Rahmenbedingungen eine praxisorientierte Alternative entgegenzusetzen. Das dialogische Lernen ist keine Methode, die man nach Bedarf und Zielvorstellung auswählt, sondern eine Grundhaltung, die den ganzen Unterricht prägt. Das Verhältnis der Lehrperson zu den S. ist nicht das eines Belehrenden gegenüber Weniger-Wissenden, sondern das eines interessierten Zuhörers, der jeden Einzelnen ermuntert zu erzählen, „wie er es macht“, und Hilfe zur Selbsthilfe leistet, statt die standardisierte Lösung vorzugeben. Die Bereitschaft der S., ihre Überlegungen offenzulegen, setzt Vertrauen in ein wohlwollendes und fachkundiges Gegenüber voraus. Aus diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis ergeben sich Konsequenzen für alle Bereiche des Unterrichts, die sich auch in den 4 Instrumenten des dialogischen Lernens widerspiegeln: 1. Orientierung des Unterrichts an Kernideen, 2. Stellen von Aufträgen, die zum Forschen anregen, 3. Führen eines Lerntagebuchs, in dem die S. Spuren ihres Lernprozesses hinterlassen und 4. Nutzbarmachen der individuellen Entdeckungen für den Fortgang des Unterrichts.
In der vorliegenden Arbeit geht es um die Umsetzung des dialogischen Lernens in der Klasse 8x eines Gymnasiums. Das dafür zugrunde liegende Stoffgebiet sind das Laplace-Modell und die Summenregel. Die zentrale Fragestellung dabei ist: „Inwieweit sind die zentralen Elemente des dialogischen Lernens zur Förderung der Verbalisierungskompetenz geeignet?“ Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Leitfragen: 1. Inwieweit sind die S. der Klasse 8x dazu zu bewegen, sich schriftlich mit mathematischen Fragestellungen auseinanderzusetzen? 2. Welche Aspekte des dialogischen Lernens fördern dabei die intrinsische bzw. extrinsische Motivation? 3. Spricht das Konzept des dialogischen Lernens gleichermaßen leistungsschwache wie leistungsstarke S. an?
Im Anhang: Planungsübersicht zur Reihe und Schülerprodukte
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mathematik und Sprache
- Der didaktische Ort der Sprache im Mathematikunterricht
- Die Verbalisierungskompetenz im Mathematikunterricht
- Definition und Abgrenzung
- Förderung
- Das Konzept des dialogischen Lernens in Grundzügen
- Die Kernidee
- Der Auftrag
- Das Lerntagebuch
- Rückmeldung und Beurteilung durch die Lehrperson
- Folgerungen für das Unterrichtsvorhaben
- Planung der Unterrichtsreihe
- Die Lerngruppe
- Allgemeine Voraussetzungen
- Spezielle Voraussetzungen
- Sachstrukturanalyse
- Das Laplace-Modell im Unterricht
- Angestrebter Kompetenzzuwachs
- Fachkompetenz
- Aspekte der Verbalisierungskompetenz
- Erfassung von Aspekten der Verbalisierungskompetenz
- Aufbau der Unterrichtsreihe
- Erläuterung der Planung
- Die Kernidee
- Der erste Auftrag
- Der zweite Auftrag
- Erarbeitung von Summenregel und Laplace-Modell
- Die Nutzung des Laplace-Modells
- Die Lerngruppe
- Das Konzept des dialogischen Lernens
- Die Förderung der Verbalisierungskompetenz im Mathematikunterricht
- Die Erarbeitung des Laplace-Modells
- Die Anwendung des Laplace-Modells in verschiedenen Anwendungskontexten
- Die Auswertung der Unterrichtsreihe hinsichtlich der Motivation und des Kompetenzzuwachses der Schüler
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Förderung der Verbalisierungskompetenz von Schülern einer 8. Klasse im Mathematikunterricht. Hierzu wird das Konzept des dialogischen Lernens nach Gallin und Ruf mit dem Ziel, die Schüler zur schriftlichen Auseinandersetzung mit mathematischen Sachverhalten zu bewegen, in einer Unterrichtsreihe zum Thema Laplace-Modell umgesetzt und analysiert.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert den Auslöser für die vorliegende Arbeit, nämlich die Beobachtung, dass Schüler zwar mathematische Aufgaben lösen können, deren zugrundeliegende mathematische Zusammenhänge aber nicht verbalisieren können. Außerdem wird das Konzept des dialogischen Lernens nach Gallin und Ruf vorgestellt und die zentrale Fragestellung der Arbeit, inwieweit sich die zentralen Elemente des dialogischen Lernens zur Förderung der Verbalisierungskompetenz eignen, erläutert. Im zweiten Kapitel wird der didaktische Ort der Sprache im Mathematikunterricht beleuchtet. Dabei werden die unterschiedlichen Ebenen des Wissensaufbaus und die Bedeutung der Sprache für die „Erschließung der Welt“ hervorgehoben. Weiterhin wird die Verbalisierungskompetenz als Teilkompetenz der prozessbezogenen Kompetenz des mathematischen Kommunizierens definiert. Das dritte Kapitel widmet sich der Planung der Unterrichtsreihe. Hier wird die Lerngruppe vorgestellt und deren Vorkenntnisse im Bereich der Stochastik und des dialogischen Lernens analysiert. Anschließend erfolgt eine Sachstrukturanalyse des Laplace-Modells und eine Darstellung der angestrebten Kompetenzzuwächse im Bereich der Fach- und Verbalisierungskompetenz. Zum Abschluss des Kapitels wird der Aufbau der Unterrichtsreihe erläutert. Kapitel vier behandelt exemplarisch die Durchführung und Analyse ausgewählter Unterrichtsabschnitte der Reihe, in denen Elemente des dialogischen Lernens zum Einsatz kamen. Hier werden die Lerntagebuch-Einträge, die Erarbeitung der Wahrscheinlichkeit eines Elementarereignisses bei Laplace-Experimenten, die Formulierung der Summenregel und die Erarbeitung des Laplace-Modells analysiert und reflektiert. Im fünften Kapitel erfolgt eine kompetenzorientierte Auswertung der Unterrichtsreihe. Exemplarisch wird die Kompetenzentwicklung von drei SchülerInnen des Kompetenzniveaus I und II anhand von Lerntagebuch-Einträgen und der Klassenarbeit nachgezeichnet. Das sechste Kapitel beinhaltet eine Gesamtreflexion der Arbeit unter Berücksichtigung der im ersten Kapitel formulierten Leitfragen. Abschließend wird die zentrale Fragestellung der Arbeit beantwortet und die Bedeutung des dialogischen Lernens für die Förderung der Verbalisierungskompetenz im Mathematikunterricht hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Förderung der Verbalisierungskompetenz im Mathematikunterricht unter Verwendung des Konzeptes des dialogischen Lernens nach Gallin und Ruf. Als Stoffgebiet wird das Laplace-Modell und die Summenregel im Kontext der Wahrscheinlichkeitsrechnung gewählt. Die Arbeit untersucht die Motivation der Schüler durch den Einsatz ausgewählter Elemente des dialogischen Lernens sowie den Kompetenzzuwachs im Bereich des mathematischen Kommunizierens. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schüler durch die Arbeit mit Lerntagebüchern motiviert sind, sich mit mathematischen Inhalten auseinanderzusetzen, und die Verbalisierungskompetenz gesteigert werden kann. Die Arbeit ist relevant für den Mathematikunterricht, insbesondere für die Förderung des Verständnisses und der sprachlichen Kompetenz von Schülern.
- Citar trabajo
- Eliane Rittlicher (Autor), 2015, Mit Elementen des dialogischen Lernens nach Gallin und Ruf zum Laplace-Modell, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293813