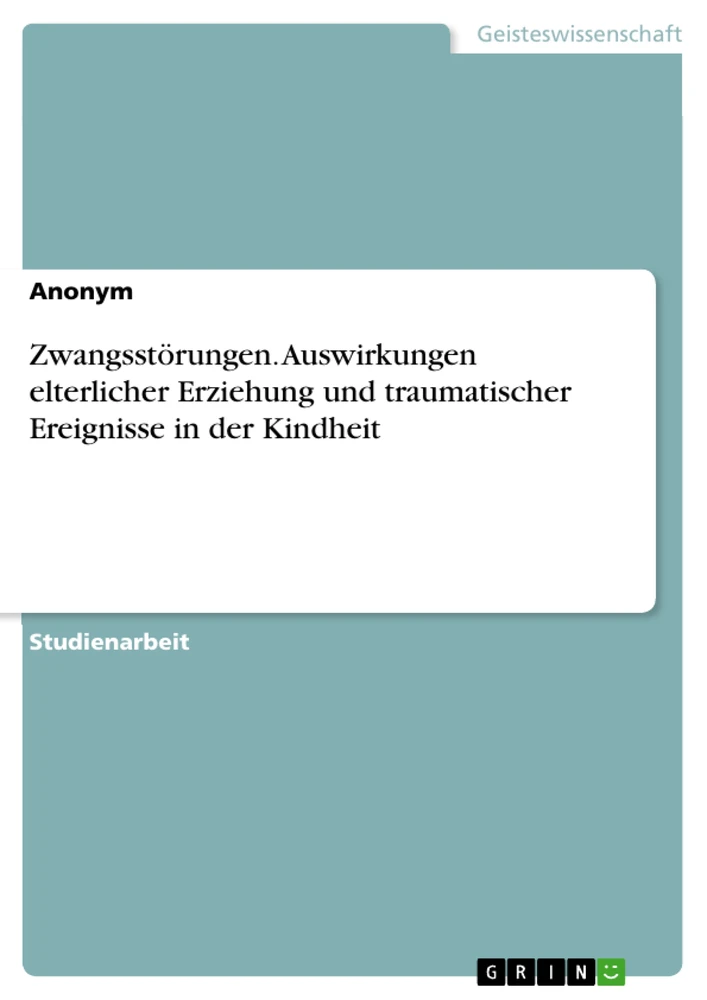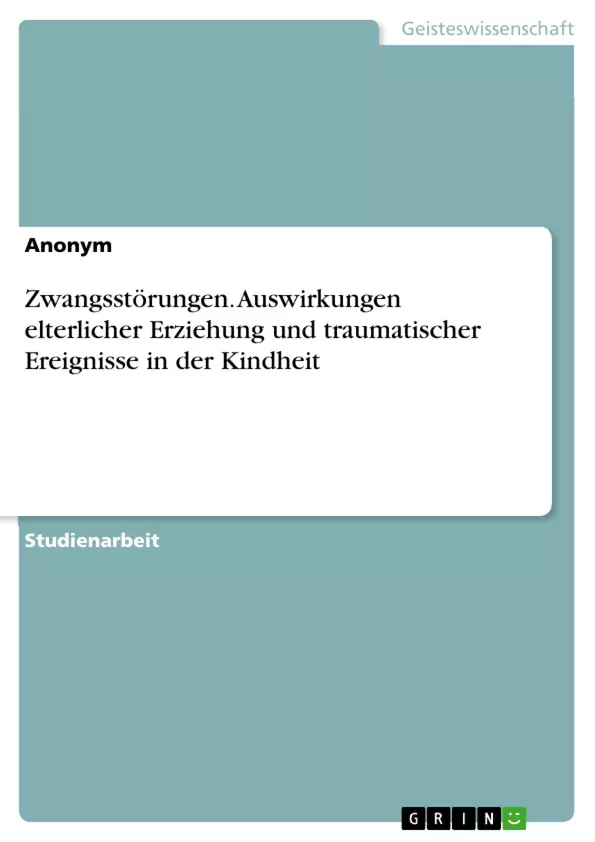„Habe ich auch wirklich das Bügeleisen ausgesteckt?“ oder „Ist das Auto auch wirklich abgeschlossen?“ Das sind Fragen, die sich wahrscheinlich fast tagtäglich jeder von uns schon einmal stellt. Völlig human und auch durchaus sinnvoll, denn ein abgebranntes Haus oder ein gestohlenes Fahrzeug kann niemand gebrauchen. Doch bei einigen Menschen ist der noch zu legitimierende Punkt der ganz natürlichen Kontrolle deutlich überschritten und man befindet sich in einer Situation, in der Gedanken und nicht zu unterlassende Handlungen das eigene Leben durch und durch bestimmen. Die Rede ist von Patienten mit einer psychischen Störung, den sogenannten Zwangserkrankungen.
Ziel dieser Arbeit ist es, der Fragestellung auf den Grund zu gehen, ob elterliche Erziehung oder traumatische Ereignisse im Kindesalter einen Einfluss auf die Entwicklung und den Verlauf späterer Zwangserkrankungen haben.
Vorerst werde ich verschiedene Arten von Zwangsstörungen auflisten, dazu zählt die Differenzierung von Zwangsgedanken, -impulsen und -handlungen. Nach einer kompakten Erfassung von Definitionen, der Symptomatik, sowie der Krankheitsverläufe und der Therapiemöglichkeiten folgt auf Grundlage der Dissertation von Sandra Köhler (2008) der eigentliche Hauptteil der Arbeit. Neben der Erläuterung, wie viele der aus einer Stichprobe untersuchten Zwangsstörungspatienten in ihrer Kindheit unter einer traumatischen Erfahrung leiden mussten, wird aufgeführt, ob sich der Krankheitsverlauf bei Patienten mit kindlichen, interpersonalen Traumatisierungen von derer ohne diese unterscheidet. Darüber hinaus wird der Frage auf den Grund gegangen, in welchem Zusammenhang frühere, interpersonale Traumatisierungen und der bei den Erkrankten zum Einsatz gekommene elterliche Erziehungsstil stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zwangsstörungen
- Epidemiologie
- Symptomatik
- Historisches
- Ätiopathogenese
- Diagnostik
- Verlauf und Behandlung
- Prognose
- Dissertation
- Aktueller Forschungsstand
- Hypothesen
- Methodik
- Ergebnisse
- Diskussion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss elterlicher Erziehung und traumatischer Kindheitserlebnisse auf die Entwicklung und den Verlauf von Zwangserkrankungen. Es werden verschiedene Arten von Zwangsstörungen differenziert, ihre Symptomatik, Krankheitsverläufe und Therapiemöglichkeiten erläutert. Der Fokus liegt auf der Analyse der Ergebnisse einer Dissertation von Sandra Köhler (2008) bezüglich des Zusammenhangs zwischen traumatischen Erfahrungen in der Kindheit, dem Krankheitsverlauf und dem elterlichen Erziehungsstil bei Zwangserkrankten.
- Definition und Klassifizierung von Zwangsstörungen
- Epidemiologie und Symptomatik von Zwangserkrankungen
- Einfluss traumatischer Kindheitserfahrungen auf die Entwicklung von Zwangserkrankungen
- Zusammenhang zwischen elterlichem Erziehungsstil und Zwangserkrankungen
- Analyse der Ergebnisse einer empirischen Studie zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Zwangserkrankungen ein und beschreibt die alltägliche Erfahrung von Kontrollbedürfnissen im Gegensatz zu den krankhaften Ausprägungen bei Zwangserkrankungen. Sie benennt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss elterlicher Erziehung und traumatischer Kindheitserlebnisse auf die Entstehung und den Verlauf von Zwangserkrankungen und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Zwangsstörungen: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Darstellung von Zwangsstörungen. Es differenziert zwischen alltäglichen Kontrollbedürfnissen und pathologischen Zwangserkrankungen, beleuchtet die Epidemiologie (Häufigkeit und Verbreitung) und Symptomatik (typische Merkmale und Erscheinungsbilder) der Erkrankung. Es wird auch auf das Verständnis von Zwangshandlungen bei Kindern eingegangen und die häufige Ko-Morbidität (gleichzeitiges Auftreten) mit anderen psychischen Störungen hervorgehoben. Die Unterteilung in Zwangsimpulse, Zwangsgedanken und Zwangshandlungen wird erklärt.
Schlüsselwörter
Zwangsstörungen, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen, Epidemiologie, Symptomatik, Ätiopathogenese, elterliche Erziehung, traumatische Kindheitserfahrungen, interpersonale Traumatisierung, Krankheitsverlauf, Behandlung, Sandra Köhler (2008).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss elterlicher Erziehung und traumatischer Kindheitserlebnisse auf die Entwicklung und den Verlauf von Zwangserkrankungen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss elterlicher Erziehung und traumatischer Kindheitserlebnisse auf die Entwicklung und den Verlauf von Zwangserkrankungen. Sie beinhaltet eine umfassende Darstellung von Zwangsstörungen, einschließlich Epidemiologie, Symptomatik, Ätiopathogenese, Diagnostik, Verlauf und Behandlung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Ergebnisse einer Dissertation von Sandra Köhler (2008) zum Zusammenhang zwischen traumatischen Erfahrungen in der Kindheit, dem Krankheitsverlauf und dem elterlichen Erziehungsstil bei Zwangserkrankten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Klassifizierung von Zwangsstörungen, Epidemiologie und Symptomatik von Zwangserkrankungen, Einfluss traumatischer Kindheitserfahrungen auf die Entwicklung von Zwangserkrankungen, Zusammenhang zwischen elterlichem Erziehungsstil und Zwangserkrankungen sowie die Analyse der Ergebnisse einer empirischen Studie zu diesem Thema.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Zwangsstörungen (mit Unterkapiteln zu Epidemiologie, Symptomatik, Historischem, Ätiopathogenese, Diagnostik, Verlauf und Behandlung sowie Prognose), Dissertation (mit Unterkapiteln zu aktuellem Forschungsstand, Hypothesen, Methodik, Ergebnissen und Diskussion) und Literaturverzeichnis.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema Zwangserkrankungen ein, beschreibt den Unterschied zwischen alltäglichen Kontrollbedürfnissen und krankhaften Ausprägungen, benennt die zentrale Forschungsfrage und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Was beinhaltet das Kapitel "Zwangsstörungen"?
Das Kapitel "Zwangsstörungen" bietet eine umfassende Darstellung von Zwangsstörungen, differenziert zwischen alltäglichen Kontrollbedürfnissen und pathologischen Zwangserkrankungen, beleuchtet die Epidemiologie und Symptomatik, geht auf das Verständnis von Zwangshandlungen bei Kindern ein und hebt die häufige Ko-Morbidität mit anderen psychischen Störungen hervor. Die Unterteilung in Zwangsimpulse, Zwangsgedanken und Zwangshandlungen wird erklärt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Zwangsstörungen, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen, Epidemiologie, Symptomatik, Ätiopathogenese, elterliche Erziehung, traumatische Kindheitserfahrungen, interpersonale Traumatisierung, Krankheitsverlauf, Behandlung, Sandra Köhler (2008).
Welche Studie wird analysiert?
Die Arbeit analysiert die Ergebnisse einer Dissertation von Sandra Köhler (2008) zum Zusammenhang zwischen traumatischen Erfahrungen in der Kindheit, dem Krankheitsverlauf und dem elterlichen Erziehungsstil bei Zwangserkrankten.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt und dient der Analyse von Themen im Bereich der Zwangserkrankungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Zwangsstörungen. Auswirkungen elterlicher Erziehung und traumatischer Ereignisse in der Kindheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294527