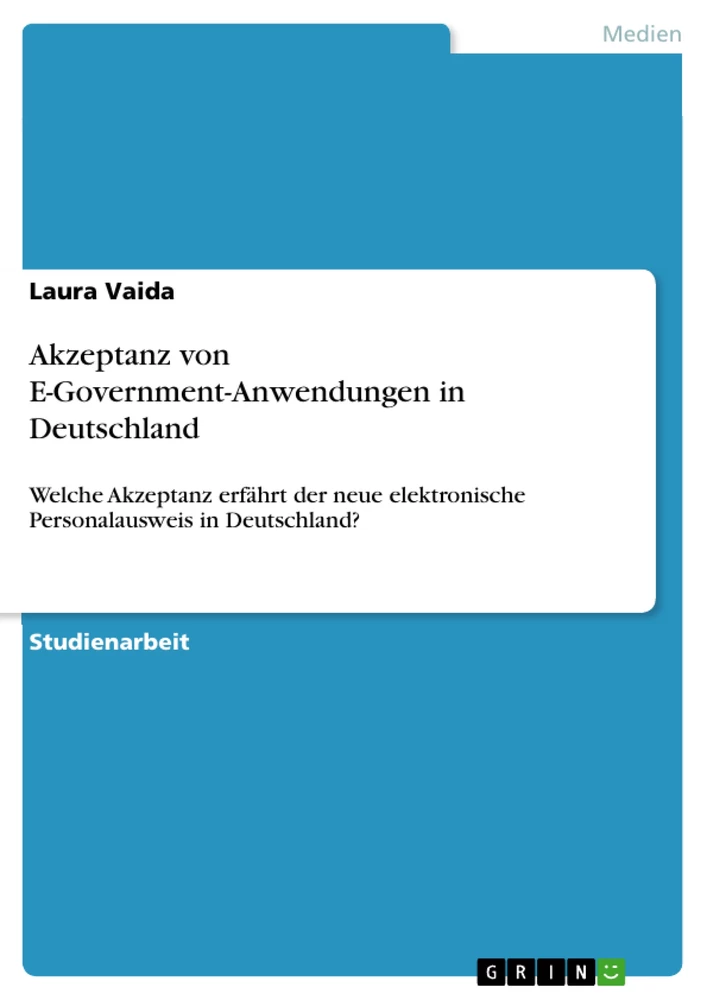In einer Informations-und Wissensgesellschaft, in der die Verbreitung moderner Informations-und Kommunikationstechnologien (IKTs) immer mehr zunimmt, gewinnen auch alternative Modelle einer Verwaltung an Bedeutung. Auch der daraus resultierende gesellschaftliche Wandel stellt Herausforderungen an Staat und Verwaltung, die nach einer effizienten Lösung für die BürgerInnen als auch die Wirtschaft suchen. So hat sich in den letzten Jahren das Verwaltungsmodell des E-Government verbreitet, das durch die Nutzung dieser Informations-und Kommunikationstechnologien eine bessere Zusammenarbeit mit BürgerInnen und Unternehmen gewährleisten soll. Dazu wurden verschiedene Anwendungen entwickelt, die die Kommunikation zwischen NutzerInnen und Verwaltung erleichtern können. Im Jahr 2002 wurde in Deutschland als Äquivalent zur schriftlichen Signatur die elektronische Signatur ins Leben gerufen, wodurch eine vereinfachte Möglichkeit zur Abgabe einer schriftlichen Willenserklärung erreicht werden sollte. Doch diese Möglichkeit der Kommunikation erfuhr nicht die erhoffte Akzeptanz in der Bevölkerung. Als Weiterentwicklungen wurden 2010 die D-Mail und der neue elektronische Personalausweis eingeführt.
In dieser Proseminararbeit möchte ich auf die Frage eingehen, welche Akzeptanz der neue elektronische Personalausweis in der Bevölkerung erfährt und versuchen, Begründungen dafür zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Akzeptanz von E-Government-Anwendungen in Deutschland
- Begriffe
- Theorie
- AkteurInnen
- Nationale E-Government-Strategie
- Akzeptanzprobleme des eIDMS
- Fazit
- Schluss
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Proseminararbeit befasst sich mit der Akzeptanz des neuen elektronischen Personalausweises in Deutschland. Ziel ist es, die Gründe für die Akzeptanz oder Ablehnung dieser E-Government-Anwendung zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die Relevanz des Themas aus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Perspektive, wobei die Notwendigkeit einer effizienten Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Verwaltung im Vordergrund steht. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der nutzerzentrierten Entwicklung von E-Government-Anwendungen und die Bedeutung der Integration von technologischen Möglichkeiten.
- Definition und Bedeutung von E-Government
- Theorie der „Diffusion of Innovations“ von Everett Rogers
- AkteurInnen im E-Government in Deutschland
- Nationale E-Government-Strategie
- Akzeptanzprobleme des neuen elektronischen Personalausweises
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Akzeptanz von E-Government-Anwendungen in Deutschland ein und stellt die Relevanz des neuen elektronischen Personalausweises aus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Sicht dar. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Gründe für die Akzeptanz oder Ablehnung dieser Anwendung zu untersuchen.
Das Kapitel „Akzeptanz von E-Government-Anwendungen in Deutschland“ definiert zunächst wichtige Begriffe wie E-Government und E-Democracy. Es stellt die Theorie der „Diffusion of Innovations“ von Everett Rogers vor, die als Grundlage für die Analyse der Akzeptanz von E-Government-Anwendungen dient. Anschließend werden die AkteurInnen im E-Government in Deutschland vorgestellt, darunter staatliche Stellen und E-Commerce-Anbieter. Das Kapitel beleuchtet die nationale E-Government-Strategie und geht auf die Akzeptanzprobleme des neuen elektronischen Personalausweises ein.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen E-Government, elektronischer Personalausweis, Akzeptanz, Diffusion of Innovations, E-Democracy, nationale E-Government-Strategie, Akzeptanzprobleme, Nutzerzentrierte Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von E-Government in Deutschland?
Das Ziel ist eine effizientere Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen dem Staat, der Verwaltung, den Bürgern und der Wirtschaft durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien.
Warum wird der elektronische Personalausweis (eID) in der Bevölkerung oft abgelehnt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Akzeptanzprobleme, die trotz der Einführung im Jahr 2010 dazu führten, dass die Anwendung nicht die erhoffte Verbreitung fand.
Welche Rolle spielt die Theorie der „Diffusion of Innovations“?
Die Theorie von Everett Rogers dient als wissenschaftliche Grundlage, um zu analysieren, wie und warum sich neue technologische Anwendungen in einer Gesellschaft verbreiten oder scheitern.
Was ist der Unterschied zwischen E-Government und E-Democracy?
E-Government bezieht sich primär auf Verwaltungsabläufe, während E-Democracy die Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungsprozessen durch digitale Mittel umfasst.
Was sind De-Mail und die elektronische Signatur?
Dies sind Anwendungen, die entwickelt wurden, um rechtssichere digitale Kommunikation und schriftliche Willenserklärungen ohne physische Unterschrift zu ermöglichen.
- Citar trabajo
- Laura Vaida (Autor), 2015, Akzeptanz von E-Government-Anwendungen in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294780