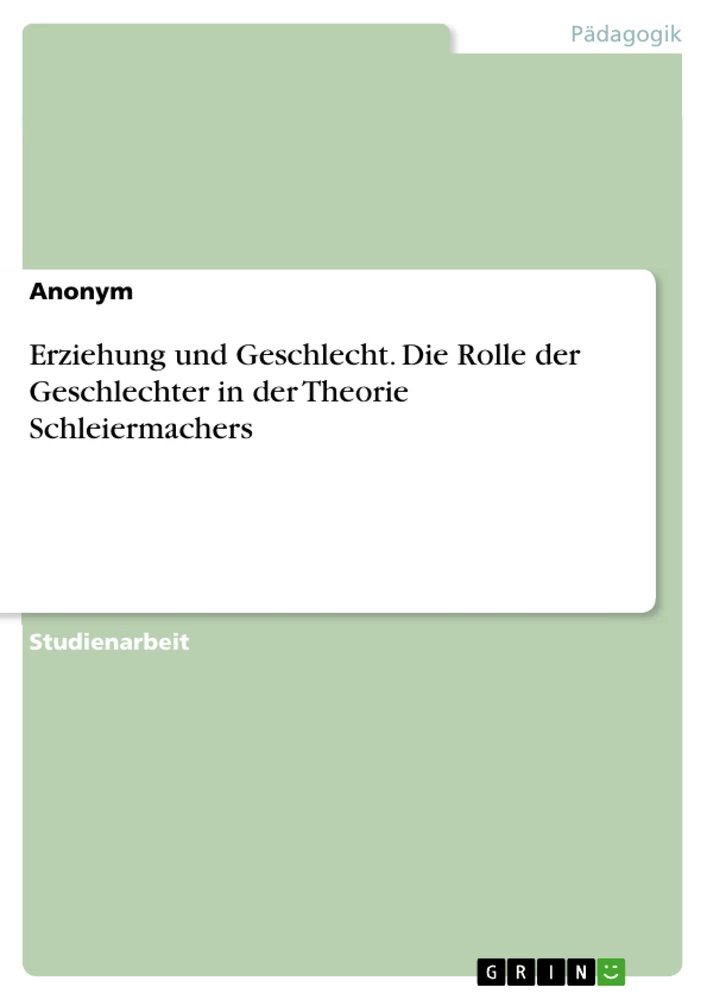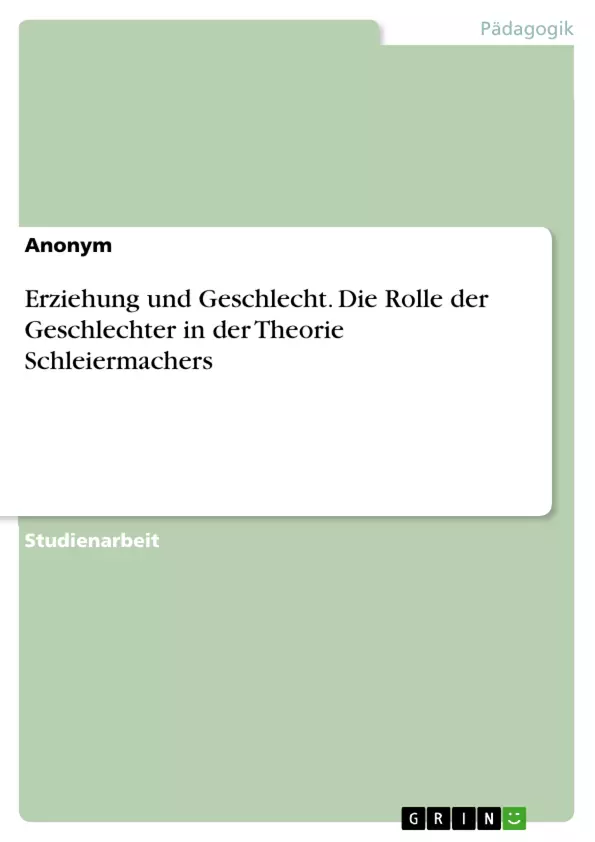In der vorliegenden Arbeit werde ich mich mit dem Verhältnis von Geschlecht und Erziehung beschäftigen. Hierbei stellt sich vor allem die Frage, wie die Erziehung zur Erhaltung und Reproduktion geschlechtstypisierender Handlungs- und Verhaltensweisen beiträgt. Obwohl sich spätestens mit der Emanzipations-Bewegung und der Entwicklung der Queer-Theorie in den 1990er Jahren die gesellschaftlichen Rollenbilder verändert haben, existieren nach wie vor Zuschreibungen vermeintlich geschlechtstypischer Eigenschaften und Verhaltensweisen und daraus resultierende Ausgrenzungsmechanismen.
Daher ist die Beschäftigung mit dem Thema nach wie vor von großer Bedeutung. Ich werde mich dabei der Frage auf theoretischer Ebene widmen. Eine Diskussion konkreter Praktiken der Erziehung werde ich im Rahmen dieser Arbeit nicht vornehmen. Im Mittelpunkt soll die Auseinandersetzung mit der Theorie der Pädagogik von Friedrich Schleiermacher stehen.
Zur Annäherung an das Thema werde ich mich zunächst mit den Aufgaben der Pädagogik im Allgemeinen beschäftigen. Die Klärung der Zielsetzung der Pädagogik ist Voraussetzung für die weitere Beschäftigung mit dem Thema. Das Verhältnis der Theorie zur "Geschlechterfrage" hängt essentiell mit der Zielstellung der Pädagogik zusammen. Je nachdem welchen Ansatz man für die Pädagogik wählt, ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Auseinandersetzung.
Im zweiten Teil der Arbeit werde ich Schleiermachers Ausführungen zum Einfluss des Geschlechts auf die Erziehung nachvollziehen. Hierbei soll es zunächst nur um die neutrale Darstellung seiner Ausführungen gehen.
Um seine Betrachtungen aus heutiger Sicht analysieren und kritisieren zu können, werde ich im nächsten Teil der Arbeit eine historische Einordnung der Theorie vornehmen. Diese Einordnung ist einerseits notwendig um bestimmte Annahmen seiner Theorie verstehen zu können, andererseits soll sie Aufschluss über das ambivalente Verhältnis der heutigen Sozialwissenschaft zu Schleiermachers Theorie geben. Auf den ersten Blick mag es verwirrend erscheinen, dass manche Vertreter Schleiermacher als einen Vorreiter feministischer Theorien betrachten und gleichzeitig der Vorwurf existiert, Schleiermacher verteidige ein zutiefst konservatives Wertesystem. Dieser scheinbare Widerspruch soll durch die Betrachtung der historischen Gegebenheiten aufgelöst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziele der Pädagogik
- Geschlechterdifferenz bei Schleiermacher
- Historische Verortung
- Kritik an Schleiermacher
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Erziehung zur Erhaltung und Reproduktion geschlechtstypisierender Handlungs- und Verhaltensweisen beiträgt. Dabei wird die Theorie der Pädagogik von Friedrich Schleiermacher analysiert, um die Rolle des Geschlechts in seiner Theorie zu beleuchten.
- Die Aufgaben und Ziele der Pädagogik im Allgemeinen
- Schleiermachers Ausführungen zum Einfluss des Geschlechts auf die Erziehung
- Historische Einordnung der Theorie Schleiermachers
- Kritische Betrachtung der Theorie Schleiermachers im Kontext gender-theoretischer Ansätze
- Formulierung eines Anspruchs an die Pädagogik in Bezug auf die Thematisierung des Geschlechterbildes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Geschlecht und Erziehung. Die Arbeit konzentriert sich auf die theoretische Ebene und untersucht die Pädagogik von Friedrich Schleiermacher.
Im zweiten Kapitel werden die Ziele der Pädagogik im Allgemeinen beleuchtet. Schleiermachers Ansatz, der zwischen den Extremen „Erhaltung“ und „Verbesserung“ vermittelt, wird vorgestellt. Die Verantwortung der Erziehung für die Unvollkommenheit der Gesellschaft wird hervorgehoben.
Das dritte Kapitel widmet sich Schleiermachers Ausführungen zum Einfluss des Geschlechts auf die Erziehung. Seine Theorie wird neutral dargestellt, ohne bereits kritische Analysen vorwegzunehmen.
Im vierten Kapitel erfolgt eine historische Einordnung der Theorie Schleiermachers. Diese Einordnung soll die Annahmen seiner Theorie verständlicher machen und das ambivalente Verhältnis der heutigen Sozialwissenschaft zu Schleiermachers Theorie beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Pädagogik von Friedrich Schleiermacher, Erziehung und Geschlecht, Geschlechterdifferenz, Geschlechterrollen, historische Einordnung, gender-theoretische Ansätze, Kritik an Schleiermacher, Zielsetzung der Pädagogik, Emanzipation, Individualität, gesellschaftliche Verhältnisse.
Häufig gestellte Fragen
Wie sieht Schleiermacher das Verhältnis von Geschlecht und Erziehung?
Schleiermacher untersucht in seiner Theorie, wie Erziehung zur Erhaltung und Reproduktion geschlechtstypisierter Verhaltensweisen beiträgt, eingebettet in seine allgemeine Pädagogik.
Was sind die zentralen Ziele der Pädagogik laut Schleiermacher?
Seine Pädagogik vermittelt zwischen der "Erhaltung" bestehender Zustände und der "Verbesserung" der Gesellschaft durch die Entwicklung des Individuums.
Gilt Schleiermacher als Vorreiter des Feminismus?
Das Verhältnis ist ambivalent: Während einige ihn als Vorreiter sehen, werfen andere ihm die Verteidigung eines konservativen, geschlechtergetrennten Wertesystems vor.
Warum ist eine historische Einordnung seiner Theorie wichtig?
Die Einordnung hilft, den scheinbaren Widerspruch zwischen emanzipatorischen Ansätzen und konservativen Rollenbildern in seiner Zeit zu verstehen.
Was ist die "Geschlechterfrage" in der Pädagogik?
Es geht um die Frage, inwieweit Erziehung natürliche oder gesellschaftlich konstruierte Geschlechterdifferenzen verstärkt oder überwinden kann.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2011, Erziehung und Geschlecht. Die Rolle der Geschlechter in der Theorie Schleiermachers, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294818