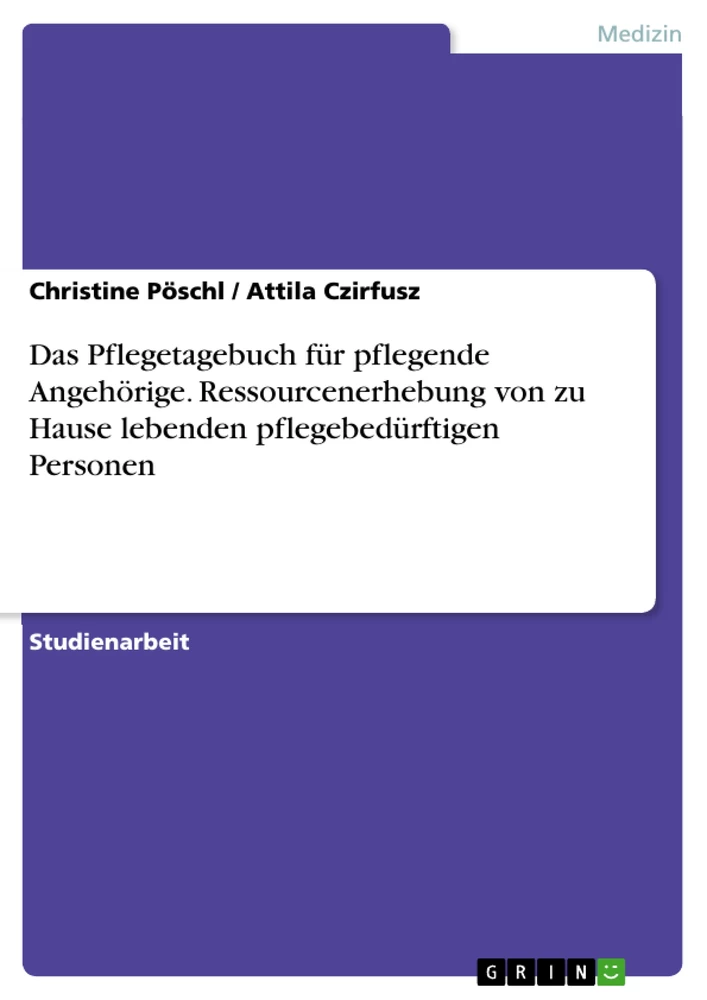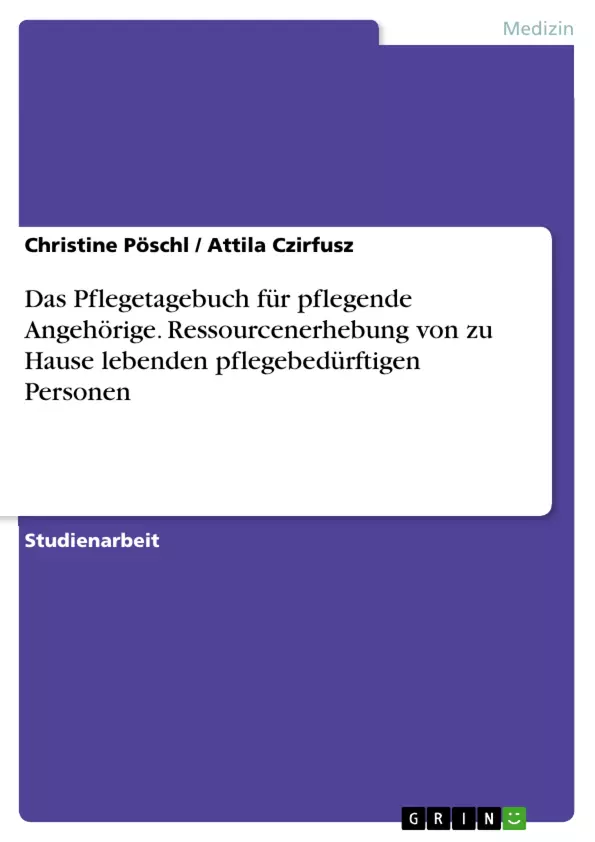Unsere Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie Menschen, Menschen mit Pflegebedarf und/oder Behinderung begegnet und insbesondere deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht.
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff greift diese Aufgabenstellung auf, um die Situation der Betroffenen zu verbessern und einen ethisch relevanten Perspektivwechsel zu initiieren: Die Abkehr von einem an den Defiziten und am Unvermögen orientierten Bild der pflegebedürftigen Menschen hin zu einer Sichtweise, die das Ausmaß seiner Selbständigkeit erkennbar macht.
Die Anknüpfung an das Ausmaß der Selbständigkeit ermöglicht eine ganzheitliche, auch kontextbezogene Wahrnehmung der Lebenslage von pflegebedürftigen Menschen und so eine weitaus höhere Gerechtigkeit in der Berücksichtigung der Beeinträchtigung von Menschen und hilft zudem, Ungleichbehandlungen zwischen Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen oder ganzer Gruppen von Menschen zu vermeiden.
Die Berücksichtigung des Wunsches nach Selbständigkeit ist Ausdruck von Wertschätzung, sie bezeugt den Respekt vor den Lebenslagen der Menschen, die Achtung ihrer Würde, sie fördert Selbstverantwortung ebenso wie sie das verlässliche, solidarische Eintreten für Menschen in Risikolagen unterstützt, die ihre Kräfte und Möglichkeiten übersteigen.
Begrenzte Ressourcen in der Umsetzung erfordern dabei transparente, personenzentrierte Hilfen; finanzielle Prioritätensetzungen müssen den Rahmenbedingungen einer Gesellschaft des längeren Lebens und damit der zunehmenden Zahl pflegebedürftiger Menschen gerecht werden (Deutsches Bundesministerium für Gesundheit: Bericht des Beirates zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes 2009, S. 70).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ausgangssituation
- 1.1. Problemstellungen
- 1.2. Fehlende Anerkennung
- 1.3. Ziele der Studie
- 1.4. Forschungsfragen
- 2. Stand der Forschung
- 2.1. Datenerhebung von Pflegegeldbeziehern - Grenzen der Studie
- 2.2. Literaturrecherche
- 2.2.1. Dokumentation pflegender Angehöriger
- 2.2.2. Gruppe pflegender Angehöriger
- 2.2.3. Belastungen pflegender Angehöriger
- 2.3. Übersicht von Studien zur Erfassung von Pflegebedürftigkeit im informellen Netzwerk
- 2.3.1. Messbarkeit von informeller Pflege
- 2.3.2. Tagebücher als Datengrundlage in einer Studie über pflegende Angehörige
- 2.3.3. Messung von Zeitaufwand für informelle Pflege in einer Studie mit Demenzpatienten
- 2.4. Grundlegende Begriffserklärungen
- 2.4.1. Definition pflegende Angehörige
- 2.4.2. Begriff der Pflegeperson SGB XI § 19
- 2.4.3. Exkurs: Zur Problematik der Bezeichnung „pflegender Angehöriger"
- 2.4.4. Definition Pflegeprotokoll/Pflegetagebuch
- 2.4.5. Definition Pflegebedürftigkeit
- 2.4.6. Pflegebedürftigkeit
- 2.4.7. Definition Pflegebedürftigkeit aus Sicht der Medizin/Geriatrie
- 2.4.8. Definition Pflegebedürftigkeit aus pflegewissenschaftlicher Sicht
- 2.4.9. Definition Pflegebedürftigkeit nach SGB XI § 15
- 2.4.10. Definition Pflegeassessment
- 3. Methode
- 3.1. Planung
- 3.1.1. Zugang zum Feld - Stichprobe
- 3.1.2. Zielgruppe - Auswahl der Probanden
- 3.2. Erhebungsinstrument (Fragebogen)
- 3.2.1. Einteilungsstufen des Selbständigkeitsgrades
- 3.2.2. Grade der Pflegebedürftigkeit und deren Punktwerte
- 3.3. Das neue Begutachtungsassessment als Instrument zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit
- 3.3.1. Einschätzungsinstrument zur Ressourcenerhebung
- 3.3.2. Beurteilung der Pflegebedürftigkeit
- 3.3.3. Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit
- 3.4. Instrumente zur Einschätzung der Pflegebedürftigkeit
- 3.4.1. Bedingung der Pflegebedürftigkeit in Deutschland
- 3.4.2. Bedingungen der Pflegebedürftigkeit in Österreich
- 3.5. Ergebnisse
- 4. Das Pflegetagebuch - ein Konzept als Grundlage für die Pflegebegutachtung
- 4.1. Zusammenfassung von Gesprächsnotizen mit Pflegegeld-beziehern im häuslichen Bereich und deren Angehörigen
- 4.2. Empfehlungen des Rechnungshofes
- 4.3. Pflegetagebuch und Pflegegeldbegutachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Möglichkeiten, ein Pflegetagebuch als Forschungsinstrument zur Erhebung von Ressourcen bei zu Hause lebenden Pflegebedürftigen und deren pflegenden Angehörigen einzusetzen. Ziel ist es, ein besseres Verständnis der Herausforderungen und Ressourcen in der häuslichen Pflege zu entwickeln und daraus Empfehlungen für die Praxis abzuleiten.
- Herausforderungen der häuslichen Pflege
- Ressourcen pflegender Angehöriger
- Entwicklung eines geeigneten Erhebungsinstrumentes
- Bewertung bestehender Assessment-Instrumente
- Verbesserung der Pflegebegutachtung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ausgangssituation: Dieses Kapitel beschreibt die Ausgangssituation der Studie und benennt die Problemstellungen, die die Notwendigkeit der Forschung begründen. Es beleuchtet den Mangel an Anerkennung für pflegende Angehörige und formuliert die Ziele und Forschungsfragen der Studie. Die dargestellten Probleme fokussieren auf die unzureichende Unterstützung und die daraus resultierenden Belastungen für die pflegenden Angehörigen und die Pflegebedürftigen. Die Ziele der Studie zielen auf die Entwicklung eines verbesserten Erhebungsinstrumentes ab, das die Ressourcen und den Bedarf der betroffenen Personen besser erfasst.
2. Stand der Forschung: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Literaturrecherche zu den Themen Datenerhebung bei Pflegegeldbeziehern, Dokumentation pflegender Angehöriger, Belastungen pflegender Angehöriger und Studien zur Erfassung von Pflegebedürftigkeit im informellen Netzwerk. Es analysiert kritisch die Grenzen bestehender Studien und definiert zentrale Begriffe wie „pflegende Angehörige“, „Pflegebedürftigkeit“ und „Pflegeassessment“ aus verschiedenen Perspektiven (medizinisch, pflegewissenschaftlich, rechtlich). Die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Methoden legt die Grundlage für die Entwicklung eines neuen Instruments.
3. Methode: Hier wird die Methodik der Studie detailliert erläutert. Es werden die Planung der Studie, die Auswahl der Probanden und das verwendete Erhebungsinstrument (Fragebogen) beschrieben. Der Fokus liegt auf dem neuen Einschätzungsinstrument zur Ressourcenerhebung und dessen Anwendung in der Praxis. Das Kapitel beschreibt auch die verwendeten Instrumente zur Einschätzung der Pflegebedürftigkeit in Deutschland und Österreich im Kontext der Studie.
4. Das Pflegetagebuch - ein Konzept als Grundlage für die Pflegebegutachtung: Dieses Kapitel präsentiert das entwickelte Pflegetagebuch-Konzept als Grundlage für die Pflegebegutachtung. Es integriert die Ergebnisse der Gespräche mit Pflegegeldbeziehern und deren Angehörigen und bezieht die Empfehlungen des Rechnungshofes mit ein. Das Kapitel diskutiert die Anwendung des Pflegetagebuchs in der Praxis und dessen Potential zur Verbesserung der Pflegegeldbegutachtung. Die Kapitelzusammenfassung betont den innovativen Charakter des entwickelten Konzepts und seine Bedeutung für eine gerechtere und bedürfnisorientierte Pflegebegutachtung.
Schlüsselwörter
Pflegetagebuch, pflegende Angehörige, Pflegebedürftigkeit, Ressourcen, Erhebungsinstrument, Pflegebegutachtung, häusliche Pflege, Assessment, informelles Netzwerk, SGB XI.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Arbeit: "Pflegetagebuch als Instrument zur Erhebung von Ressourcen bei zu Hause lebenden Pflegebedürftigen und deren pflegenden Angehörigen"
Was ist das Thema der wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Eignung eines Pflegetagebuchs als Forschungsinstrument zur Erhebung von Ressourcen bei zu Hause lebenden Pflegebedürftigen und ihren pflegenden Angehörigen. Ziel ist die Verbesserung des Verständnisses der Herausforderungen und Ressourcen in der häuslichen Pflege und die Ableitung von Handlungsempfehlungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Ausgangssituation, 2. Stand der Forschung, 3. Methode und 4. Das Pflegetagebuch - ein Konzept als Grundlage für die Pflegebegutachtung. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der Forschungsfrage.
Was wird im Kapitel "Ausgangssituation" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Problemstellung (insbesondere den Mangel an Anerkennung für pflegende Angehörige), die Ziele und Forschungsfragen der Studie. Es beleuchtet die unzureichende Unterstützung und die daraus resultierenden Belastungen.
Was wird im Kapitel "Stand der Forschung" behandelt?
Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Literaturrecherche zu Datenerhebung bei Pflegegeldbeziehern, Belastungen pflegender Angehöriger und Studien zur Erfassung von Pflegebedürftigkeit. Es analysiert kritisch bestehende Studien und definiert zentrale Begriffe wie „pflegende Angehörige“, „Pflegebedürftigkeit“ und „Pflegeassessment“ aus verschiedenen Perspektiven.
Was wird im Kapitel "Methode" behandelt?
Hier wird die Methodik detailliert erläutert: Planung, Probandenauswahl, das verwendete Erhebungsinstrument (Fragebogen) und die verwendeten Instrumente zur Einschätzung der Pflegebedürftigkeit in Deutschland und Österreich.
Was wird im Kapitel "Das Pflegetagebuch" behandelt?
Dieses Kapitel präsentiert das entwickelte Pflegetagebuch-Konzept als Grundlage für die Pflegebegutachtung. Es integriert Ergebnisse von Gesprächen mit Pflegegeldbeziehern und Angehörigen und bezieht Empfehlungen des Rechnungshofes ein. Es diskutiert die Anwendung des Pflegetagebuchs und dessen Potential zur Verbesserung der Pflegegeldbegutachtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pflegetagebuch, pflegende Angehörige, Pflegebedürftigkeit, Ressourcen, Erhebungsinstrument, Pflegebegutachtung, häusliche Pflege, Assessment, informelles Netzwerk, SGB XI.
Welche Ziele verfolgt die Studie?
Die Studie zielt auf ein besseres Verständnis der Herausforderungen und Ressourcen in der häuslichen Pflege ab und möchte ein verbessertes Erhebungsinstrument entwickeln, das den Bedarf der Betroffenen besser erfasst und zur Verbesserung der Pflegebegutachtung beiträgt.
Welche Forschungsfragen werden in der Studie bearbeitet?
Die konkreten Forschungsfragen werden im ersten Kapitel der Arbeit detailliert beschrieben. Die zentralen Fragen betreffen die Erhebung von Ressourcen und Herausforderungen in der häuslichen Pflege und die Entwicklung eines geeigneten Instruments hierfür.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet qualitative und quantitative Methoden, unter anderem einen Fragebogen und die Auswertung von Gesprächen mit Pflegegeldbeziehern und Angehörigen. Das zentrale Instrument ist das entwickelte Pflegetagebuch.
- Quote paper
- Christine Pöschl (Author), Attila Czirfusz (Author), 2015, Das Pflegetagebuch für pflegende Angehörige. Ressourcenerhebung von zu Hause lebenden pflegebedürftigen Personen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295009