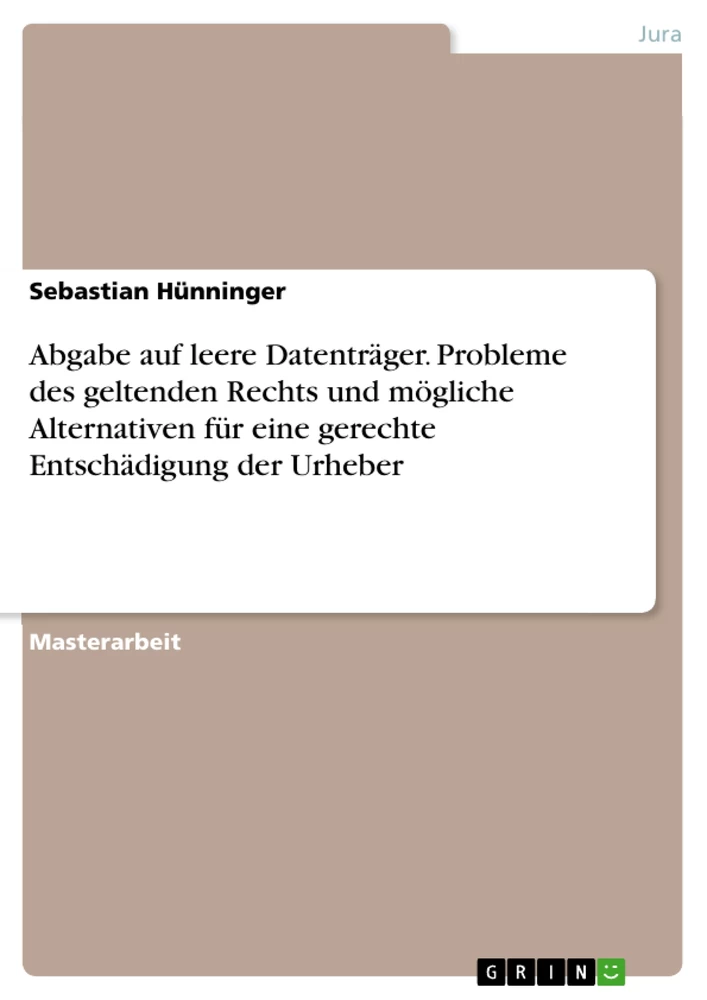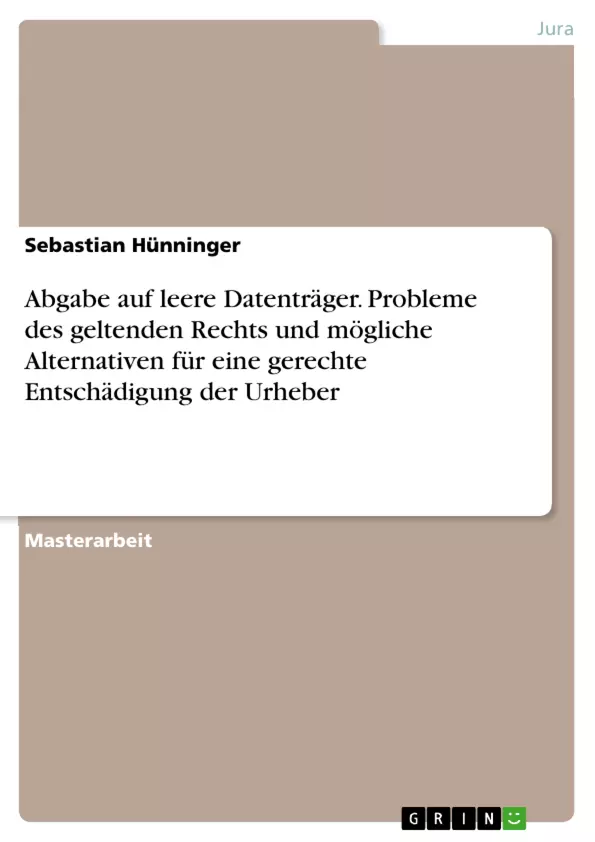In der neunten Sitzung der Sommersession 2014 hat der Nationalrat eine Motion der Kommission für Wirtschaft und Abgaben angenommen, in welcher der Bundesrat beauftragt wird, dem Parlament Alternativen zur aktuellen Abgabe auf leeren Datenträgern zu unterbreiten. Dabei soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass heute elektronische Mittel auf dem Markt sind, mit denen diese gesetzliche Pflicht ohne weiteres umgangen werden kann. Im ersten Teil wird das geltende Recht vor dem Hintergrund der staatsvertraglichen Verpflichtungen der Schweiz behandelt. Besonders der im Völkerrecht mehrfach verankerte Dreistufentest ist dabei wichtig. Zum einen grenzt der Dreistufentest die staatliche Autonomie ein und gibt dem Gesetzgeber somit den Rahmen möglicher Vergütungssysteme vor. Zum anderen dient er rechtsanwendenden Behörden als Auslegungshilfe bei der Bemessung der Leerträgerabgabe. Die Verwertungsgesellschaften berufen sich im Tarifgenehmigungsverfahren regelmässig auf den Dreistufentest, um damit die Vergütungstarifierung zu beeinflussen. Die Frage der direkten Anwendbarkeit ist daher von erheblicher Bedeutung. Im zweiten Teil wird ein Vergütungsmodell vorgestellt, welches die systemischen Schwächen des geltenden Rechts behebt, den Anforderungen des Dreistufentests genügt und die Leerträgerabgabe damit de lege ferenda ablösen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Dreistufentest
- Beschränkung auf Sonderfälle
- Weiterbestand normaler Verwertungsmöglichkeiten
- Zumutbarkeit der Beschränkung
- Direkte Anwendbarkeit des Dreistufentests
- Revidierte Berner Übereinkunft und WIPO-Urheberrechtsvertrag
- WIPO Performance and Phonograms Treaty und das TRIPS-Übereinkommen
- Praktische Bedeutung der direkten Anwendbarkeit
- Kulturflatrate
- Nachteile der Speichermedienvergütung
- Ausgangslage bei der Kulturflatrate
- Legalisierung des privaten Zugänglichmachens
- Beschränkung auf einen Sonderfall
- Weiterbestand normaler Verwertungsmöglichkeiten
- Bemessungsweise
- Gläubiger und Schuldner des Vergütungsanspruches
- Internationales Zivilprozessrecht
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Problematik der Abgabe auf leere Datenträger. Sie analysiert die Rechtslage im Hinblick auf eine gerechte Entschädigung der Urheberinnen und Urheber, untersucht die Schwächen des geltenden Rechts und erörtert mögliche alternative Modelle zur Vergütung.
- Der Dreistufentest als zentrale Schranke im Urheberrecht
- Die direkte Anwendbarkeit des Dreistufentests im Kontext internationaler Urheberrechtsabkommen
- Die Kulturflatrate als alternatives Modell zur Vergütung von Urheberinnen und Urhebern
- Die rechtliche Einordnung der Kulturflatrate im Hinblick auf den Dreistufentest
- Die Herausforderungen der Umsetzung einer Kulturflatrate im internationalen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Abgabe auf leere Datenträger ein und erläutert die Problematik der gerechten Vergütung von Urheberinnen und Urhebern. Das zweite Kapitel analysiert den Dreistufentest als zentrale Schranke im Urheberrecht, wobei die drei Kriterien – Beschränkung auf Sonderfälle, Weiterbestand normaler Verwertungsmöglichkeiten und Zumutbarkeit der Beschränkung – detailliert untersucht werden. Das dritte Kapitel widmet sich der direkten Anwendbarkeit des Dreistufentests im internationalen Kontext, insbesondere im Hinblick auf die Revidierte Berner Übereinkunft, den WIPO-Urheberrechtsvertrag sowie das TRIPS-Übereinkommen. Das vierte Kapitel beleuchtet die Kulturflatrate als alternatives Modell zur Vergütung von Urheberinnen und Urhebern. Es werden die Nachteile der Speichermedienvergütung aufgezeigt und die Ausgangslage der Kulturflatrate im Hinblick auf den Dreistufentest analysiert. Darüber hinaus werden die Legalisierung des privaten Zugänglichmachens, die Bemessungsweise der Vergütung, die Gläubiger und Schuldner des Vergütungsanspruches sowie das internationale Zivilprozessrecht im Kontext der Kulturflatrate behandelt.
Schlüsselwörter
Urheberrecht, Abgabe auf leere Datenträger, Dreistufentest, Kulturflatrate, Urhebervergütung, Speichermedienvergütung, private Vervielfältigung, digitale Nutzung, internationale Urheberrechtsabkommen, TRIPS-Übereinkommen, WIPO-Urheberrechtsvertrag, Revidierte Berner Übereinkunft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der "Dreistufentest" im Urheberrecht?
Der Dreistufentest ist ein völkerrechtliches Prinzip, das Schranken des Urheberrechts begrenzt. Eine Beschränkung ist nur zulässig, wenn sie (1) auf Sonderfälle begrenzt ist, (2) die normale Verwertung des Werks nicht beeinträchtigt und (3) die berechtigten Interessen des Urhebers nicht unzumutbar verletzt.
Warum wird die Abgabe auf leere Datenträger kritisiert?
Die Kritik lautet, dass heutige elektronische Mittel die gesetzliche Pflicht leicht umgehen können und das System der Speichermedienvergütung nicht mehr zeitgemäß ist, um Urheber gerecht zu entschädigen.
Was versteht man unter einer "Kulturflatrate"?
Die Kulturflatrate ist ein alternatives Vergütungsmodell, bei dem Nutzer eine pauschale Gebühr (z.B. auf Internetanschlüsse) zahlen und im Gegenzug das Recht erhalten, urheberrechtlich geschützte Werke privat zu nutzen und zugänglich zu machen.
Ist der Dreistufentest in der Schweiz direkt anwendbar?
Die Frage der direkten Anwendbarkeit ist rechtlich erheblich, da Verwertungsgesellschaften sich im Tarifgenehmigungsverfahren darauf berufen, um die Höhe der Vergütungen zu beeinflussen.
Welche Vorteile hätte eine Kulturflatrate gegenüber der Leerträgerabgabe?
Sie könnte die systemischen Schwächen des geltenden Rechts beheben, private Kopien legalisieren und eine stabilere, dem digitalen Zeitalter angemessene Entschädigung für Urheber sicherstellen.
- Citation du texte
- Sebastian Hünninger (Auteur), 2014, Abgabe auf leere Datenträger. Probleme des geltenden Rechts und mögliche Alternativen für eine gerechte Entschädigung der Urheber, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295018