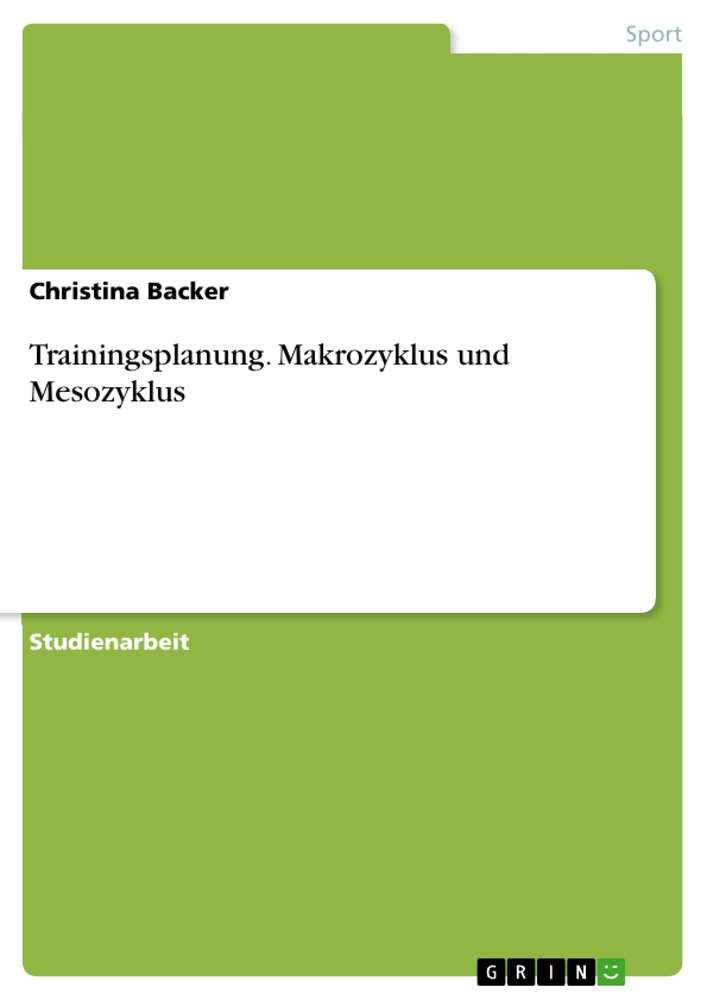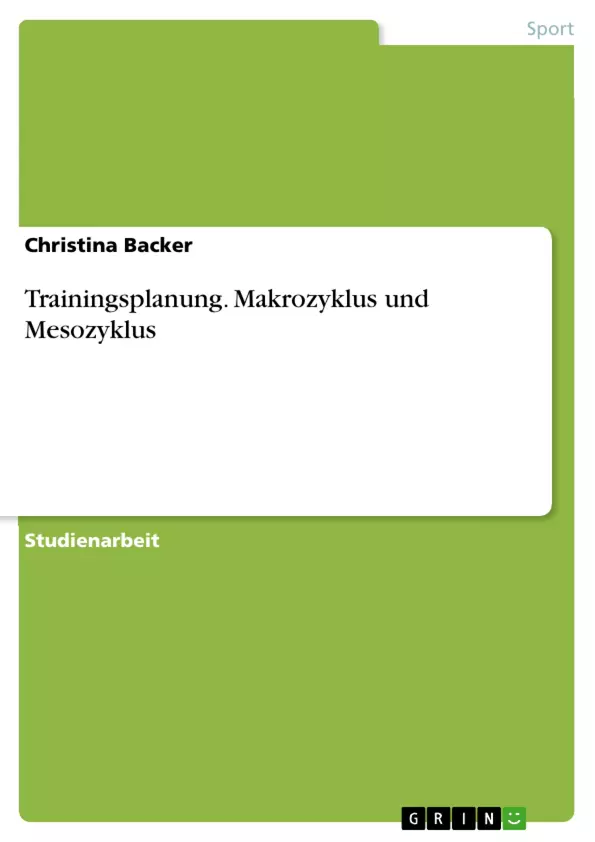Eines der Trainingsmotive der Testperson ist die „Gewichtsreduktion“. Somit bezieht sich das erste Ziel auf die Senkung des Körperfettanteils. Da eine Körperfettreduktion um 250-500 g pro Woche realistisch ist (Eifler, 2014, S. 41), wird bei der Testperson eine Senkung des Körperfettanteils um 2-3 kg innerhalb der nächsten 6 Woche anvisiert. Nach Angaben der allgemeinen Daten, wiegt die Testperson 72 kg bei einer Größe von 167 cm. Laut Berechnungen des Body-Mass-Index wird die Testperson im Bereich der „Präadipositas“ (WHO, Online-Quelle o.J.), also übergewichtig, eigenstuft. Folglich lautet Ziel das zweite Ziel den Index zu senken, sodass die Person nach diesem Mesozyklus im Bereich „Normalgewicht“ (18.5 BMI – 24.9 BMI)
Inhaltsverzeichnis
- 1 DIAGNOSE
- 1.1 Allgemeine und biometrische Daten
- 1.2 Krafttestung
- 2 ZIELSETZUNG/PROGNOSE
- 3 TRAININGSPLANUNG MAKROZYKLUS
- 4 TRAININGSPLANUNG MESOZYKLUS
- 5 LITERATURRECHERCHE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beschreibt die Durchführung einer Trainingsdiagnostik mit einer Testperson. Die Zielsetzung ist es, die individuellen Stärken und Schwächen der Testperson zu ermitteln, um einen auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Trainingsplan zu erstellen.
- Allgemeine und biometrische Daten der Testperson
- Krafttestung mit der Borg Skala
- Einstufung der Testperson als „Beginner“
- Festlegung der Trainingsziele: Gewichtsreduktion, Kräftigung, Verbesserung der allgemeinen Fitness
- Entwicklung eines Trainingsplans basierend auf den Testergebnissen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Diagnose
Dieses Kapitel beschreibt die Erhebung der allgemeinen und biometrischen Daten der Testperson. Es werden Alter, Geschlecht, Körpergröße, Körpergewicht, Trainingsmotive, berufliche Tätigkeit, aktuelle und frühere sportliche Aktivitäten sowie der Blutdruck dokumentiert.
Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Krafttestung mit Hilfe der Borg Skala vorgestellt. Es werden die einzelnen Übungen, die Wiederholungszahlen und die erreichten Gewichte detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Krafttestung, Borg Skala, Trainingsdiagnostik, Trainingsziele, Gewichtsreduktion, Kräftigung, allgemeine Fitness, Beginner, Trainingsplanung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der BMI berechnet und bewertet?
Der Body-Mass-Index setzt Gewicht und Größe ins Verhältnis. Ein Wert über 25 gilt laut WHO als Präadipositas (Übergewicht).
Was ist ein Mesozyklus in der Trainingsplanung?
Ein Mesozyklus ist ein mittelfristiger Trainingsabschnitt (meist 4-12 Wochen), der ein spezifisches Ziel wie Kraftaufbau oder Gewichtsreduktion verfolgt.
Was ist die Borg-Skala?
Ein Instrument zur subjektiven Einschätzung des Belastungsempfindens während des Trainings, das häufig bei Krafttests eingesetzt wird.
Wie viel Gewichtsverlust ist pro Woche realistisch?
Laut sportwissenschaftlichen Angaben (z.B. Eifler) ist eine Reduktion des Körperfetts um 250 bis 500 Gramm pro Woche realistisch.
Warum ist eine Diagnose vor dem Training wichtig?
Sie dient der Erhebung biometrischer Daten und der Krafttestung, um den Trainingsplan individuell auf den Leistungsstand (z.B. Beginner) anzupassen.
- Quote paper
- Christina Backer (Author), 2015, Trainingsplanung. Makrozyklus und Mesozyklus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295196