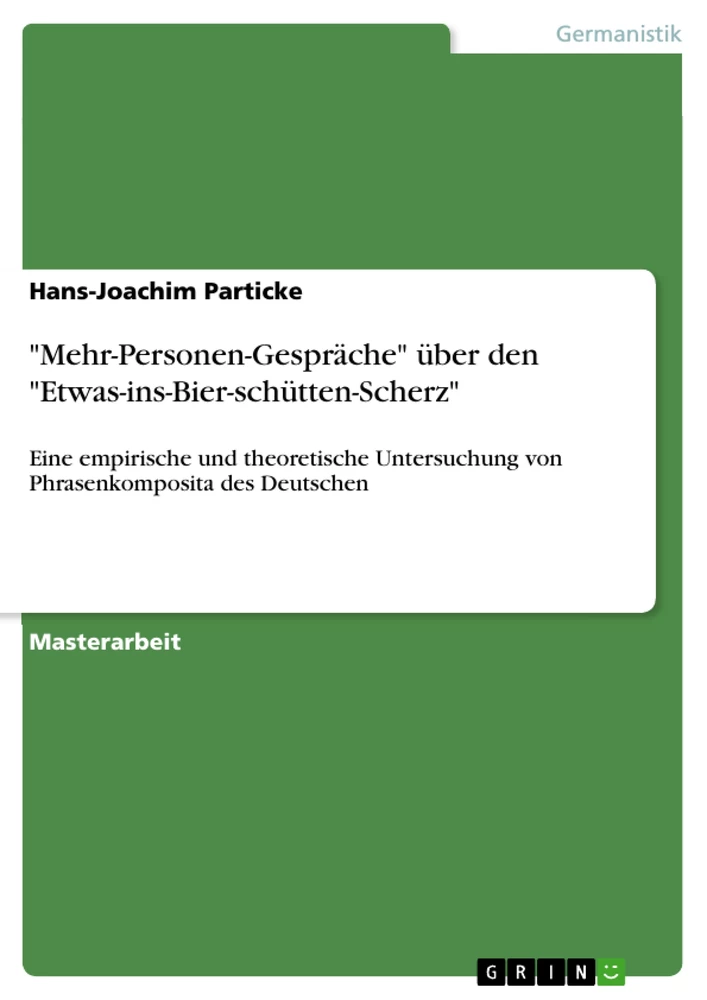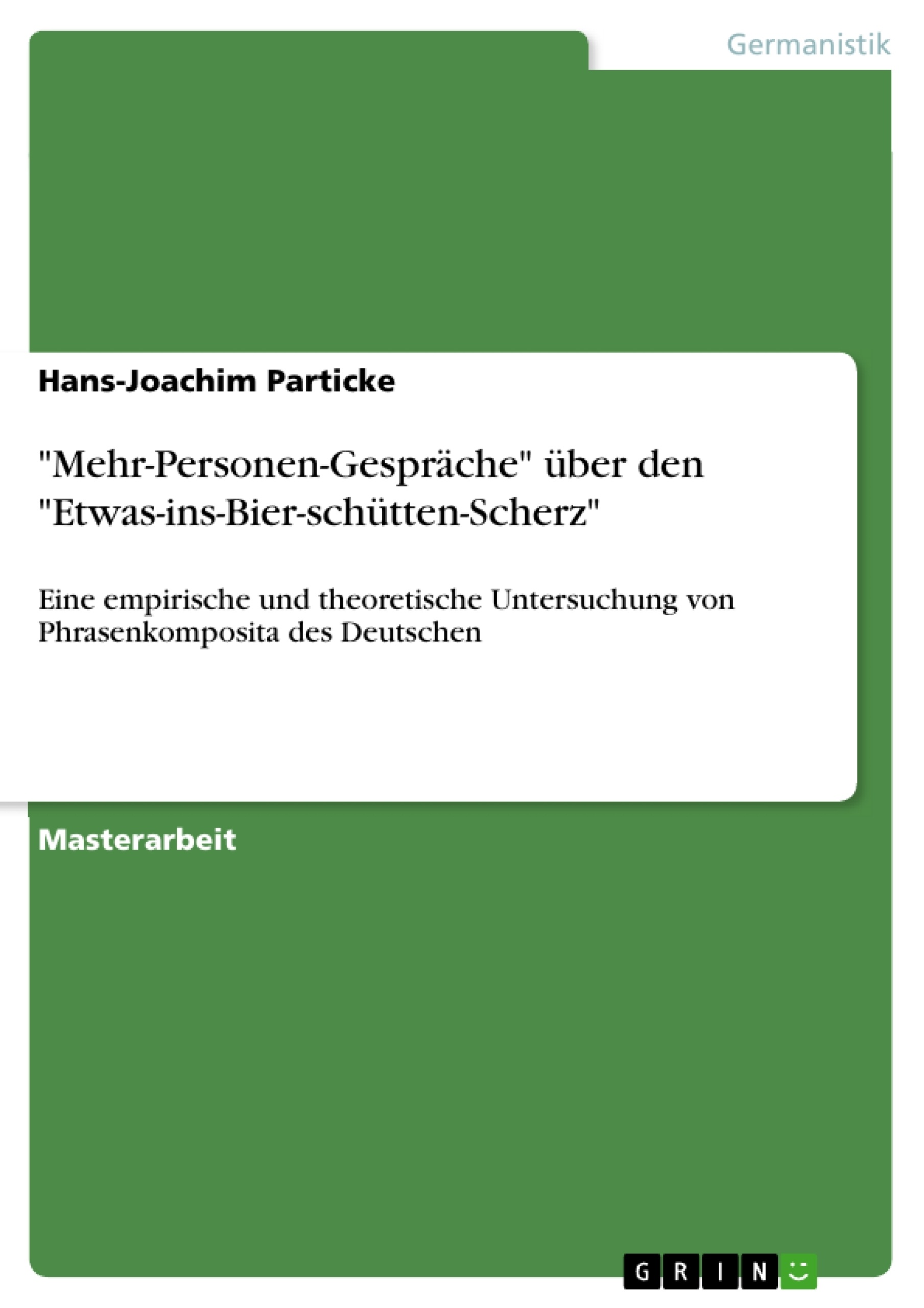Lassen sich Phrasen bzw. ganze Sätze in Wortstrukturen einbetten? Intuitiv betrachtet würde man eine solche Frage wohl verneinen oder zumindest wesentliche Einschränkungen erwarten. Dies geschieht nicht ohne Grund, denn in einem traditionellen Grammatikmodell werden beide Ebenen,
Wort- und Satzstruktur, für gewöhnlich strikt voneinander abgegrenzt. Als ein Sonderfall im Bereich der Wortbildung qua Komposition scheinen Phrasenkomposita diese Unterscheidung in Frage zu stellen: Ihre Erstkonstituente lässt sich in der Terminologie der generativen Grammatik als Phrase beschreiben, wohingegen der Kopf der Zusammensetzung eine lexikalische Kategorie darstellt, wie die folgenden Beispiele illustrieren (entnommen aus Wiese 1996:184):
(1)
a. die Wer-war-das-Frage
b. der Zwischen-den-Zeilen-Widerstand
c. der Von-Albert-geküsst-worden-zu-sein-Alptraum
d. die Ein-Kerl-wie-ich-Visagen
Die Daten in (1) lassen den Schluss zu, dass neben der Bildung rein lexikalischer Zusammensetzungen die Möglichkeit besteht, das Erstglied in Komposita durch eine Phrase unterschiedlicher
syntaktischer Kategorie zu realisieren. (1-a) macht beispielsweise Gebrauch von einer CP mit Fragepronomina in der Vorderkonstituente, wohingegen in (1-b) die Erstgliedposition durch eine Präpositionalphrase besetzt wird.
Die vorliegende Arbeit wirft eine morphosyntaktische Perspektive auf derartige Phrasenkomposita des Deutschen. In einer ersten Annäherung sollen in Teil II grundlegende Konzepte
definiert sowie Eigenschaften von Phrasenkomposita behandelt werden. Es wird gegen eine Limitierung der Komposition auf den morpholexikalischen Bereich argumentiert, was sich vor allem aus der Beobachtung ergibt, dass die Erstkonstituenten in Phrasenkomposita eine Reihe genuin syntaktischer Phänomene aufweisen, die auf eine Generierung im Syntax-Modul schließen lassen.
Daher lässt sich davon ausgehen, dass Produkte der Syntax im Rahmen der Komposition mit lexikalischen Einheiten kombiniert werden können. Mit einer solchen ‚Öffnung‘ der Komposition gegenüber der Syntax gelingt es zudem, die Phrasenkomposition theoretisch sicher zu erfassen,
anstatt sie als marginale Erscheinung betrachten zu müssen. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit dargelegte Erstgliedphrasenbedingung (EPB) fasst die syntaktischen Eigenschaften der Kompositionserstglieder zusammen und fungiert darüber hinaus als ein heuristisches Instrument bei der empirischen Untersuchung phrasaler Zusammensetzungen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- Präliminarien zum Untersuchungsgegenstand
- II Theoretischer Teil
- 1 Komposition: Kreativität und Restriktionen
- 2 Die Phrasenkomposition – ein Subtyp
- 2.1 Im Anfang war – die Phrase? Zum Status des Erstglieds
- 2.1.1 Extrahierbarkeit
- 2.1.2 Prosodie: Identisches Akzentmuster
- 2.1.3 Anaphorische Referenz auf Erstgliedelemente?
- 2.1.4 Syntaktische Abhängigkeitsrelationen
- 2.1.5 Die Erstgliedphrasenbedingung (EPB)
- 2.2 Rechtsköpfigkeit
- 2.3 Phrasenkomposita als Determinativkomposita
- 2.4 Binäre Strukur
- 2.5 Abgrenzung gegen andere Typen phrasaler Wortbildung
- 3 Rezeption und Forschungslage
- 3.1 Ein Randphänomen? .
- 3.2 „Gar nicht so töricht, wie sie gewöhnlich aufgefaßt werden“
- 3.2.1 Die Vorläufer
- 3.2.2 Behandlung in der modernen Theoriebildung
- 3.3 Eine sprachübergreifende Betrachtung
- 3.3.1 , Angst vor Eis mit Schlagsahne‘: Phrasenkomposita im Niederländi-schen und Afrikaans
- 3.3.2 Phrasenkomposita in den romanischen Sprachen?
- 4 Zwischenfazit
- III Empirischer Teil
- 5 Kritik an bisherigen Korpusstudien
- 6 Eine explorative Korpusstudie
- 6.1 Methodisches
- 6.1.1 Wahl des Korpus
- 6.1.2 Formulierung der Suchanfrage
- 6.2 Bearbeitung der Rohdaten . . .
- 6.2.1 Die EPB in der Praxis: Anmerkungen zu exkludierten Tokens
- 6.2.2 Annotation
- 6.3 Ergebnisse und Diskussion
- 6.3.1 Anzahl genuiner Phrasenkomposita
- 6.3.2 Verteilung nach Phrasentypen im Erstglied
- 6.3.3 Lexikalisierte Erstglieder und Zitate
- 6.3.4 Zwischen fast food und bad boys: Bilinguale Bildungen
- 6.3.5 ,Kopfsache‘: Zum Status der Zweitglieder
- 7 Zweites Zwischenfazit
- IV Theoretischer Teil
- 8 Lineare Modelle: Erst Morphologie, dann Syntax
- 8.1 Zitatanalyse (Wiese 1996) . . . .
- 8.2 Konversionsanalyse (Gallmann 1990)
- 9 Syntaktische Modelle: Unifikation
- 9.1 Lieber (1988, 1992)
- 9.2 Sato (2008), Harley (2009)
- 10 Gemischte Modelle: Interaktion
- 10.1 Lawrenz (2006). .
- 10.2 Ackema & Neelemann (2004), Meibauer (2007)
- 11 Drittes Zwischenfazit und Ausblick
- V Zusammenfassung
- Die Erstgliedphrasenbedingung (EPB) als heuristisches Instrument zur Analyse syntaktischer Eigenschaften der Kompositionserstglieder
- Eine explorative Korpusstudie zur Analyse der Daten hinsichtlich der im Erstglied vorkommenden Phrasentypen
- Die Untersuchung der Frage, inwiefern es sich bei den analysierten Bildungen um lexikalisierte Bildungen oder Zitate handelt
- Die Analyse von Mischbildungen, insbesondere des Deutschen und Englischen
- Die theoretische Modellierung von Phrasenkomposita unter Berücksichtigung der erhobenen Daten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Phrasenkomposita des Deutschen aus morphosyntaktischer Sicht. Ziel ist es, die Komposition über den morpholexikalischen Bereich hinaus zu erweitern und die Generierung von Phrasenkomposita im Syntax-Modul zu belegen. Die Arbeit argumentiert für eine „Öffnung“ der Komposition gegenüber der Syntax, um Phrasenkomposita als ein integrales Element der Wortbildung zu begreifen und nicht als marginale Erscheinung zu betrachten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Untersuchungsgegenstand vor und argumentiert für eine Erweiterung der Komposition auf den syntaktischen Bereich. Teil II definiert grundlegende Konzepte und behandelt Eigenschaften von Phrasenkomposita, einschließlich der Erstgliedphrasenbedingung (EPB). Außerdem werden die Rezeptionsgeschichte der Phrasenkomposita und eine sprachübergreifende Betrachtung behandelt. Teil III präsentiert eine explorative Korpusstudie, die die EPB bei der Analyse der Daten berücksichtigt. Die Studie untersucht die Verteilung der Phrasentypen im Erstglied, lexikalisierte Bildungen und Zitate, bilinguale Bildungen und die Beschaffenheit der Nomina in Kopfposition. Teil IV stellt verschiedene theoretische Modelle zur Modellierung von Phrasenkomposita vor, einschließlich linearer, syntaktischer und gemischter Modelle. Die Arbeit argumentiert, dass gemischte Modelle das Phänomen der Phrasenkomposition am adäquatesten erfassen. Teil V fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt noch offene Fragen an.
Schlüsselwörter
Phrasenkomposita, Wortbildung, Morphosyntax, Syntax, Komposition, Erstgliedphrasenbedingung (EPB), Korpusstudie, theoretische Modellierung, lineare Modelle, syntaktische Modelle, gemischte Modelle, Pragmatik.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Phrasenkomposita?
Phrasenkomposita sind Wortzusammensetzungen, bei denen das erste Glied eine ganze Phrase oder ein Satz ist, wie zum Beispiel in „die Wer-war-das-Frage“.
Was besagt die Erstgliedphrasenbedingung (EPB)?
Die EPB ist ein Instrument zur Analyse dieser Wörter. Sie fasst die syntaktischen Eigenschaften der Erstglieder zusammen und hilft zu bestimmen, ob es sich um echte Phrasenkomposita handelt.
Entstehen Phrasenkomposita in der Morphologie oder in der Syntax?
Die Arbeit argumentiert, dass diese Bildungen syntaktische Merkmale aufweisen und somit belegen, dass Produkte der Syntax direkt mit lexikalischen Einheiten kombiniert werden können.
Sind Phrasenkomposita eine Randerscheinung der Sprache?
Früher oft als marginal abgetan, zeigt die moderne Theoriebildung und Korpusstudien, dass sie ein integrales und kreatives Element der deutschen Wortbildung sind.
Gibt es Phrasenkomposita auch in anderen Sprachen?
Ja, die Arbeit vergleicht das Deutsche mit dem Niederländischen und Afrikaans, wo ähnliche Strukturen vorkommen, während sie in romanischen Sprachen seltener oder anders aufgebaut sind.
- Citation du texte
- Hans-Joachim Particke (Auteur), 2015, "Mehr-Personen-Gespräche" über den "Etwas-ins-Bier-schütten-Scherz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295466