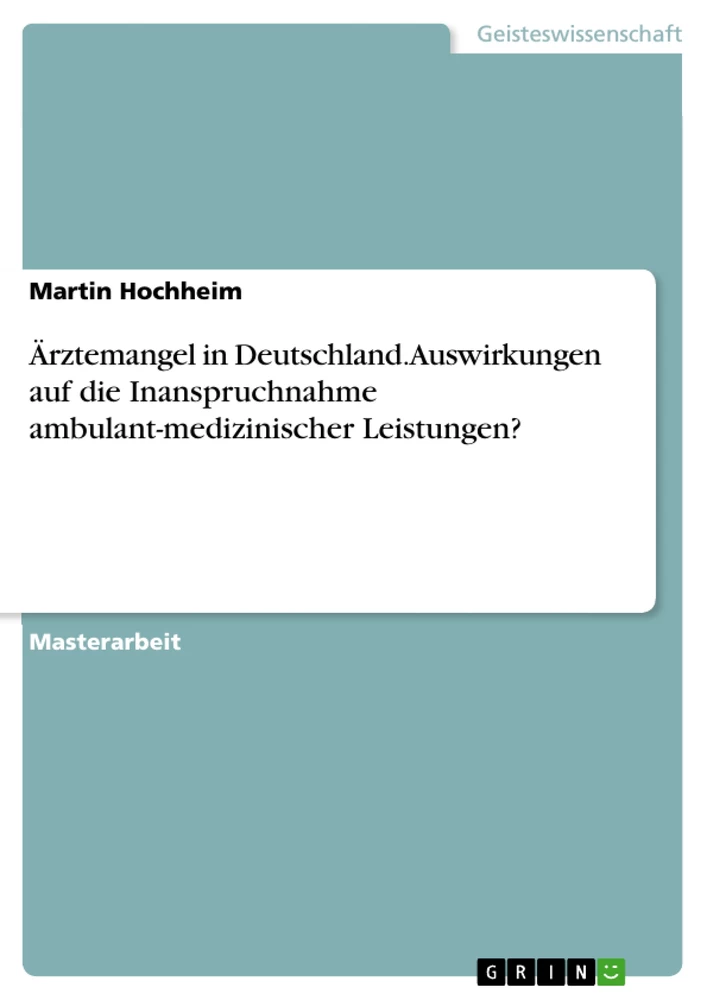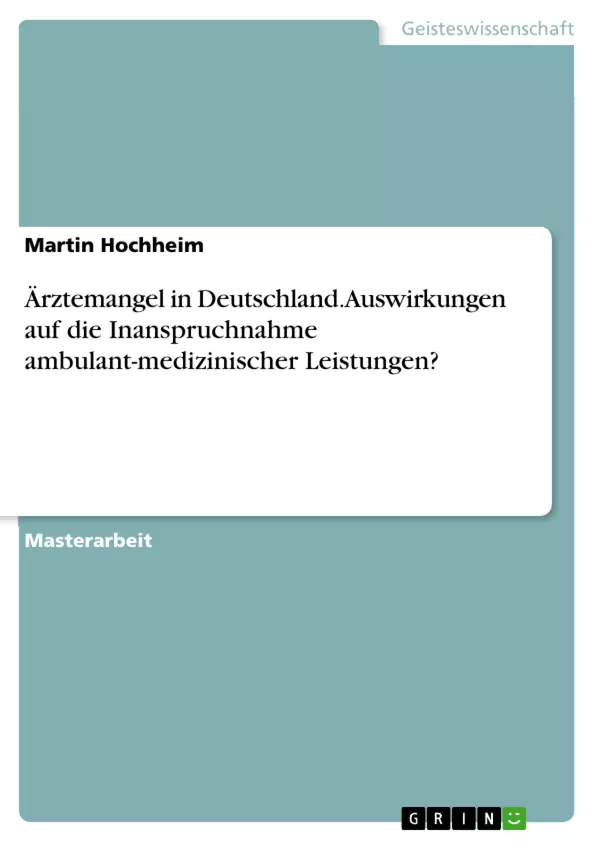„In absehbarer Zeit werden sich ‚weiße Flecken’ in der hausärztlichen Versorgung auftun. Ganze Landstriche werden ohne einen Hausarzt dastehen“. Immer häufiger werden Berichte wie dieser veröffentlicht, in denen ein Ärztemangel beschrieben oder prophezeit wird. Besonders in ländlichen Kommunen scheint die Situation bedrohlich. Projekte wie Ärztebusse, Delegation und Co. sollen die Situation kontrollieren und eine Regelversorgung garantieren. Entgegengesetzte Stimmen sprechen jedoch von einer maßlosen Übertreibung und sehen einen Ärztemangel weder gegeben noch zu befürchten.
Das angestrebte Forschungsprojekt hat daher das Ziel herauszufinden, inwieweit ein Ärztemangel besteht und welche messbaren Auswirkungen dieser auf die Inanspruchnahme ambulant-medizinischer Leistungen hat. In einem ersten Schritt soll hergeleitet werden, wieso ein Ärztemangel im ambulant-medizinischen Bereich befürchtet wird. Thematisch analysiert werden hier unter anderem der Rückgang der Allgemeinärzte, der demografische Wandel und seine Folgen, sowie das zunehmende Vorhandensein von Multimorbidität in der deutschen Bevölkerung.
Nach diesen theoretischen Überlegungen soll anhand der Literatur überprüft werden, inwieweit ein Ärztemangel tatsächlich schon besteht. Nach der theoretischen Erschließung des Ärztemangels wird empirisch dessen Auswirkung gemessen. Hierzu wird Andersens Behavioral Model of Health Service Use (1968) verwendet. Die Grundannahme, die Andersen trifft, geht davon aus, dass es möglich ist mit den Informationen über die Eigenschaften einer Person und ihrem gesundheitlichen Bedarf eine Vorhersage und Erklärung der persönlichen Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen (Ärzten) zu treffen.
In mehreren multinomialen logistischen Regressionen soll überprüft werden, welchen Einfluss die Einschätzung eines Ärztemangels in der persönlichen Umgebung (abgefragt durch das Item „In dieser Gegend fehlt es an Ärzten und Apotheken“) auf das Inanspruchnahmeverhalten der Patienten hat.
Datengrundlage ist der Deutsche Alterssurvey (DEAS) des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) aus dem Jahr 2008. Grundgesamtheit der Umfrage sind alle 40-85 Jährigen mit gemeldetem Hauptwohnsitz in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Definition Ärztemangel
- 1.2 Entdeckungs- und Verwertungszusammenhang
- 1.3 Relevanz des Themas
- 1.4 Access-Modelle
- 2. Warum der Ärztemangel erwartet wird
- 2.1 Wissenschaftliche Methode
- 2.2 Entwicklungen auf der Nachfrageseite
- 2.3 Entwicklungen auf der Angebotsseite
- 2.4 Forschungshypothesen
- 3. Einschätzungen und Meinungen über den Ärztemangel
- 3.1 GKV vs. KBV
- 3.2 Standpunkt der Gesetzlichen Krankenversicherung
- 3.3 Standpunkt der Ärzteschaft
- 3.4 Objektive Studien zum Ärztemangel
- 3.5 Zusammenfassung der Einschätzungen über den Ärztemangel
- 4. Verteilung der Ärzte
- 4.1 Bedarfsplanung
- 4.2 Kritik an der Bedarfsplanung
- 5. Hypothesenentwicklung
- 6. Behavioral Model of Health Service Use
- 6.1 Modellbausteine
- 6.2 Predisposing Characteristics
- 6.3 Enabling Resources
- 6.4 Need
- 6.5 Outcome Variablen
- 7. Empirische Analyse
- 7.1 Beschreibung des Datensatzes
- 7.2 Deskriptive Analyse des Ärztemangels
- 7.3 Anpassung der Forschungshypothesen
- 8. Indikatorenbildung
- 8.1 Predisposing Characteristics
- 8.2 Enabling Factors
- 8.3 Need Factors
- 9. Ergebnisse der statistischen Analyse
- 9.1 Vorgehensweise
- 9.2 Statistische Erläuterungen
- 9.3 Ergebnisse Allgemeinarzt
- 9.4 Ergebnisse Fachärzte
- 9.5 Ergebnisse Prävention
- 10. Diskussion
- 10.1 Zusammenfassung der Regressionen
- 10.2 Methodische Einschränkungen
- 10.3 Inhaltliche Einschränkungen
- 10.4 Bedeutung der Ergebnisse für die medizinische Versorgung
- 11. Lösungsmöglichkeiten
- 11.1 Angebotsseite
- 11.2 Nachfrageseite
- 11.3 Zusammenfassung der Lösungsmöglichkeiten
- 12. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Ärztemangel in Deutschland und dessen Auswirkungen auf die Inanspruchnahme ambulant-medizinischer Leistungen. Die Arbeit analysiert die Ursachen des erwarteten Ärztemangels, bewertet verschiedene Einschätzungen und Meinungen zum Thema und untersucht den Einfluss des Ärztemangels auf das Inanspruchnahmeverhalten von Patienten.
- Definition und Messung des Ärztemangels
- Analyse der Entwicklungen auf der Angebots- und Nachfrageseite
- Bewertung unterschiedlicher Perspektiven zum Ärztemangel (GKV, KBV, Studien)
- Einfluss des Ärztemangels auf die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen
- Mögliche Lösungsansätze zur Bewältigung des Ärztemangels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Ärztemangel in Deutschland ein, definiert den Begriff und beschreibt die Relevanz der Thematik. Es werden verschiedene Access-Modelle im Gesundheitswesen vorgestellt, die den Zugang zu medizinischer Versorgung beeinflussen. Der Kontext der Arbeit und die Forschungsfrage werden klar umrissen.
2. Warum der Ärztemangel erwartet wird: Dieses Kapitel untersucht die erwarteten Entwicklungen auf der Angebots- und Nachfrageseite des Gesundheitsmarktes, die zum Ärztemangel beitragen. Es werden demografische Veränderungen, der steigende Bedarf an medizinischen Leistungen und die Entwicklungen im Bereich der ärztlichen Versorgung analysiert. Die wissenschaftliche Methode und die aufgestellten Forschungshypothesen werden erläutert.
3. Einschätzungen und Meinungen über den Ärztemangel: Hier werden die unterschiedlichen Perspektiven der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und Ergebnisse objektiver Studien zum Ärztemangel gegenübergestellt und analysiert. Die unterschiedlichen Einschätzungen und deren Begründung werden detailliert dargestellt und verglichen.
4. Verteilung der Ärzte: Dieses Kapitel befasst sich mit der räumlichen Verteilung von Ärzten in Deutschland und analysiert die bestehende Bedarfsplanung. Es wird kritisch hinterfragt, inwieweit die Bedarfsplanung den tatsächlichen Bedarf an Ärzten widerspiegelt und wo Schwachstellen liegen.
5. Hypothesenentwicklung: In diesem Kapitel werden die im vorherigen Kapitel entwickelten Thesen und Annahmen präzisiert und in konkrete, überprüfbare Hypothesen überführt. Diese Hypothesen bilden die Grundlage für die empirische Untersuchung.
6. Behavioral Model of Health Service Use: Das Kapitel beschreibt das "Behavioral Model of Health Service Use" als theoretisches Rahmenmodell für die empirische Analyse. Die einzelnen Bausteine des Modells (Predisposing Characteristics, Enabling Resources, Need, Outcome Variablen) werden erläutert und im Kontext des Ärztemangels interpretiert.
7. Empirische Analyse: Dieses Kapitel beschreibt die Datenbasis der Studie und die angewandte Methodik der deskriptiven und inferentiellen Datenanalyse. Die angewandten statistischen Verfahren werden erläutert und die Anpassung der Forschungshypothesen an die Gegebenheiten des Datensatzes wird begründet.
8. Indikatorenbildung: Hier werden die Indikatoren für die im Behavioral Model of Health Service Use definierten Variablen (Predisposing Characteristics, Enabling Factors, Need Factors) operationalisiert und erläutert. Die Auswahl der Indikatoren wird im Hinblick auf ihre Messbarkeit und Aussagekraft begründet.
Schlüsselwörter
Ärztemangel, ambulant-medizinische Leistungen, Gesundheitsversorgung, Bedarfsplanung, Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Behavioral Model of Health Service Use, empirische Analyse, Regression, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Ärztemangel in Deutschland und seine Auswirkungen auf die Inanspruchnahme ambulant-medizinischer Leistungen
Was ist das zentrale Thema dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Ärztemangel in Deutschland und dessen Auswirkungen auf die Inanspruchnahme ambulant-medizinischer Leistungen. Sie analysiert die Ursachen des erwarteten Ärztemangels, bewertet verschiedene Einschätzungen und Meinungen zum Thema und untersucht den Einfluss des Ärztemangels auf das Inanspruchnahmeverhalten von Patienten.
Welche Aspekte des Ärztemangels werden untersucht?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklungen auf der Angebots- und Nachfrageseite des Gesundheitsmarktes, bewertet unterschiedliche Perspektiven von GKV, KBV und Studien, analysiert die räumliche Verteilung von Ärzten und die Bedarfsplanung, und untersucht den Einfluss des Ärztemangels auf die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. Mögliche Lösungsansätze werden ebenfalls diskutiert.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus Literaturrecherche, Analyse unterschiedlicher Perspektiven (GKV, KBV, Studien), und empirischer Analyse. Das "Behavioral Model of Health Service Use" dient als theoretischer Rahmen. Die empirische Analyse umfasst deskriptive und inferentielle Statistik, einschließlich Regressionsanalysen.
Welche Daten werden in der empirischen Analyse verwendet?
Die Arbeit beschreibt den verwendeten Datensatz im Detail in Kapitel 7. Die genaue Spezifikation der Datenquelle wird im Dokument selbst erläutert.
Welche Hypothesen werden untersucht?
Die konkreten Forschungshypothesen werden in Kapitel 2 und 5 formuliert und im Laufe der Arbeit anhand der empirischen Daten überprüft. Die Anpassung der Hypothesen an den Datensatz wird ebenfalls explizit dargestellt.
Wie wird der Ärztemangel definiert und gemessen?
Die Definition und Messung des Ärztemangels wird in Kapitel 1 erläutert. Verschiedene Zugangsmodelle im Gesundheitswesen werden ebenfalls vorgestellt, um den Kontext zu verdeutlichen.
Welche Perspektiven zum Ärztemangel werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Perspektiven der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und Ergebnisse objektiver Studien zum Ärztemangel. Die unterschiedlichen Einschätzungen und deren Begründung werden detailliert dargestellt und verglichen (Kapitel 3).
Wie wird die räumliche Verteilung der Ärzte untersucht?
Kapitel 4 befasst sich mit der räumlichen Verteilung der Ärzte in Deutschland und analysiert die bestehende Bedarfsplanung kritisch. Die Arbeit hinterfragt, inwieweit die Bedarfsplanung den tatsächlichen Bedarf widerspiegelt.
Welches theoretische Modell wird verwendet?
Das "Behavioral Model of Health Service Use" dient als theoretischer Rahmen für die empirische Analyse. Die einzelnen Bausteine des Modells (Predisposing Characteristics, Enabling Resources, Need, Outcome Variablen) werden erläutert und im Kontext des Ärztemangels interpretiert (Kapitel 6).
Welche Ergebnisse liefert die statistische Analyse?
Die Ergebnisse der statistischen Analyse, einschließlich der Regressionsergebnisse für Allgemeinärzte, Fachärzte und Prävention, werden in Kapitel 9 dargestellt und interpretiert.
Welche methodischen und inhaltlichen Einschränkungen werden diskutiert?
Kapitel 10 diskutiert methodische und inhaltliche Einschränkungen der Studie, um die Ergebnisse und deren Interpretation kritisch zu reflektieren.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Kapitel 11 präsentiert mögliche Lösungsansätze zur Bewältigung des Ärztemangels, sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ärztemangel, ambulant-medizinische Leistungen, Gesundheitsversorgung, Bedarfsplanung, Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Behavioral Model of Health Service Use, empirische Analyse, Regression, Deutschland.
- Citar trabajo
- Martin Hochheim (Autor), 2014, Ärztemangel in Deutschland. Auswirkungen auf die Inanspruchnahme ambulant-medizinischer Leistungen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295925