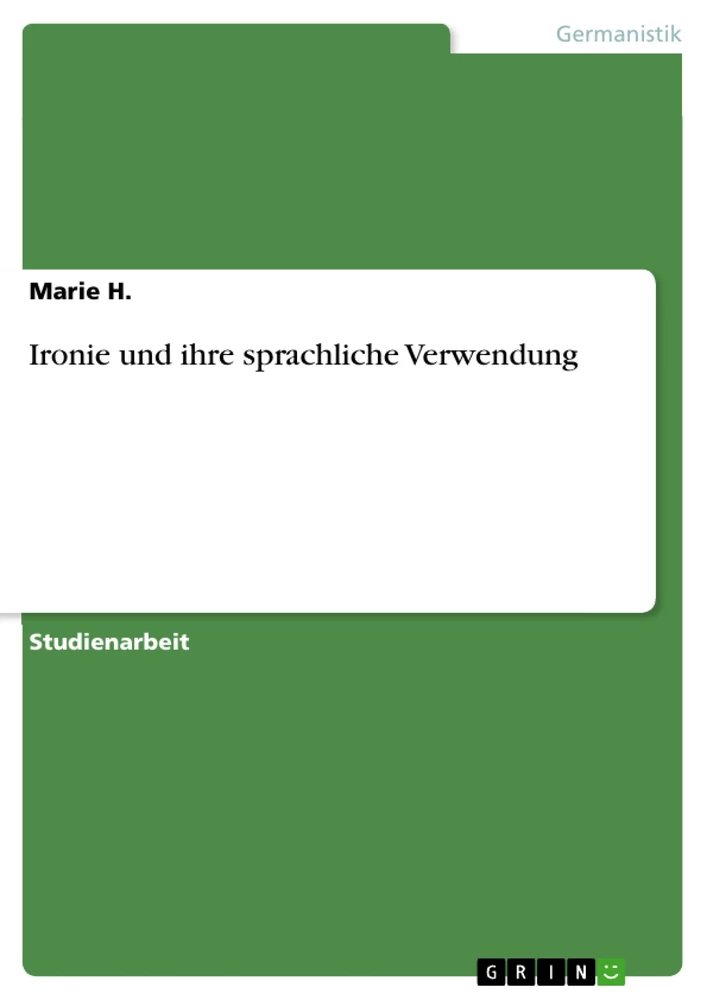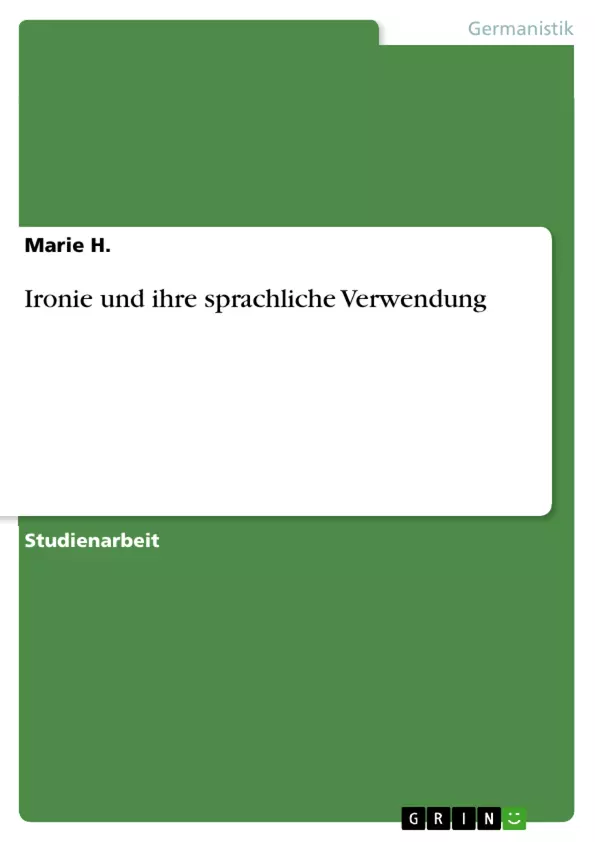Der Duden bezeichnet Ironie simpel als eine „paradoxe Konstellation, die einem als Spiel einer höheren Macht erscheint“. Diesem Spiel möchte ich in der folgenden Hausarbeit auf den Grund gehen: Wie wird sie gebraucht?
Jeder ist schon einmal mit Ironie in Kontakt gekommen. Meist scheint dies verbal zu geschehen: ein Sprecher äußert sich zu etwas und ein Hörer kann diese Äußerung ironisch, aber auch wörtlich verstehen. In solchen Fällen entstehen häufig Missverständnisse.
Ironie gibt es schon seit der Antike. Dort prägte Sokrates den Begriff. „Sokratische Ironie“ hat allerdings wenig mit der Ironie zu tun wie wir sie heute kennen. Seine Ironie wurde oft falsch verstanden, da er „immer dann die Wahrheit sagt, wenn die anderen meinen, daß er sich ironisch verstellt“ (Picht 1980: 228). Seine Zuhörer vermuteten, Sokrates lüge, wenn er sagte „Ich weiß, dass ich nichts weiß“. Sie dachten, dass er ihnen vorspiele die gesellschaftlich angesehenen Reize wie Geld und Wissen nicht zu besitzen, obwohl er sie besäße. Sokrates sprach aber seine subjektive Wahrheit, denn er hatte erkannt was wahre Ehre und wahrer Reichtum waren, weswegen er die vom Rest so geehrten gesellschaftlichen Vorzüge ablehn-te (vgl. Picht 228).
Wie schon erwähnt, hat diese sokratische Ironie wenig gemeinsam mit der, die ich im Folgenden begutachten werde. Für diese gibt es mehrere Definitionen. Kayser versteht Ironie also solche, dass „das Gegenteil von dem gemeint [ist], was mit den Worten gesagt wird“ (Kayser 1959: 111) und auch Lausberg, Asmuth und Berg-Ehlers, und Faulseit und Kühn sind dieser
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ironiesignale
- Ironietheorien
- Implikaturtheorie
- Konversationsmaximen von Grice
- Ironie als konversationelle partikuläre Implikatur
- Die Sprechakttheorie
- Was ist der Sprechakt?
- Ironie als Sprechakt
- Implikaturtheorie
- Die Verwendungsmotivation von Ironie
- Bewertung
- Humor
- Weitere Formen der Ironie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Ironie. Sie analysiert, wie Ironie funktioniert, welche Signale sie verwendet und welche Motivationsfaktoren zur Verwendung von Ironie führen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Theorien zur Erklärung von Ironie, insbesondere die Implikaturtheorie und die Sprechakttheorie.
- Definition und Merkmale von Ironie
- Erkennung von Ironie durch sprachliche Signale
- Theorien zur Erklärung von Ironie
- Motivationsfaktoren für die Verwendung von Ironie
- Beispiele und Fallstudien zur Veranschaulichung der Ironie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Ironie ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie definiert den Begriff der Ironie und beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze zur Erforschung des Phänomens. Des Weiteren wird die sokratische Ironie als ein historisches Beispiel für Ironie vorgestellt und von der modernen Ironie abgegrenzt.
Ironiesignale
Dieses Kapitel untersucht sprachliche und kontextuelle Signale, die auf Ironie hinweisen. Es werden verschiedene Beispiele für Ironie analysiert, die anhand von Betonung, Anführungsstrichen, ungewöhnlicher Terminologie und übertriebenen Metaphern erkannt werden können. Der Kontext spielt eine entscheidende Rolle bei der Interpretation von Ironie.
Ironietheorien
Die verschiedenen Theorien zur Erklärung von Ironie werden in diesem Kapitel vorgestellt. Die Implikaturtheorie von Grice wird erläutert, wobei die Konversationsmaximen und die Ironie als konversationelle partikuläre Implikatur im Fokus stehen. Die Sprechakttheorie wird ebenfalls betrachtet, mit einer Analyse des Sprechakts und der Ironie als Sprechakt.
Die Verwendungsmotivation von Ironie
Dieses Kapitel untersucht die Gründe für die Verwendung von Ironie. Es werden verschiedene Motivationsfaktoren wie Bewertung, Humor und weitere Formen der Ironie analysiert. Die Arbeit zeigt, wie Ironie genutzt werden kann, um Kritik zu üben, Emotionen auszudrücken, oder einfach nur zum Vergnügen.
Schlüsselwörter
Ironie, Implikaturtheorie, Sprechakttheorie, Konversationsmaximen, Ironiesignale, Verwendungsmotivation, Bewertung, Humor, Sprachliche Pragmatik.
- Quote paper
- Marie H. (Author), 2013, Ironie und ihre sprachliche Verwendung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295988