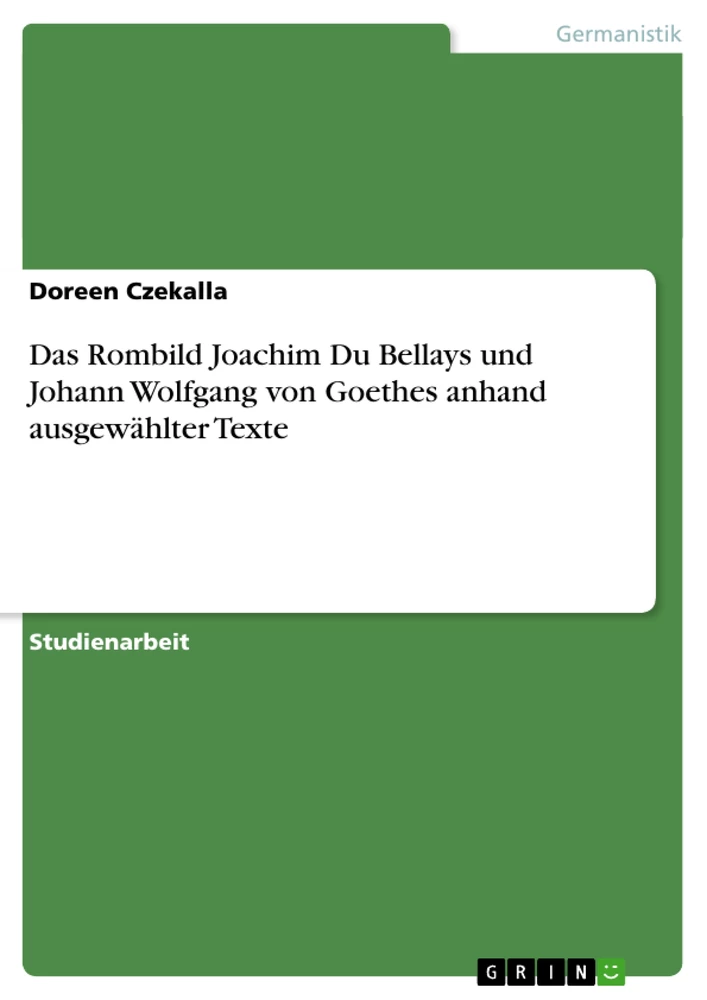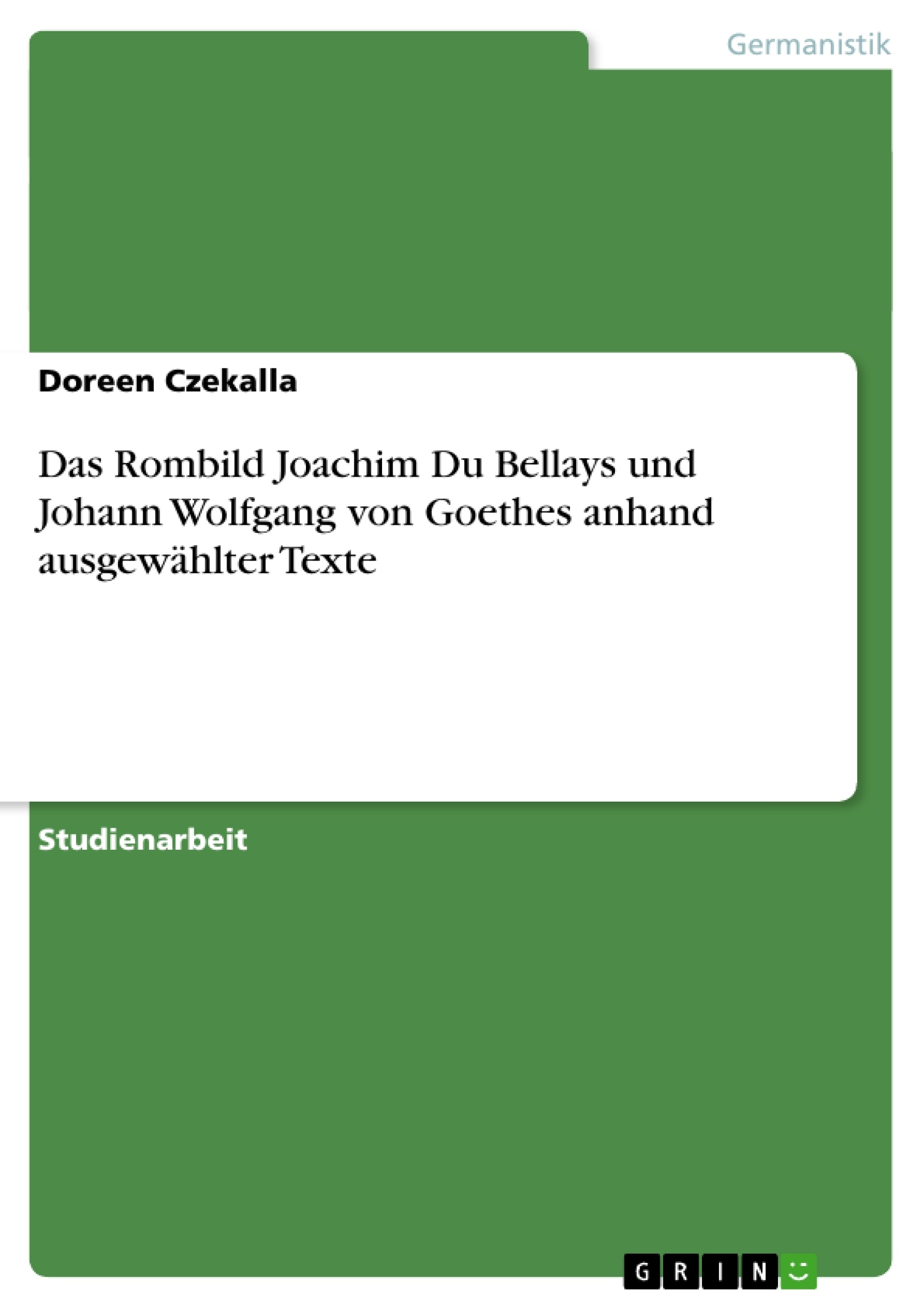Mit dem Städtenamen Rom verknüpfen sich verschiedene Vorstellungen. Zum einem die Erinnerung an das mächtige, antike Imperium, dem caput mundi, das im Mittelalter von byzantinischen Kaisern weitergeführt und zum Krönungsort der deutschen Kaiser wurde. Die Stadt der (katholischen) Christenheit, in der der Papst seinen Sitz hat und über die Ecclesia Roma das Weltreich weiterführte. ‚Römisch’ assoziert neben den antiken Tugenden und Werten, wie Demokratie und militärische Kraft und Disziplin auch den „Sittenverfall, [...] zu Dekadenz und Denunziantentum, Verschwendungssucht, [...] Caesarenwahn“1 bis hin zum Mord. Rom hat zu allen Zeiten Dichter inspiriert. Die ewige Stadt ist in den verschiedensten Formen literarisch verarbeitet worden seit der Antike und von Römern selbst und von Reisenden bis hin in unserer Zeit.
Johann Wolfgang von Goethe und Joachim Du Bellay haben auf den ersten Blick nur wenig gemeinsam. Beide wirkten in verschiedenen Zeiten und am Beginn neuer Strömungen. Du Bellay schrieb der Renaissance verpflichtet und unter den Einflüssen des Barock. Goethe verließ Weimar und seine Sturm und Drang Phase, um sich selbst und zum klassischen Schaffen zu finden. Beide verbindet die Erfahrung einer Reise nach Italien mit Halt in Rom, der Stadt ihrer teils verschiedenen, teils ähnlichen Vorstellungen und Erwartungen. Du Bellay kannte die Stadt aus dem Studium antiker Autoren. Goethe erfuhr von Rom schon früh aus den Erzählungen des Vaters, der italienischen Einrichtung des Elternhauses, wie den aufgehängten Prospekte2 und durch das Lesen klassisch-antiker Werke, die zum Bildungskanon der Zeit gehörten. Beide Dichter erlebten und verarbeiteten ihren Romaufenthalt und ihre Eindrücke auf unterschiedliche Art und Weise. Goethe schrieb erst viele Jahre später sein Reisetagebuch für die Öffentlichkeit, wohingegen Du Bellay bereits zu Beginn seines Aufenthaltes in Rom die Sonettsammlung Les Antiqitéz de Rome verfasste. Ich möchte in der folgenden Betrachtung zunächst jeweils die Werke im literarhistorischen Kontext einzeln vorstellen und dann miteinander in Bezug setzen. Zuerst werde ich anhand zweier Sonette aus den Antiquitéz de Rome3 Du Bellays Rombild entwickeln und dieses in der Betrachtung Goethes Romaufenthalt in der Italienischen Reise einbeziehend vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Joachim du Bellay: Les Antiquitéz de Rome
- Du Bellay - Dichter zwischen Renaissance und Barock
- Erste Begegnung - Antiquitéz III
- Trost aus Ruinen - Antiquitéz VII
- Johann Wolfgang von Goethe: Italienische Reise
- Rom als Ort der Wiedergeburt
- Symbiose von Alt und Neu
- Das zentrale Motiv des Sehens
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Rombild von Joachim du Bellay und Johann Wolfgang von Goethe anhand ausgewählter Texte. Ziel ist es, die jeweiligen Darstellungen Roms im literarhistorischen Kontext zu beleuchten und einen Vergleich beider Perspektiven vorzunehmen. Dabei werden die unterschiedlichen Einflüsse und die individuellen Erfahrungen der Dichter berücksichtigt.
- Rom als Ort der Erinnerung an ein mächtiges Imperium und gleichzeitig als Symbol des Verfalls.
- Der Einfluss der Renaissance und des Barock auf Du Bellays Rombild.
- Goethes Auseinandersetzung mit Rom im Kontext seiner italienischen Reise.
- Der Vergleich der unterschiedlichen literarischen Verarbeitung des Themas Rom.
- Die Rolle der melancholischen Stimmung und der Suche nach Identität bei beiden Dichtern.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die verschiedenen Assoziationen mit der Stadt Rom vor: vom mächtigen antiken Imperium bis zum „Sittenverfall“. Sie hebt die inspirierende Wirkung Roms auf Dichter hervor und skizziert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Goethe und Du Bellay, die beide Rom bereisten und literarisch verarbeiteten. Die Arbeit kündigt die Methode des Vergleichs der einzelnen Werke im literarhistorischen Kontext an.
Joachim Du Bellay: Les Antiquitéz de Rome: Dieses Kapitel beleuchtet Du Bellays Aufenthalt in Rom (1553-1557) als eine Zeit der Krise und Melancholie, die durch den Anblick der Ruinen und den Verfall der Stadt verstärkt wurde. Die Entstehung seiner Gedichtsammlung "Les Antiquitéz de Rome" (1558) wird im Kontext seiner persönlichen Erfahrungen und seiner Stellung als führendes Mitglied der Pléiade eingeordnet. Das Werk wird als lyrisches und politisches Kunstwerk beschrieben, das den Verfall Roms mit der Situation Frankreichs parallelisiert.
2.1 Du Bellay - Dichter zwischen Renaissance und Barock: Dieser Abschnitt untersucht Du Bellays Position als Dichter zwischen Renaissance und Barock. Die Renaissance, mit ihrem Streben nach der Wiedergeburt der Antike, wird als Hintergrund für Du Bellays Werk dargestellt. Sein Pessimismus angesichts der Dekadenz der Gegenwart wird erläutert, ebenso seine Zugehörigkeit zur Pléiade und das gemeinsame Ziel, die französische Dichtung nach antiken Vorbildern zu reformieren. Der Abschnitt hebt die Einzigartigkeit von Du Bellays Werk hervor, das nicht nur imitiert, sondern auch inhaltlich und formal erweitert.
Schlüsselwörter
Rom, Joachim du Bellay, Johann Wolfgang von Goethe, Les Antiquitéz de Rome, Italienische Reise, Renaissance, Barock, Verfall, Melancholie, Antike, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Rombildes bei Du Bellay und Goethe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert und vergleicht die Darstellung Roms bei Joachim du Bellay (in „Les Antiquitéz de Rome“) und Johann Wolfgang von Goethe (in „Italienische Reise“). Im Fokus stehen die jeweiligen Perspektiven auf Rom im literarhistorischen Kontext, die Berücksichtigung individueller Erfahrungen und die Einflüsse von Renaissance und Barock.
Welche Texte werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Texte aus „Les Antiquitéz de Rome“ von Joachim du Bellay und „Italienische Reise“ von Johann Wolfgang von Goethe. Konkret werden bei Du Bellay die Gedichte Antiquitéz III und VII genauer betrachtet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist der Vergleich der Rombilder beider Autoren. Es soll untersucht werden, wie Rom als Ort der Erinnerung an ein mächtiges Imperium und gleichzeitig als Symbol des Verfalls dargestellt wird, und wie die jeweiligen literarischen und historischen Kontexte die Perspektiven beeinflussen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet unter anderem den Einfluss der Renaissance und des Barock auf Du Bellays Rombild, Goethes Auseinandersetzung mit Rom während seiner Italienreise, die unterschiedliche literarische Verarbeitung des Themas Rom, die Rolle der Melancholie und die Suche nach Identität bei beiden Dichtern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Joachim du Bellay und seinen „Les Antiquitéz de Rome“ (mit Unterkapiteln zu Du Bellay als Dichter zwischen Renaissance und Barock sowie Einzelanalysen ausgewählter Gedichte), ein Kapitel zu Goethes „Italienische Reise“ und ein Schlusswort. Die Einleitung präsentiert die Thematik und die Methodik des Vergleichs.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rom, Joachim du Bellay, Johann Wolfgang von Goethe, Les Antiquitéz de Rome, Italienische Reise, Renaissance, Barock, Verfall, Melancholie, Antike, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Wie wird Du Bellays Werk eingeordnet?
Du Bellays „Les Antiquitéz de Rome“ wird als lyrisches und politisches Kunstwerk beschrieben, das den Verfall Roms mit der Situation Frankreichs parallelisiert. Sein pessimistischer Blick auf die Dekadenz der Gegenwart wird im Kontext seiner Zugehörigkeit zur Pléiade und dem Ziel der Reform der französischen Dichtung nach antiken Vorbildern betrachtet.
Wie wird Goethes Werk eingeordnet?
Goethes „Italienische Reise“ wird im Hinblick auf seine Auseinandersetzung mit Rom als Ort der Wiedergeburt und der Symbiose von Alt und Neu analysiert. Das zentrale Motiv des „Sehens“ spielt dabei eine wichtige Rolle.
Was ist das Ergebnis der vergleichenden Analyse?
Die Arbeit präsentiert einen detaillierten Vergleich der Rombilder von Du Bellay und Goethe, wobei die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ihren Darstellungen und den zugrundeliegenden literarischen und historischen Kontexten herausgearbeitet werden. Konkrete Ergebnisse sind aus dem Text selbst zu entnehmen, da die Zusammenfassung lediglich die Struktur und den Inhalt beschreibt.
- Citation du texte
- Doreen Czekalla (Auteur), 2004, Das Rombild Joachim Du Bellays und Johann Wolfgang von Goethes anhand ausgewählter Texte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29751