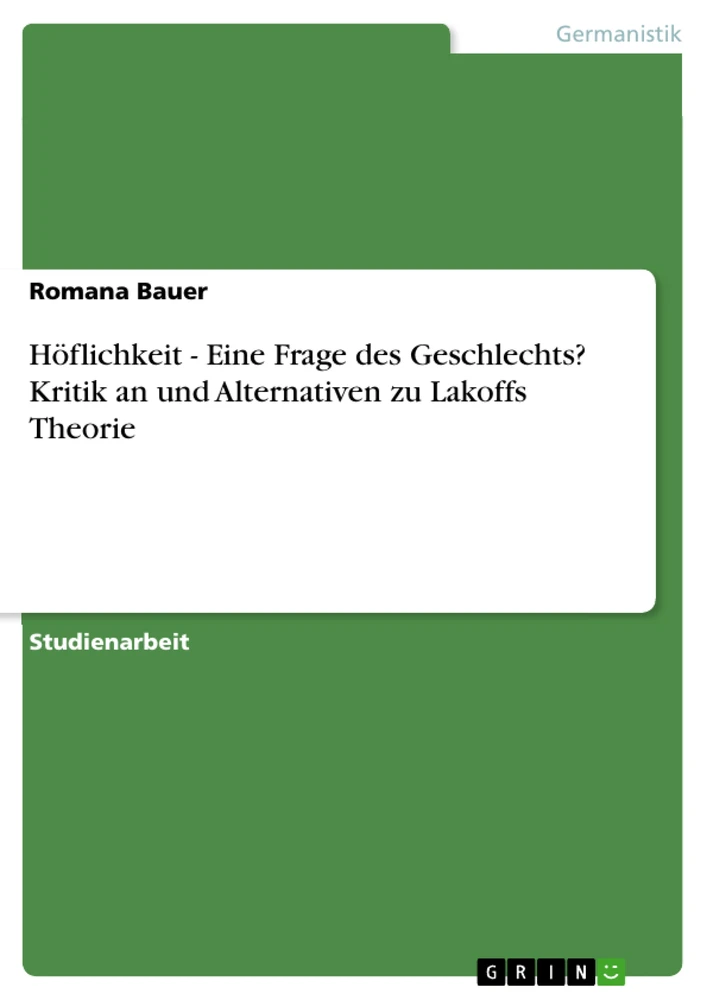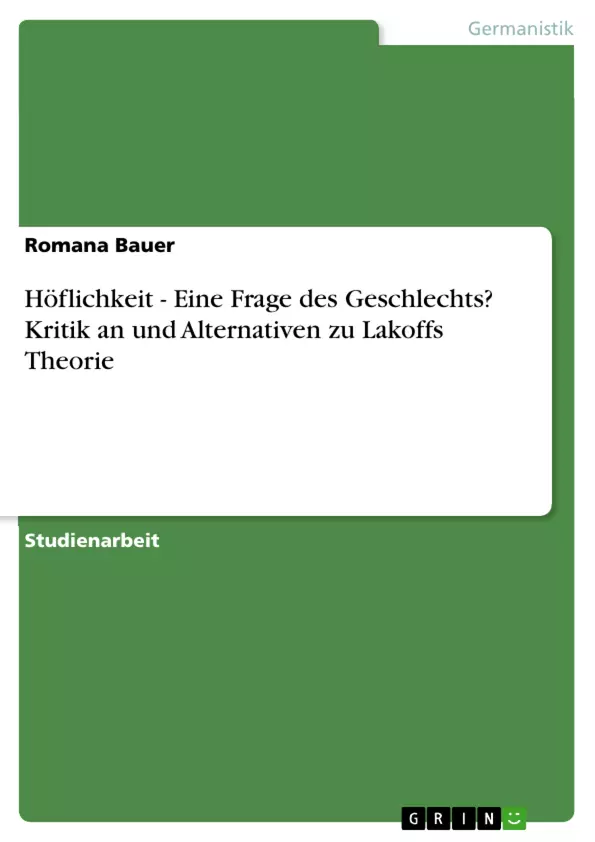Gerade in den letzten Jahren kommen wieder vermehrt sprachliche Gender-Debatten auf, vorwiegend im universitären Kontext. Aktuell wird intensiv die universelle Verwendung des generischen Maskulinum Studenten diskutiert, welcher weibliche Studentinnen ausschließe. Stattdessen fordern Gleichstellungsbeauftragte die Verwendung des Begriffs Studierende, der beide Geschlechter einschließt – ein rot-grünes Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen verlangt sogar die Umbenennung der Studentenwerke in Studierendenwerke. „Guten Tag, Herr Professorin“ titelte Spiegel-Online 2013, als die Universität Leipzig so weit ging, ihre Grundordnung zu ändern und fortan nur noch weibliche Personenbezeichnungen zu nutzen, die aber sowohl für weibliche als auch für männliche Personen gelten. Der Kampf um sprachliche Gleichberechtigung scheint aktuell wie nie.
Bereits 1973 kritisierte Robin Lakoff eine sprachliche Ungleichberechtigung der Geschlechter. In Ihrem Aufsatz „Language and woman’s place“ thematisiert sie zwei Seiten dieser Problematik: Einerseits die Art und Weise, wie Frauen sprechen, oder vielmehr, wie ihnen im Kindesalter beigebracht wird, zu sprechen, und andererseits die Form, in der über Frauen gesprochen wird. Für diese Arbeit wird vor allem ersteres von Interesse sein, die spezielle Sprechweise von Frauen nach Lakoff. Denn sie behauptet, Frauen bekämen beigebracht, wie eine Lady zu sprechen, wären daher zwar nicht in der Lage sich präzise und eindringlich auszudrücken, drückten sich in der Konsequenz aber insgesamt höflicher aus als Männer. Wie fundiert Lakoffs Arbeit ist, ob ihre Ansätze (vor allem in der heutigen Zeit) tatsächlich gültig sind, und welche anderen Faktoren es gibt, an denen Höflichkeit festzumachen ist, soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein.
Daher werden zunächst die Grundzüge von Robin Lakoffs Ansatz sowie ihr Konzept „Talking like a lady“ vorgestellt. Anschließend sollen einige Kritikpunkte dazu angeführt werden, einerseits zur Theorie an sich, andererseits zur Gültigkeit in der heutigen Zeit. Dann werden mit den Werken von Brown und Levinson (1987) und Sara Mills (2003) zwei alternative Sichtweisen auf die Höflichkeitsforschung gegeben. Abschließend erfolgt eine kurze Zusammenfassung und ein Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungsansätze.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Robin Lakoff: Talking like a lady
- Grundannahmen
- Ausprägungen von „Talking like a lady“
- Lexikalische Differenzen von Frauen- und Männersprache
- Syntaktische Differenzen von Frauen- und Männersprache
- Kritik
- Alternative Ansätze der Höflichkeitsforschung
- Brown & Levinson: Intervenierende Variablen R, D und P
- Gesichtsbedrohende Akte (FTAs)
- FTAs Abwenden: Höflichkeitsstrategien
- Sara Mills: Gender als eine, nicht einzige, Variable
- Fazit
- Mischformen männlicher und weiblicher Sprechweisen
- Gender im Verhältnis zu anderen Variablen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, Robin Lakoffs Theorie des „Talking like a lady“ aus dem Jahr 1973 zu analysieren und deren Gültigkeit in der heutigen Zeit zu hinterfragen. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob Frauen tatsächlich eine spezifische Sprechweise pflegen, die als höflicher empfunden wird als die von Männern.
- Lakoffs Grundannahmen über die Sprechweise von Frauen
- Kritik an Lakoffs Theorie und ihren Ansätzen
- Alternative Ansätze der Höflichkeitsforschung im Vergleich zu Lakoff
- Der Einfluss von Geschlecht auf Höflichkeit im Kontext anderer Variablen
- Mögliche Zusammenhänge zwischen männlichen und weiblichen Sprechweisen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der sprachlichen Genderdebatte ein und erläutert die Aktualität dieser Diskussion am Beispiel der Verwendung des generischen Maskulinums. Im Anschluss wird Robin Lakoffs Theorie des „Talking like a lady“ vorgestellt. Lakoff argumentiert, dass Frauen aufgrund ihrer Erziehung eine spezifische Sprechweise entwickeln, die als weniger präzise und kraftvoll, dafür aber als höflicher empfunden wird als die von Männern.
Im nächsten Abschnitt wird die Kritik an Lakoffs Theorie beleuchtet. Es wird untersucht, inwieweit die von ihr beschriebenen Unterschiede zwischen Frauen- und Männersprache tatsächlich existieren und ob diese Unterschiede tatsächlich auf die Höflichkeit zurückzuführen sind.
Anschließend werden zwei alternative Ansätze der Höflichkeitsforschung vorgestellt: Brown & Levinsons Theorie der Gesichtsbedrohenden Akte und Sara Mills Ansatz, der Gender als eine unter vielen Variablen der Höflichkeit betrachtet. Diese Ansätze bieten alternative Erklärungen für die Wahrnehmung von Höflichkeit in der sprachlichen Kommunikation und stellen Lakoffs Theorie in Frage.
Das vorletzte Kapitel behandelt Mischformen männlicher und weiblicher Sprechweisen und untersucht, ob es tatsächlich klare Trennlinien zwischen der Sprache von Frauen und Männern gibt.
Zum Schluss werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungsansätze gegeben.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit behandelt die Themenbereiche Höflichkeit, Gender, Sprache, Sprachliche Unterschiede, Frauensprache, Männersprache, Robin Lakoff, Brown & Levinson, Sara Mills, Gesichtsbedrohende Akte, Intervenierende Variablen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Robin Lakoffs Theorie „Talking like a lady“?
Lakoff argumentiert, dass Frauen von Kindheit an beigebracht wird, sich wie eine „Lady“ auszudrücken, was zu einer vermeintlich höflicheren, aber weniger präzisen und kraftvollen Sprechweise führt.
Welche Kritikpunkte gibt es an Lakoffs Ansatz?
Kritiker hinterfragen die empirische Basis sowie die heutige Gültigkeit der Theorie und untersuchen, ob die beschriebenen Unterschiede tatsächlich existieren oder auf anderen Faktoren beruhen.
Was sind die „intervenierenden Variablen“ nach Brown und Levinson?
Brown und Levinson definieren die Variablen R (Rang der Belastung), D (soziale Distanz) und P (Macht), um die Intensität von Höflichkeitsstrategien zu erklären.
Wie sieht Sara Mills das Verhältnis von Gender und Höflichkeit?
Sara Mills betrachtet Gender als eine von vielen Variablen der Höflichkeit und nicht als das alleinige Bestimmungsmerkmal sprachlichen Verhaltens.
Gibt es klare Trennlinien zwischen Frauen- und Männersprache?
Die Arbeit untersucht auch Mischformen und kommt zu dem Schluss, dass starre Trennlinien oft nicht der kommunikativen Realität entsprechen.
- Citar trabajo
- Romana Bauer (Autor), 2015, Höflichkeit - Eine Frage des Geschlechts? Kritik an und Alternativen zu Lakoffs Theorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298215