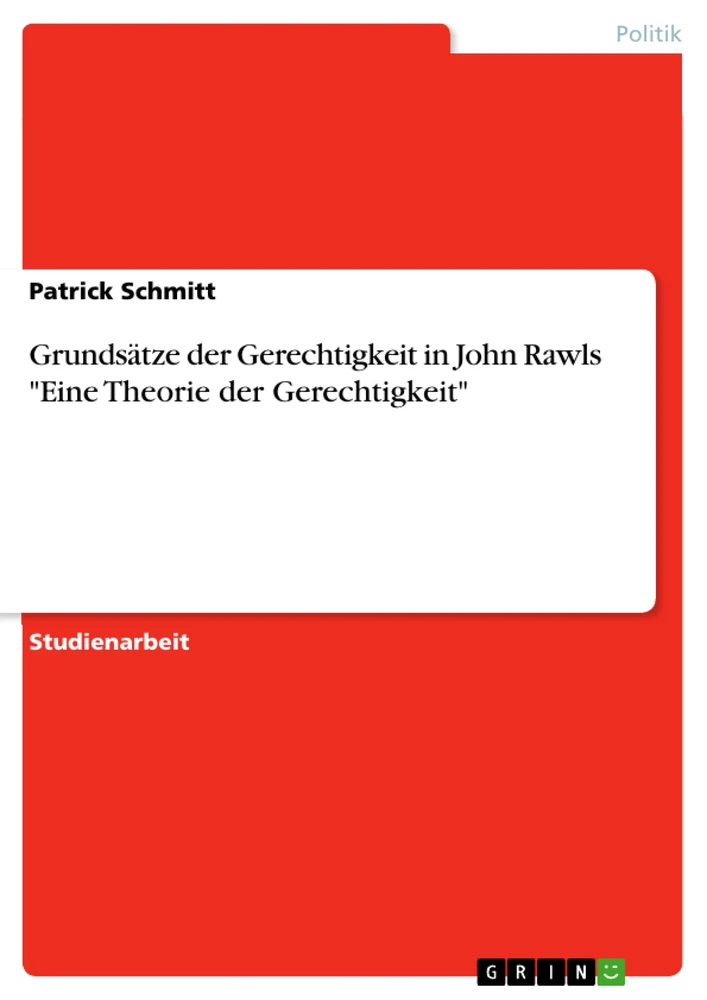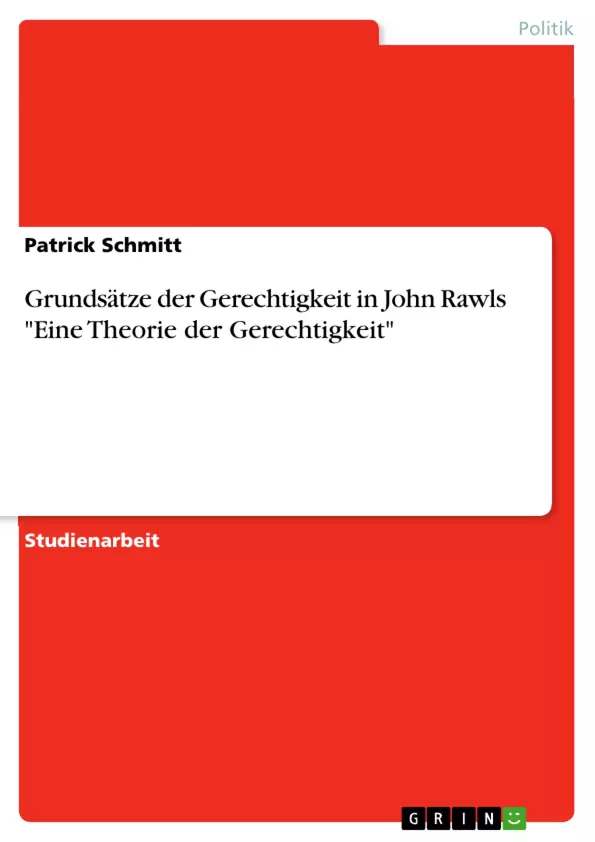„Absolute Gerechtigkeit gibt es nicht, und wenn jemand absolute Gerechtigkeit anstrebt, wird es furchtbar ungerecht“.
Dieses Zitat war ursprünglich sicherlich nicht auf die Frage der Gesamtgerechtigkeit gemünzt, trifft jedoch die Kernfrage von Gerechtigkeitsverständnis recht gut.
John Rawls hat sich in seinem großen Werk von 1971 ‚Eine Theorie der Gerechtigkeit’, den Fragen gestellt:
Was ist überhaupt Gerechtigkeit?
Wer bestimmt überhaupt, was für wen gerecht ist oder sein kann?
Kann man Gerechtigkeit verallgemeinern, bzw. kann man eine ‚Formel’ entwickeln die für alle gerecht ist?
Um diese Fragen zu beantworten, muss man sich zuerst mit der Begrifflichkeit der Gerechtigkeit auseinander setzen. Jeder Mensch hat eine Vorstellung von Gerechtigkeit, was diese ausmacht und was ungerecht ist. Dafür jedoch eine allgemeingültige Regel aufzustellen, die für jeden Zustand, zu jeder Zeit und für jeden Menschen gilt, ist nahezu unmöglich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung der Gerechtigkeit
- Was ist gerecht? Gibt es eine allg. Formel für Gerechtigkeit?
- „Der Urzustand“
- Annahmen im Urzustand
- Bedeutung für die Grundsätze der Gerechtigkeit
- John Rawls' Gerechtigkeitsprinzipien
- Die Gerechtigkeitsgrundsätze und ihre Vorrangregeln
- Bedeutung der lexikalischen Ordnung
- Aufgaben der Gerechtigkeitstheorie
- Schluss
- Verständnis der Grundsätze, Anwendbarkeit in der Praxis
- Kritik Rawls am Utilitarismus, Kontraktualismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
John Rawls' Werk "Eine Theorie der Gerechtigkeit" befasst sich mit der Frage, was Gerechtigkeit bedeutet und wie man eine allgemeingültige Formel für Gerechtigkeit entwickeln kann. Rawls argumentiert, dass es eines „Urzustands“ bedarf, um zu einer fairen Übereinkunft über Regeln der Gerechtigkeit zu kommen. In diesem Zustand, geprägt von Gleichheit, Verbindlichkeit und dem „Schleier des Nichtswissens“, können Individuen ohne Vorurteile über ihre eigene Position in der Gesellschaft grundlegende Gerechtigkeitsprinzipien entwickeln.
- Das Konzept des „Urzustands“ als Grundlage für die Entwicklung von Gerechtigkeitsprinzipien.
- Die Rolle der Gleichheit, Verbindlichkeit und des „Schleiers des Nichtswissens“ im Urzustand.
- Die Bedeutung von Vernunft und Gerechtigkeitssinn für die Entwicklung fairer Gerechtigkeitsgrundsätze.
- Die Anwendung der Gerechtigkeitsprinzipien in der Praxis und die Kritik an anderen philosophischen Strömungen wie dem Utilitarismus und dem Kontraktualismus.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Buches beleuchtet die Relevanz des Gerechtigkeitsempfindens und die Frage, ob eine allgemeingültige Formel für Gerechtigkeit möglich ist. Rawls beschreibt, dass ein Gerechtigkeitsempfinden auf der Gleichbehandlung aller Menschen basiert, und dass Planungssicherheit und Vorhersehbarkeit in einem gerechten System unerlässlich sind. Im zweiten Kapitel erläutert Rawls das Konzept des „Urzustands“, ein hypothetischer Raum, in dem verschiedene Annahmen gelten, um faire Gerechtigkeitsgrundsätze zu entwickeln. Die Annahme der Gleichheit, Verbindlichkeit und der „Schleier des Nichtswissens“ ermöglichen eine objektive Entscheidungsfindung. Der dritte Abschnitt befasst sich mit den von Rawls entwickelten Gerechtigkeitsprinzipien und deren Bedeutung in der Praxis. Das Schluss kapitel beleuchtet die Anwendbarkeit der Grundsätze in der Praxis und kritisiert alternative Ansätze wie den Utilitarismus und den Kontraktualismus.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Gerechtigkeit, Urzustand, Gleichheit, Verbindlichkeit, Schleier des Nichtswissens, Vernunft, Gerechtigkeitsprinzipien, Utilitarismus, Kontraktualismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Urzustand“ bei John Rawls?
Der Urzustand ist ein hypothetisches Gedankenexperiment, in dem Menschen über die Grundregeln einer Gesellschaft entscheiden, ohne ihre eigene spätere Position darin zu kennen.
Was bedeutet der „Schleier des Nichtswissens“?
Er ist das zentrale Element des Urzustands: Niemand weiß, ob er reich, arm, talentiert oder krank sein wird. Dies sichert eine objektive und faire Entscheidung über Gerechtigkeitsprinzipien.
Welche zwei Hauptprinzipien der Gerechtigkeit stellt Rawls auf?
Erstens: Gleiche Grundfreiheiten für alle. Zweitens: Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind nur zulässig, wenn sie zum Vorteil der am wenigsten Begünstigten dienen (Differenzprinzip).
Warum kritisiert Rawls den Utilitarismus?
Rawls lehnt den Utilitarismus ab, weil dieser das Wohl der Mehrheit über die Rechte des Einzelnen stellen könnte, was in seinem System der Fairness unzulässig ist.
Was versteht Rawls unter der „lexikalischen Ordnung“?
Dies ist eine Vorrangregel: Das Prinzip der gleichen Freiheit steht immer an erster Stelle und darf nicht für wirtschaftliche Vorteile geopfert werden.
- Citar trabajo
- Patrick Schmitt (Autor), 2012, Grundsätze der Gerechtigkeit in John Rawls "Eine Theorie der Gerechtigkeit", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298931