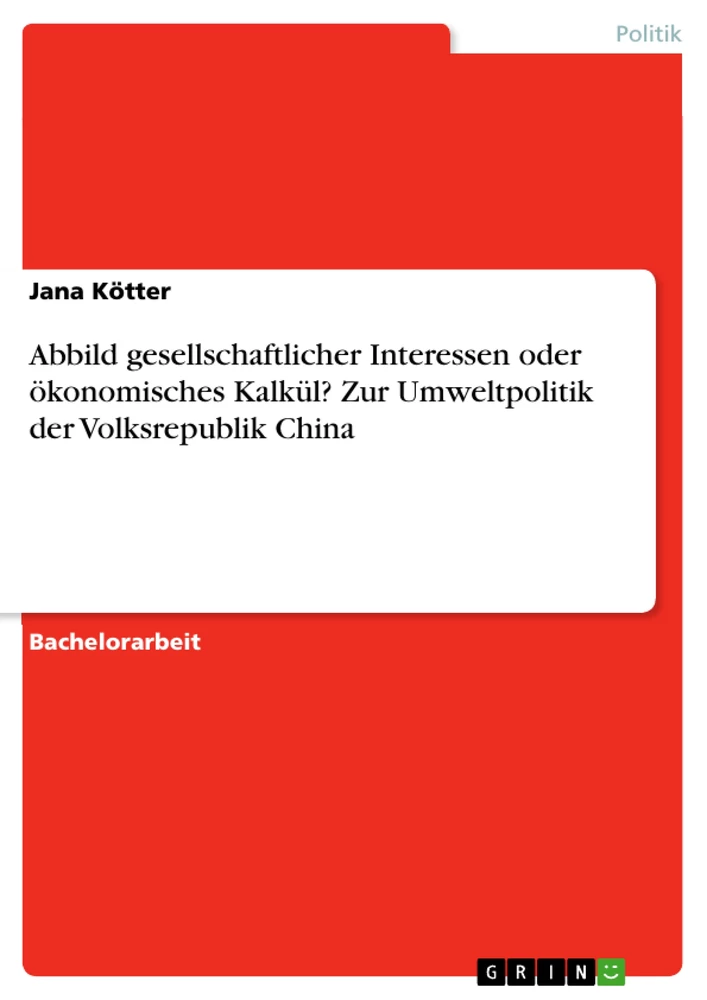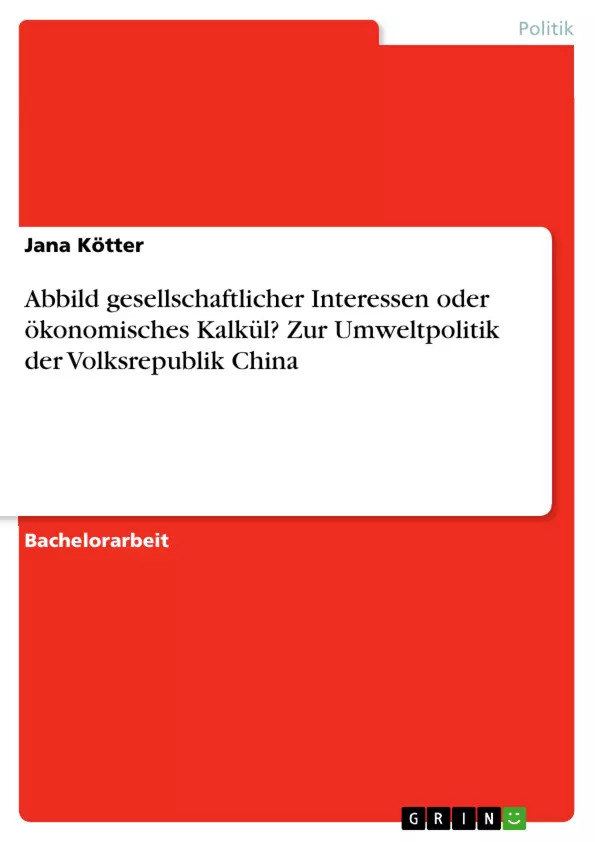Denkt man an China, so denkt man an Wachstum. Seit den späten 1970er Jahren und dem ökonomischen Reformkurs Deng Xiaopings legt der östliche „Drache“ ein wirtschaftliches Wachstum mit beeindruckender Rasanz hin: Bereits 2004 sprach die New York Times von einem „chinesischen Jahrhundert“ und stellte fest: „Das Land hat sich verändert, nun verändert es die Welt.“
Doch nicht nur das wirtschaftliche Wachstum des Landes ist enorm: Der Primärenergieverbrauch der Volksrepublik ist in den Jahren von 2000 bis 2009 um mehr als 100 Prozent gestiegen. 80 Prozent dieses Energieverbrauchs werden durch Kohle erzeugt – hier zeigt sich aus Sicht des Umweltschutzes das wohl größte Problem des Wirtschafts-Giganten, das sich nicht nur in extrem schlechten Luftwerten der Großstädte zeigt. 16 der weltweit 20 am stärksten verschmutzten Städte liegen in China; damit einher geht ein starker Anstieg der Anzahl an umweltbedingten Erkrankungen.
Die 1998 getroffene Prognose, China werde die USA im Jahr 2030 als weltweit größter CO2-Emittent überholen, trat bereits 2007 ein. Es zeigt sich deutlich, dass der wachsende
Bedarf an fossilen Energien zum Stillen von Chinas „Energiehunger“ somit nicht nur die nationale Umweltproblematik verschlimmert, sondern auch einen nicht zu verachtenden
Beitrag zum globalen Klimawandel beiträgt.
Erste umweltpolitische Bestrebungen des Landes waren dabei schon lange vor diesen Prognosen zu beobachten: Im ländlichen Sektor gab es bereits vor Gründung der
Volksrepublik (1949) umweltrelevante Projekte, vorwiegend wasserbaulicher Art (bspw. Staudämme). In den 1970er Jahren kam es zögerlich zu ersten Anfängen einer auch so
betitelten „Umweltpolitik“, das Environmental Protection Leading Group Office (EPLGO) wurde gegründet, China nahm an der UNO-Umweltkonferenz in Stockholm (1972) teil.
Doch erst 1998, mit der Erweiterung der Nationalen Umweltschutzagentur (National Environmental Protection Agency, NEPA) in die State Environmental Protection Administration (SEPA) und ihrer Ausstattung mit ministerialen Kompetenzen, zeigte sich eine „neue Entwicklungsstufe der Umweltschutzgesetzgebung der Volksrepublik China“. Umweltpolitik wird nicht mehr nur „nebenbei“ und punktuell, besonders in Tourismus-relevanten Städten, sondern aktiv betrieben.
Die vorliegende Bachelor-Arbeit untersucht die Motive hinter dieser Entwicklung. Den theoretischen Zugang liefern Liberalismus und Neo-Gramscianismus mit einem Fokus auf den Präferenzbildungsprozessen innerhalb des Staates.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1 Reichweite der theoretischen Ansätze
- 2.2 Der Staat als Abbildung gesellschaftlicher Interessen: zur Theorie des Liberalismus
- 2.2.1 Die Renaissance des Liberalismus im historischen Kontext des Ost-West-Konfliktes
- 2.2.2 Zentrale Gedanken des Liberalismus
- 2.3 Wechselbeziehungen zwischen Ökonomie und Politik: zur Theorie des Neo-Gramscianismus
- 2.3.1 Die Weltwirtschaftskrise der frühen 1970er Jahre: Historische Hintergründe des Neo-Gramscianismus
- 2.3.2 Zentrale Gedanken des Neo-Gramscianismus
- 2.4 Entwicklung der Hypothesen
- 3. Umweltpolitisches Engagement der VR China
- 3.1 Das Entstehen eines chinesischen Umweltbewusstseins: Historische Hintergründe
- 3.2 Der Weg zu Chinas neuer, „aktiven\" Umweltpolitik
- 3.3 Ein Fazit: Chinas Umweltpolitik der vergangenen Dekade
- 4. Zur Erklärungskraft liberaler und neo-gramscianischer Ansätze am empirischen Beispiel der VR China
- 4.1 Liberale Perspektive
- 4.1.1 Überprüfung der Hypothesen
- 4.1.1.1 Zivilgesellschaftliche Umweltproteste
- 4.1.1.2 Nichtregierungsorganisationen mit Bezug zu Umweltthematiken
- 4.1.1.3 Mediale Präsenz des Themas Umweltschutz
- 4.1.2 Zur Erklärungskraft des liberalen Ansatzes - ein Resümee
- 4.1.3 Schwächen der liberalen Perspektive
- 4.1.1 Überprüfung der Hypothesen
- 4.2 Neo-gramscianische Perspektive
- 4.2.1 Überprüfung der Hypothesen
- 4.2.1.1 Ökonomischer Gewinn
- 4.2.1.2 Soziale Stabilität / Gesellschaftlicher Wohlstand
- 4.2.1.3 Allgemeine Akzeptanz des Hegemons
- 4.2.2 Zur Erklärungskraft des neo-gramscianischen Ansatzes – ein Resümee
- 4.2.3 Schwächen der neo-gramscianischen Perspektive
- 4.2.1 Überprüfung der Hypothesen
- 4.1 Liberale Perspektive
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis befasst sich mit der Umweltpolitik der Volksrepublik China und untersucht, inwiefern diese von gesellschaftlichen Interessen oder ökonomischen Kalkülen geprägt ist. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der chinesischen Umweltpolitik in den vergangenen Jahrzehnten und untersucht die Rolle der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der Regierung im Kontext des Umweltbewusstseins und -schutzes.
- Die Entwicklung eines chinesischen Umweltbewusstseins und die historischen Hintergründe
- Die Rolle der Zivilgesellschaft und der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) im Umweltschutz
- Die Bedeutung des ökonomischen Wachstums und der Ressourcenpolitik für die Umweltpolitik Chinas
- Die Analyse der chinesischen Umweltpolitik aus liberaler und neo-gramscianischer Perspektive
- Die Herausforderungen und Chancen für eine nachhaltige Umweltpolitik in China
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel stellt die Relevanz und Aktualität des Themas Umweltpolitik der Volksrepublik China heraus und führt in die Forschungsfrage ein. Es beleuchtet die rasante wirtschaftliche Entwicklung Chinas und die damit verbundenen Umweltprobleme.
Kapitel 2: Theoretischer Rahmen Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Ansätze des Liberalismus und des Neo-Gramscianismus als Grundlage für die Analyse der chinesischen Umweltpolitik. Es werden die zentralen Gedanken beider Theorien sowie ihre Relevanz für das Forschungsfeld erläutert.
Kapitel 3: Umweltpolitisches Engagement der VR China Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des chinesischen Umweltbewusstseins und die Entstehung einer aktiven Umweltpolitik. Es analysiert die wichtigsten Meilensteine und die Herausforderungen der chinesischen Umweltpolitik.
Kapitel 4: Zur Erklärungskraft liberaler und neo-gramscianischer Ansätze am empirischen Beispiel der VR China Dieses Kapitel untersucht die Erklärungskraft der liberalen und neo-gramscianischen Ansätze anhand empirischer Beispiele aus der chinesischen Umweltpolitik. Es analysiert die Rolle der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der Regierung im Kontext des Umweltschutzes.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Umweltschutz, nachhaltige Entwicklung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik, Liberalismus, Neo-Gramscianismus, Volksrepublik China, sowie der Analyse der Umweltpolitik aus verschiedenen Perspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich Chinas Energieverbrauch in den letzten Jahren entwickelt?
Zwischen 2000 und 2009 stieg der Primärenergieverbrauch um über 100 Prozent, wobei 80 Prozent der Energie aus Kohle gewonnen werden, was zu massiven Umweltproblemen führt.
Was sind die Motive hinter Chinas neuer Umweltpolitik?
Die Arbeit untersucht, ob die Politik primär durch gesellschaftliche Proteste (Liberalismus) oder durch ökonomisches Kalkül und den Erhalt der sozialen Stabilität (Neo-Gramscianismus) getrieben wird.
Welche Rolle spielen Umwelt-NGOs in China?
Aus liberaler Perspektive wird geprüft, inwieweit zivilgesellschaftliche Organisationen und Umweltproteste tatsächlich Einfluss auf die staatliche Präferenzbildung haben.
Wie schlimm ist die Luftverschmutzung in chinesischen Städten?
Statistiken zeigen, dass 16 der weltweit 20 am stärksten verschmutzten Städte in China liegen, was zu einem starken Anstieg umweltbedingter Erkrankungen geführt hat.
Was war die Bedeutung der Gründung der SEPA 1998?
Mit der Aufwertung der Umweltschutzagentur zur State Environmental Protection Administration (SEPA) erhielt der Umweltschutz erstmals ministeriale Kompetenzen und wurde aktiver betrieben.
- Quote paper
- Jana Kötter (Author), 2011, Abbild gesellschaftlicher Interessen oder ökonomisches Kalkül? Zur Umweltpolitik der Volksrepublik China, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299709