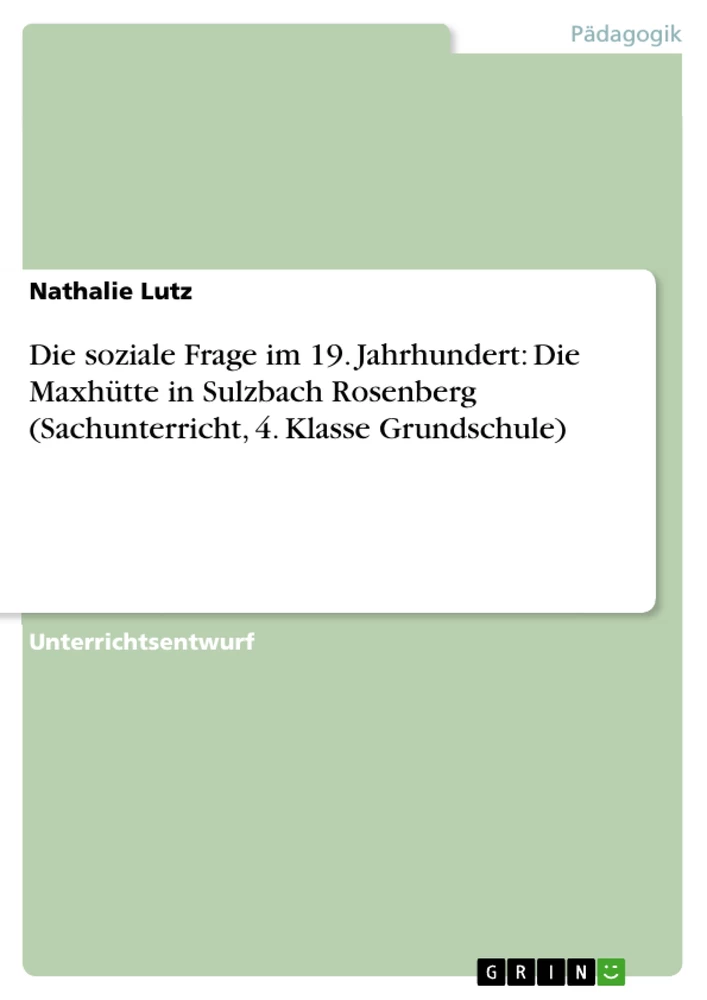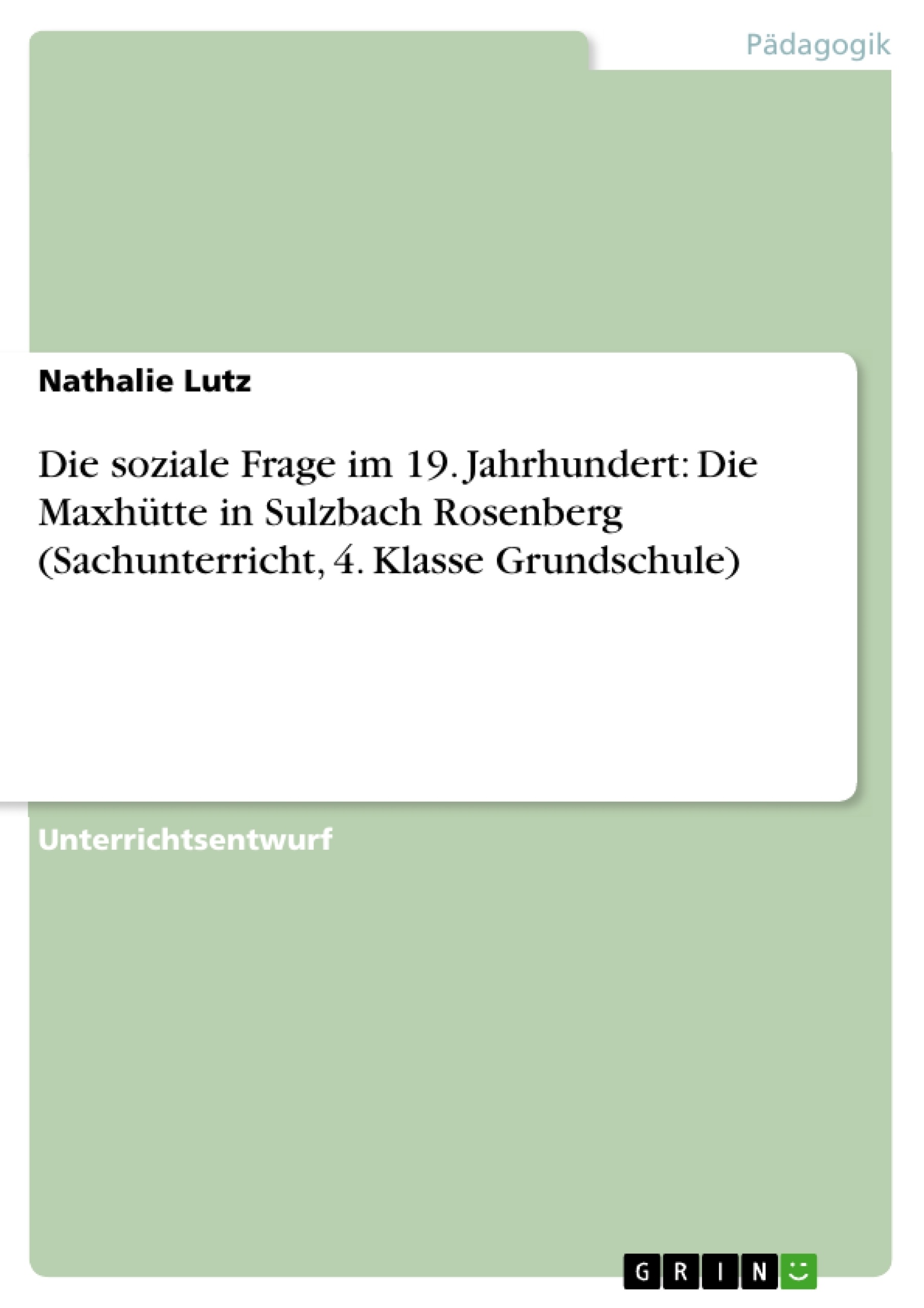Die Umsetzung einer Unterrichtsstunde bezüglich des Themas der sozialen Frage wird in dieser Arbeit anhand der Maxhütte in Sulzbach- Rosenberg im 19. Jahrhundert beschrieben. Die Methode der Bildbetrachtung und -analyse werden im Besonderen verwendet und den Schülern eine abwechslungsreiche Unterrichtsform dargeboten.
Lernziele:
Die Schüler sollen unterschiedlicher Methoden zur Arbeit mit Bildern kennenlernen und anwenden können.
Die Arbeitsverhältnisse von Fabrikarbeitern im 19. Jahrhundert sollen durch die Bildarbeit vom regionalen Standpunkt aus auf ganz Deutschland ausweitend erfahren werden.
Ein Ausblick auf die allgemeine soziale Lage der Arbeiter soll erfahren werden und zum Nachdenken über Möglichkeiten zur Verbesserung anregen.
Die soziale Kompetenz der Schüler soll gefördert werden, sie sollen somit in der Lage sein als Gruppe einen Arbeitsauftrag zu bearbeiten und anschließend zu präsentieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fachthema: Die soziale Frage
- 3. Didaktisch-methodische Aufbereitung
- 4. Didaktisch-methodische Reflexion
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Behandlung der sozialen Frage im Sachunterricht der Grundschule, speziell anhand der Arbeitsverhältnisse in der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg im 19. Jahrhundert. Ziel ist es, didaktisch-methodische Ansätze aufzuzeigen, um dieses komplexe Thema für Grundschüler verständlich und ansprechend aufzubereiten.
- Die soziale Frage im 19. Jahrhundert in Deutschland
- Didaktische Aufbereitung historischer Themen im Sachunterricht
- Methoden der Geschichtsvermittlung an Grundschüler
- Regionale Geschichte und ihre Bedeutung im Unterricht
- Vergleich der Arbeitsverhältnisse im 19. Jahrhundert mit der Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext des Themas "Soziale Frage" im Lehrplan der bayerischen Grundschulen und legt den Fokus auf die Behandlung der Arbeitsverhältnisse in der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg im 19. Jahrhundert für die vierte Jahrgangsstufe. Es wird die Einbettung in das Lernfeld 3 des Sachunterrichts (Orientierung in Zeit und Raum) erläutert und die didaktischen Ziele der Stunde definiert: Verständnis der Arbeitsverhältnisse, Vergleich mit der Gegenwart, Förderung des Geschichtsinteresses durch den Einsatz von Bildern und die Entwicklung von Methodenkompetenz. Der regionale Bezug wird hervorgehoben, ebenso wie das Ziel, ein umfassendes Geschichtsverständnis zu schaffen.
2. Fachthema: Die soziale Frage: Dieses Kapitel beleuchtet die sozialen Missstände während der Industrialisierung Deutschlands im 19. Jahrhundert. Der wirtschaftliche Aufschwung führte zu schlechten Arbeitsbedingungen für die Arbeitermassen, geprägt von niedrigen Löhnen, Kinder- und Frauenarbeit, langen Arbeitszeiten, fehlender sozialer Absicherung und unzureichenden Wohnverhältnissen. Der Text verweist auf die "question sociale" der Französischen Revolution und beschreibt verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Lage, darunter kirchliche Initiativen (z.B. "Arbeiterfrage und das Christentum", Rerum Novarum), Wohltätigkeitsvereine, unternehmerisches Engagement (Beispiel Krupp) und die entstehende Arbeiterbewegung mit Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Schließlich werden staatliche Reformen wie die Einführung von Sozialversicherungen und das Verbot der Kinderarbeit als positive Entwicklungen dargestellt.
Schlüsselwörter
Soziale Frage, Industrialisierung, 19. Jahrhundert, Arbeitsverhältnisse, Maxhütte Sulzbach-Rosenberg, Sachunterricht, Didaktik, Methoden, regionale Geschichte, Kinderarbeit, Sozialversicherungen, Arbeiterbewegung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Soziale Frage im Sachunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der didaktischen Aufbereitung der „Sozialen Frage“ im 19. Jahrhundert für den Sachunterricht der Grundschule. Konkret wird die Darstellung der Arbeitsverhältnisse in der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg im 19. Jahrhundert für die vierte Jahrgangsstufe untersucht.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, didaktisch-methodische Ansätze aufzuzeigen, um das komplexe Thema „Soziale Frage“ für Grundschüler verständlich und ansprechend zu gestalten. Es sollen Methoden zur Geschichtsvermittlung an Grundschüler entwickelt und der regionale Bezug der Maxhütte in den Unterricht integriert werden. Ein Vergleich der Arbeitsverhältnisse im 19. Jahrhundert mit der Gegenwart ist ebenfalls angestrebt.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Soziale Frage im 19. Jahrhundert in Deutschland, die didaktische Aufbereitung historischer Themen im Sachunterricht, Methoden der Geschichtsvermittlung an Grundschüler, regionale Geschichte und ihre Bedeutung im Unterricht sowie einen Vergleich der Arbeitsverhältnisse im 19. Jahrhundert mit der Gegenwart.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Fachthema „Soziale Frage“, ein Kapitel zur didaktisch-methodischen Aufbereitung, ein Kapitel zur didaktisch-methodischen Reflexion und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den Kontext und die didaktischen Ziele. Das Kapitel zum Fachthema beleuchtet die sozialen Missstände während der Industrialisierung. Die didaktisch-methodischen Kapitel befassen sich mit der konkreten Umsetzung im Unterricht.
Welche Aspekte der Sozialen Frage werden im Detail untersucht?
Das Kapitel zur Sozialen Frage beleuchtet die schlechten Arbeitsbedingungen während der Industrialisierung, einschließlich niedriger Löhne, Kinder- und Frauenarbeit, langer Arbeitszeiten, fehlender sozialer Absicherung und unzureichender Wohnverhältnisse. Es werden verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Lage behandelt, wie kirchliche Initiativen, Wohltätigkeitsvereine, unternehmerisches Engagement und die entstehende Arbeiterbewegung mit Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Staatliche Reformen wie die Einführung von Sozialversicherungen und das Verbot der Kinderarbeit werden ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Frage, Industrialisierung, 19. Jahrhundert, Arbeitsverhältnisse, Maxhütte Sulzbach-Rosenberg, Sachunterricht, Didaktik, Methoden, regionale Geschichte, Kinderarbeit, Sozialversicherungen, Arbeiterbewegung.
Für welche Jahrgangsstufe ist die didaktische Aufbereitung gedacht?
Die didaktische Aufbereitung des Themas ist speziell für die vierte Jahrgangsstufe der Grundschule konzipiert.
Welchen Bezug hat die Arbeit zum Lehrplan?
Die Arbeit bezieht sich auf den Lehrplan der bayerischen Grundschulen und betrachtet die Einbettung in das Lernfeld 3 des Sachunterrichts (Orientierung in Zeit und Raum).
- Citation du texte
- Nathalie Lutz (Auteur), 2013, Die soziale Frage im 19. Jahrhundert: Die Maxhütte in Sulzbach Rosenberg (Sachunterricht, 4. Klasse Grundschule), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300362