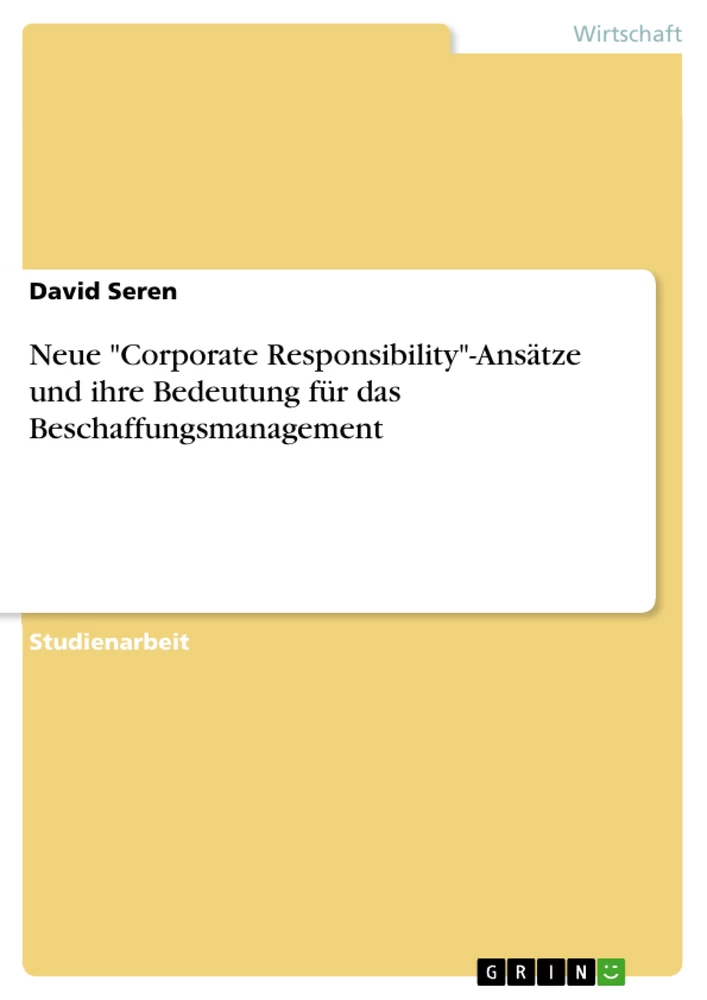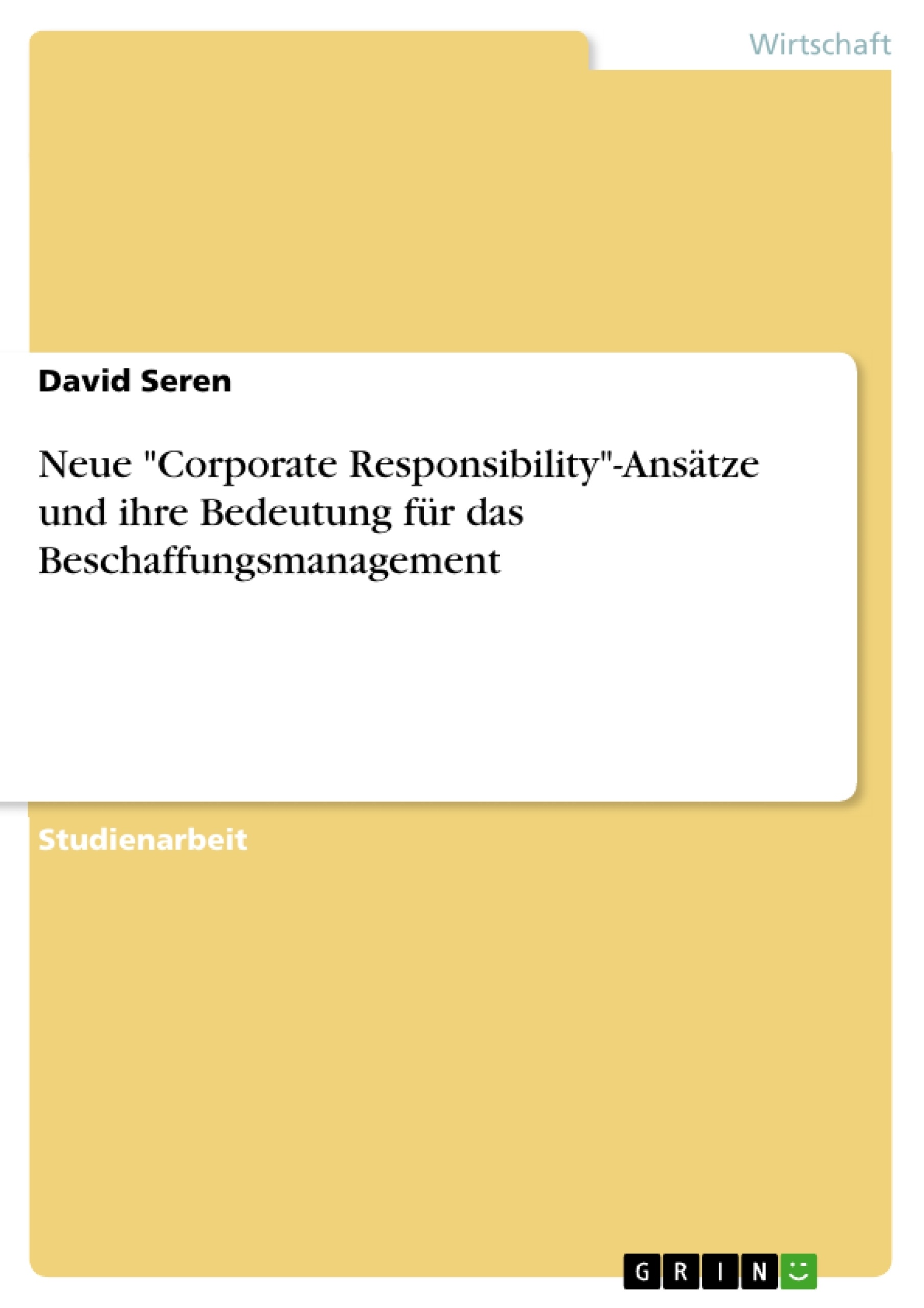Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, welche Ansätze für das CR-Management in der jüngeren Vergangenheit entwickelt wurden und welche Anwendungsmöglichkeiten es dafür im Beschaffungsprozess gibt.
Zu diesem Zweck wird zunächst ein Überblick über Begriffe und Handlungsfelder aus dem Bereich der Corporate Responsibility gegeben. Anschließend wird aufgezeigt, an welchen Stellen im Beschaffungsprozess sich Ansatzpunkte für CR-Maßnahmen bieten. Darauf folgt ein Überblick über etablierte CR-Instrumente im Bereich der Beschaffung. Schließlich werden junge Ansätze und Denkweisen auf dem Feld der Corporate Responsibility vorgestellt und deren Bezug zur Beschaffung aufgezeigt.
Spätestens seit dem Einsturz des Rana Plaza Gebäudekomplexes in Bangladesch im Jahr 2013 ist in der breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die Auswirkungen des Konsums und dem ihm zugrundeliegenden wirtschaftlichen Handeln entstanden.
Doch bereits vor dem Vorfall rückte das Thema der Corporate Responsibility (CR) kontinuierlich in den Fokus von Unternehmen. Der Menüpunkt „Nachhaltigkeit“ ist heute kaum noch von Webseiten großer Unternehmen wegzudenken. Jedoch lebt auch immer wieder Kritik an der Ernsthaftigkeit der Bemühungen und an der Wirksamkeit der Maßnahmen auf.
Neben steigender Beachtung im Endverbraucherbereich ist erfolgreiches Corporate Responsibility Management häufig auch im Business-to-Business Bereich ein ausschlaggebender Faktor für den Unternehmenserfolg.
Verfolgt ein Unternehmen dabei einen ganzheitlichen Ansatz, dürfen sich Betrachtungen und Maßnahmen nicht auf das Kerngeschäft beschränken. Vielmehr müssen weitere Bereiche entlang der Wertschöpfungskette mit einbezogen werden. Zu diesen zählt auch die Beschaffung, welche den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Corporate Responsibility-Begrifflichkeit in der Literatur
- 2.1 Definitionen und Begrifflichkeiten
- 2.2 Aufgaben des Corporate Responsibility Managements
- 3 Corporate Responsibility in der Beschaffung
- 3.1 Der Beschaffungsprozess in acht Schritten
- 3.2 Ansatzpunkte für Corporate Responsibility-Maßnahmen im Prozess
- 4 Etablierte Corporate Responsibility Ansätze im Beschaffungsmanagement
- 4.1 Codes of Conduct
- 4.2 Lieferantenzertifizierung
- 4.3 Öko- und Soziallabels
- 5 Beschaffungsnahe Corporate Responsibility Trends
- 5.1 CSR 2.0
- 5.2 Reifegradmodell
- 5.3 Shared Value
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Anwendung von Corporate Responsibility (CR)-Ansätzen im Beschaffungsmanagement. Sie soll aufzeigen, welche neuen CR-Ansätze in jüngerer Zeit entwickelt wurden und wie diese im Beschaffungsprozess implementiert werden können.
- Definition und Aufgaben von Corporate Responsibility
- Die Bedeutung von Corporate Responsibility in der Beschaffung
- Etablierte CR-Instrumente im Beschaffungsmanagement
- Aktuelle CR-Trends und ihre Relevanz für die Beschaffung
- Die Anwendung von Shared Value im Beschaffungsmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Corporate Responsibility ein und erläutert den Kontext der Arbeit. Es wird auf die steigende Bedeutung von CR sowohl im Endverbraucherbereich als auch im Business-to-Business Bereich hingewiesen.
Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Definitionen und Begrifflichkeiten aus der Literatur im Bereich der Corporate Responsibility. Es werden die Aufgaben des CR-Managements sowie die verschiedenen Handlungsfelder beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich dem Thema Corporate Responsibility in der Beschaffung. Der Beschaffungsprozess wird in acht Schritten dargestellt und es werden Ansatzpunkte für CR-Maßnahmen im Prozess identifiziert.
Kapitel 4 gibt einen Überblick über etablierte CR-Instrumente im Bereich der Beschaffung. Dazu gehören unter anderem Codes of Conduct, Lieferantenzertifizierung und Öko- und Soziallabels.
Kapitel 5 stellt aktuelle CR-Trends vor, wie z.B. CSR 2.0, das Reifegradmodell und Shared Value. Es wird gezeigt, wie diese Trends die Beschaffung beeinflussen und welche Möglichkeiten sie bieten.
Schlüsselwörter
Corporate Responsibility, Beschaffung, Nachhaltiges Beschaffungsmanagement, Codes of Conduct, Lieferantenzertifizierung, Öko- und Soziallabels, CSR 2.0, Reifegradmodell, Shared Value, Wertschöpfungskette, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Corporate Responsibility (CR) in der Beschaffung?
Es bedeutet die Integration von ökologischen und sozialen Standards in den gesamten Einkaufsprozess eines Unternehmens.
Was sind etablierte Instrumente für nachhaltigen Einkauf?
Zu den klassischen Instrumenten gehören Verhaltenskodizes (Codes of Conduct), Lieferantenzertifizierungen sowie Öko- und Soziallabels.
Was versteht man unter dem Konzept "Shared Value"?
Shared Value zielt darauf ab, wirtschaftlichen Erfolg so zu generieren, dass gleichzeitig ein Mehrwert für die Gesellschaft und die Umwelt entsteht.
Wie beeinflusste das Rana Plaza Unglück das CR-Management?
Der Einsturz 2013 schärfte das öffentliche Bewusstsein für Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten und erhöhte den Druck auf Unternehmen, Verantwortung zu übernehmen.
Was ist "CSR 2.0"?
Ein moderner Ansatz, der CSR nicht als Zusatzleistung, sondern als transformatives Element sieht, das tief im Geschäftsmodell verankert ist.
- Quote paper
- David Seren (Author), 2015, Neue "Corporate Responsibility"-Ansätze und ihre Bedeutung für das Beschaffungsmanagement, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300612